Heinrich von Kleist
Blumen sind hervorgebrochen,
Die zittern voll Blut
Und können nicht sagen,
Was da war…
Klagende Farben…
Blutende Eiche.
Heinrich von Kleist
Blumen sind hervorgebrochen,
Die zittern voll Blut
Und können nicht sagen,
Was da war…
Klagende Farben…
Blutende Eiche.
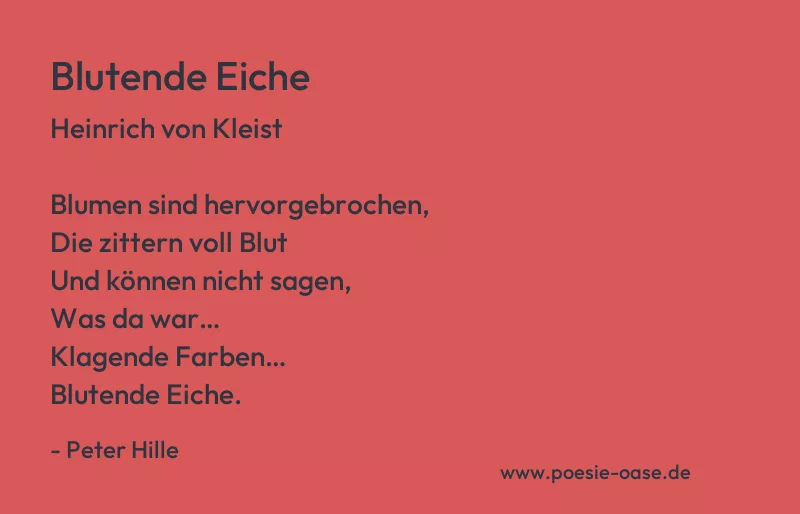
Das Gedicht „Blutende Eiche“ von Peter Hille ist eine kurze, bildhafte Meditation über Schmerz, Sprachlosigkeit und das Erschüttertsein. In wenigen, verdichteten Versen evoziert das lyrische Ich eine Szene von geheimnisvoller, fast unheimlicher Symbolik. Die „blutende Eiche“ steht dabei im Zentrum und fungiert als Sinnbild für eine tiefe Verletzung, womöglich auch für ein tragisches Ereignis. Die Natur – in Form von „zittern[den] Blumen voll Blut“ – scheint von diesem Geschehen mitbetroffen zu sein.
Der Bezug auf „Heinrich von Kleist“ am Anfang lässt sich als Hinweis auf dessen tragisches Ende deuten. Kleist nahm sich gemeinsam mit Henriette Vogel am Ufer des Wannsees das Leben. Die „blutende Eiche“ könnte sich also konkret auf jenen Ort beziehen, an dem der Doppelselbstmord stattfand. So lesen sich die „klagenden Farben“ und das „zittern voll Blut“ als Naturmetaphern, die den Schock und das Leiden in die Umgebung übertragen. Die Natur erscheint hier als stummer Zeuge der Tat, unfähig, das Geschehene in Worte zu fassen: „Und können nicht sagen, was da war…“
Hilles Sprache ist fragmentarisch und eindringlich. Durch die elliptische Struktur und die Verkürzung auf starke Einzelbilder entsteht eine beklemmende Atmosphäre. Das Gedicht lebt von der Spannung zwischen Schönheit („Blumen“, „Farben“) und Grauen („Blut“, „Klage“). Die „blutende Eiche“ wirkt wie ein Mahnmal, das die Tragik unausgesprochen im Raum stehen lässt und gleichzeitig eine tiefe emotionale Resonanz erzeugt.
Insgesamt ist „Blutende Eiche“ ein stark symbolisches Gedicht über Tod, Erinnerung und das Schweigen der Natur angesichts menschlicher Tragödien. Es verbindet Naturwahrnehmung mit geschichtlicher Anspielung und innerer Erschütterung auf sehr reduzierte, aber wirkungsvolle Weise.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.