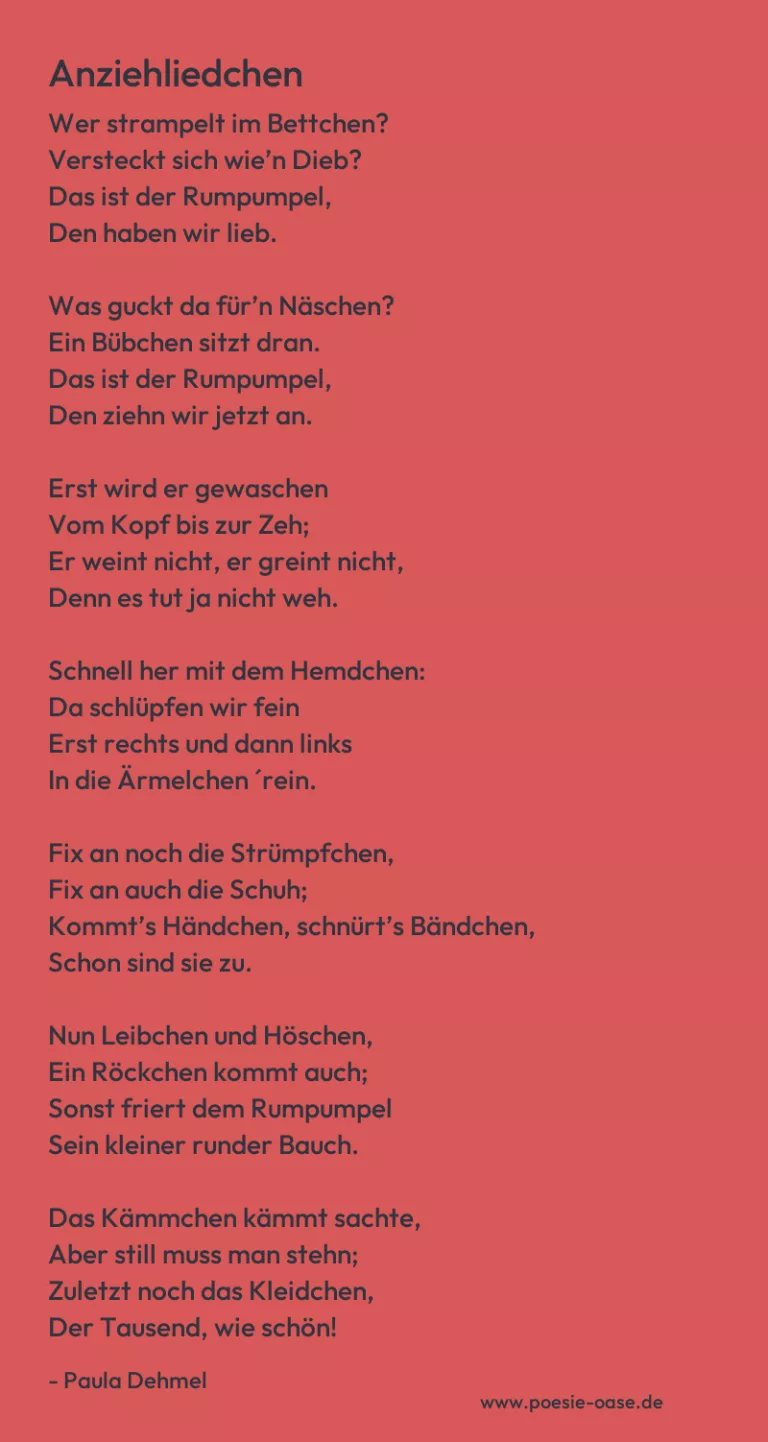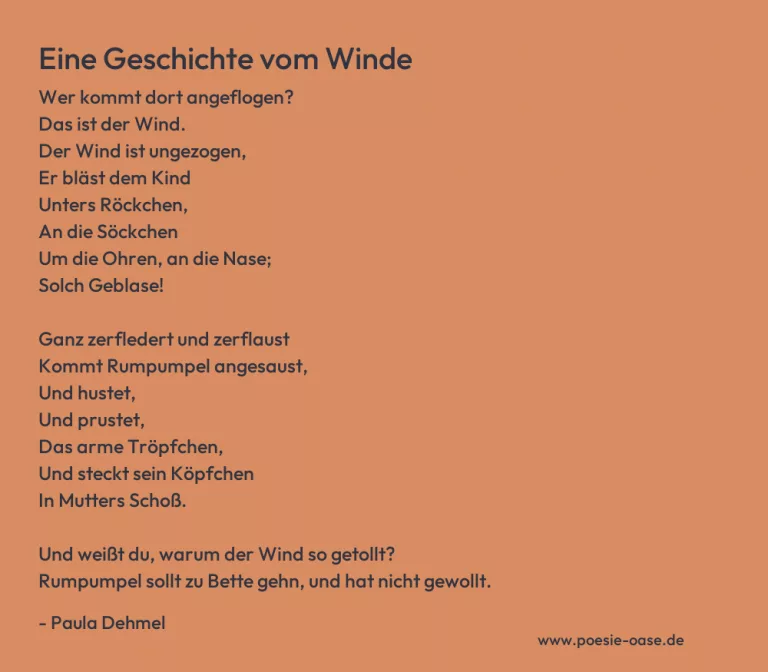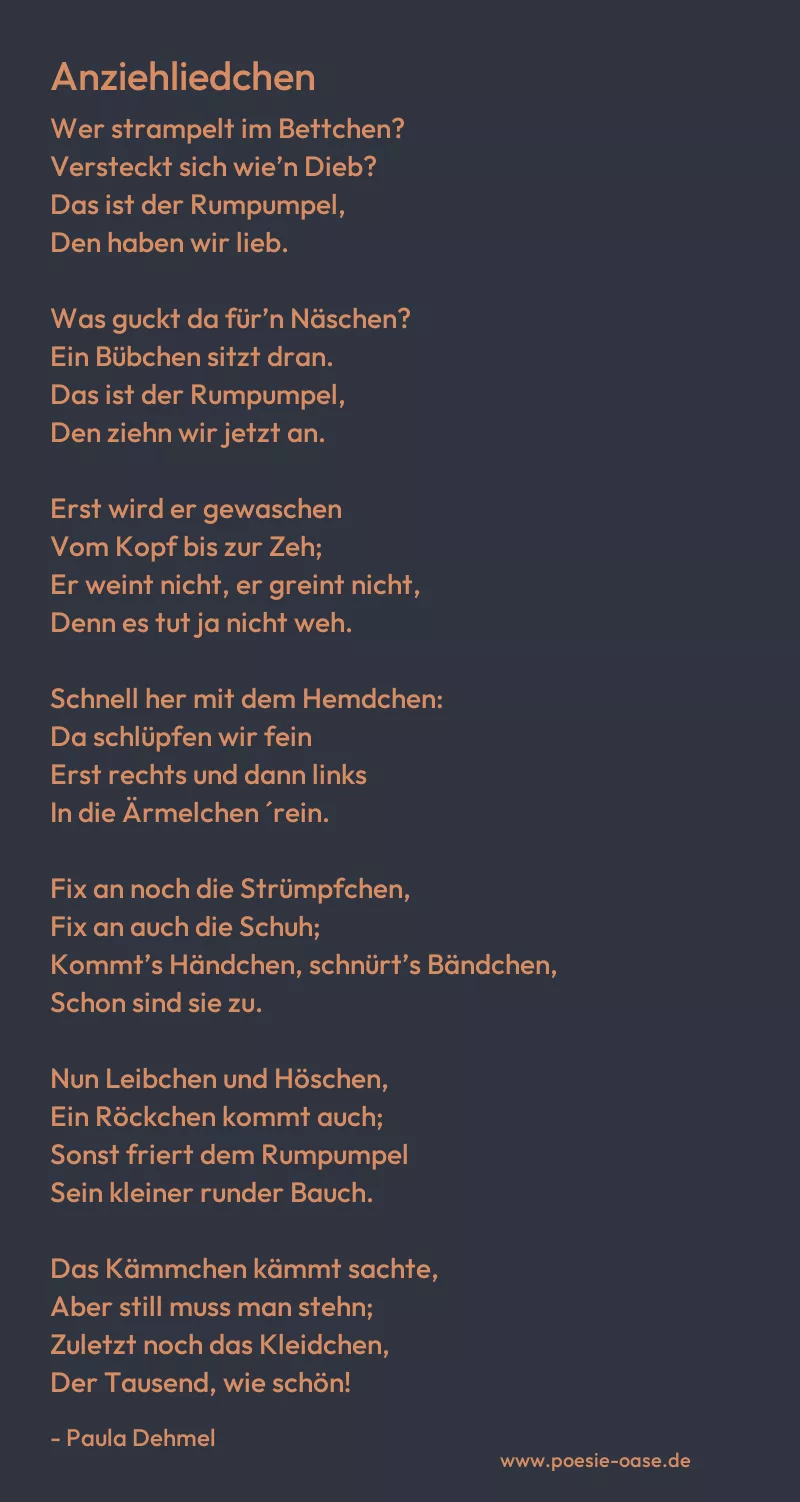Anziehliedchen 2
Wer strampelt im Bettchen?
Versteckt sich wie’n Dieb?
Das ist der Rumpumpel,
Den haben wir lieb.
Was guckt da für’n Näschen?
Ein Bübchen sitzt dran.
Das ist der Rumpumpel,
Den ziehn wir jetzt an.
Erst wird er gewaschen
Vom Kopf bis zur Zeh;
Er weint nicht, er greint nicht,
Denn es tut ja nicht weh.
Schnell her mit dem Hemdchen:
Da schlüpfen wir fein
Erst rechts und dann links
In die Ärmelchen ´rein.
Fix an noch die Strümpfchen,
Fix an auch die Schuh;
Kommt’s Händchen, schnürt’s Bändchen,
Schon sind sie zu.
Nun Leibchen und Höschen,
Ein Röckchen kommt auch;
Sonst friert dem Rumpumpel
Sein kleiner runder Bauch.
Das Kämmchen kämmt sachte,
Aber still muss man stehn;
Zuletzt noch das Kleidchen,
Der Tausend, wie schön!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
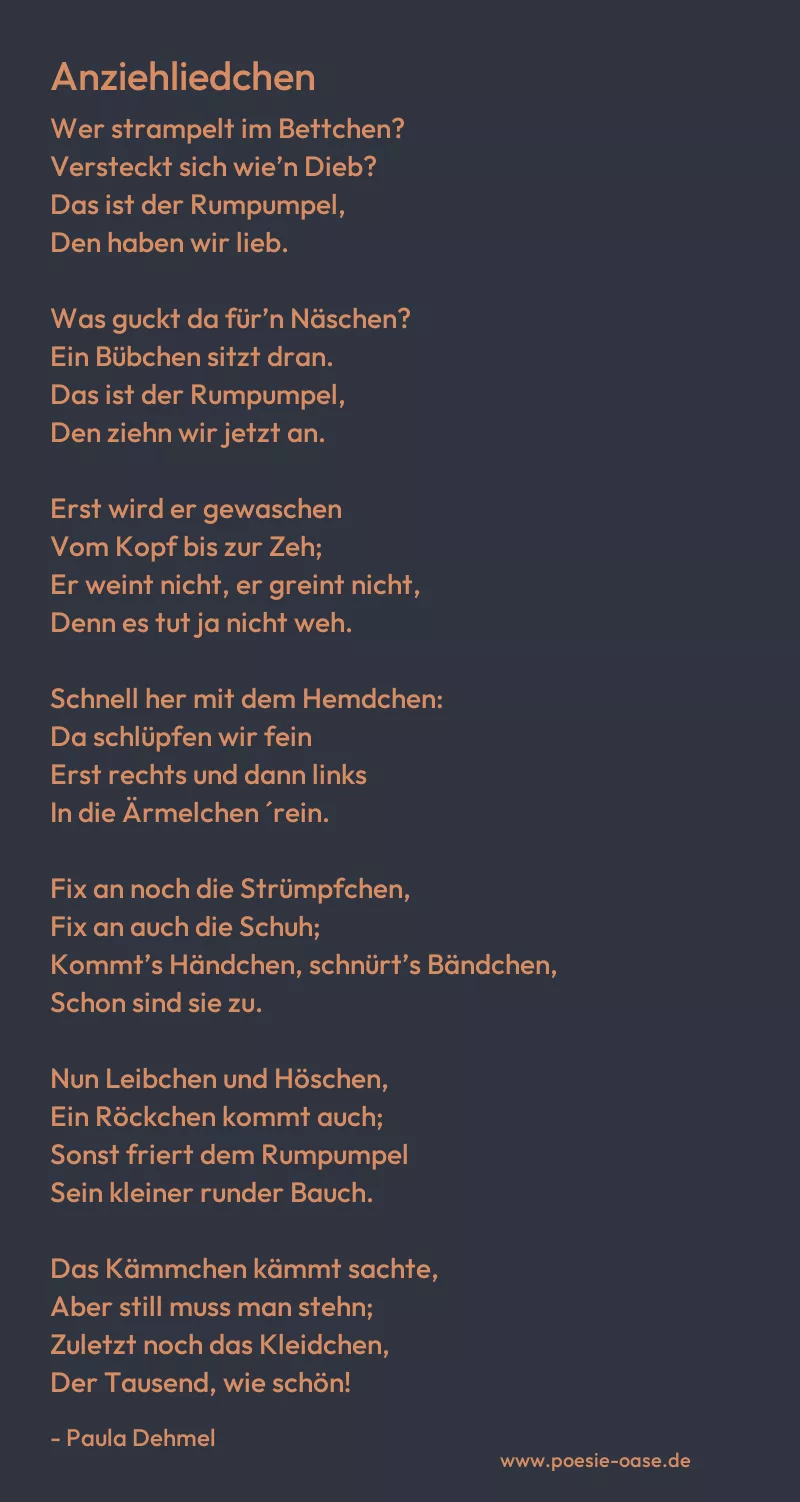
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Anziehliedchen“ von Paula Dehmel beschreibt in zarten, liebevollen Worten den Morgen eines kleinen Kindes, das in die Alltagsroutine des Anziehens eingebunden wird. Der „Rumpumpel“, ein lieblicher Kosename für das Kind, steht im Mittelpunkt des Gedichts, das auf humorvolle und verspielte Weise den Ablauf des Ankleidens schildert. Bereits zu Beginn wird die kindliche Neugier und Unschuld eingefangen, als der „Rumpumpel“ im Bettchen strampelt und sich „wie’n Dieb“ versteckt, was die verspielte und unschuldige Natur des Kindes betont.
Die Beschreibung der Anziehprozesse selbst ist detailreich und zeigt das liebevolle Bemühen der Erwachsenen, dem Kind zu helfen, sich fertig zu machen. Es wird gewaschen, gekämmt und schließlich in verschiedene Kleidungsstücke gehüllt – ein Vorgang, der nicht nur die Fürsorge und Zuneigung des Elternteils widerspiegelt, sondern auch den natürlichen Lebenszyklus des Kindes, das langsam in die Welt der äußeren Ordnung eingeführt wird. Die Zeilen „Er weint nicht, er greint nicht, / Denn es tut ja nicht weh“ betonen die beruhigende Atmosphäre des Ankleidens, in der das Kind ruhig bleibt, trotz der ungewohnten Eindrücke, die es in seiner Umgebung erlebt.
Der Reimfluss und die rhythmische Struktur des Gedichts vermitteln eine Leichtigkeit, die mit der Unbeschwertheit eines Kindes verbunden ist. Die einfache, fast lullende Sprache schafft eine sanfte Atmosphäre, die sowohl Trost spendet als auch die Zuneigung zwischen Eltern und Kind verdeutlicht. Die wiederholte Benennung der Kleidungsstücke – „Hemdchen“, „Strümpfchen“, „Schühchen“ – und die liebevolle Interaktion beim Ankleiden vermitteln eine heitere, fast musikalische Dimension, die den kindlichen Moment des Anziehens zu einem Spiel werden lässt.
Insgesamt ist Dehmels Gedicht eine wunderbare Darstellung des intimen Alltags zwischen Eltern und Kind. Es zeigt, wie kleine, alltägliche Handlungen durch Liebe und Fürsorge Bedeutung gewinnen. Das Gedicht endet mit dem Bild des „Kleidchens“, das in seiner Schönheit und Zartheit das Finale des Ankleideprozesses markiert und gleichzeitig die sanfte, unaufdringliche Freude des Moments einfängt. Es handelt sich um ein Gedicht, das nicht nur die Notwendigkeit des Ankleidens darstellt, sondern auch die Bindung und das Geborgenheitsgefühl, das diese einfachen Handlungen vermitteln.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.