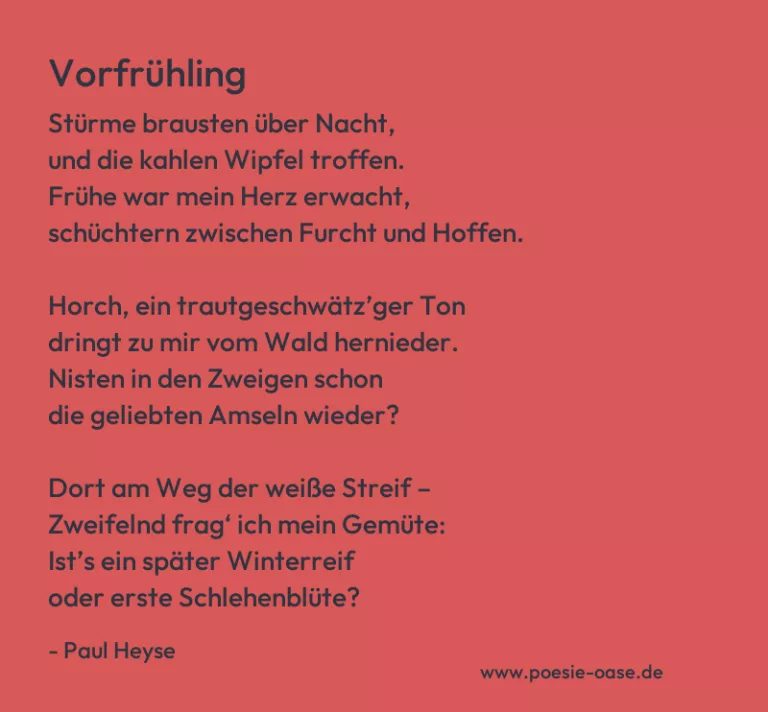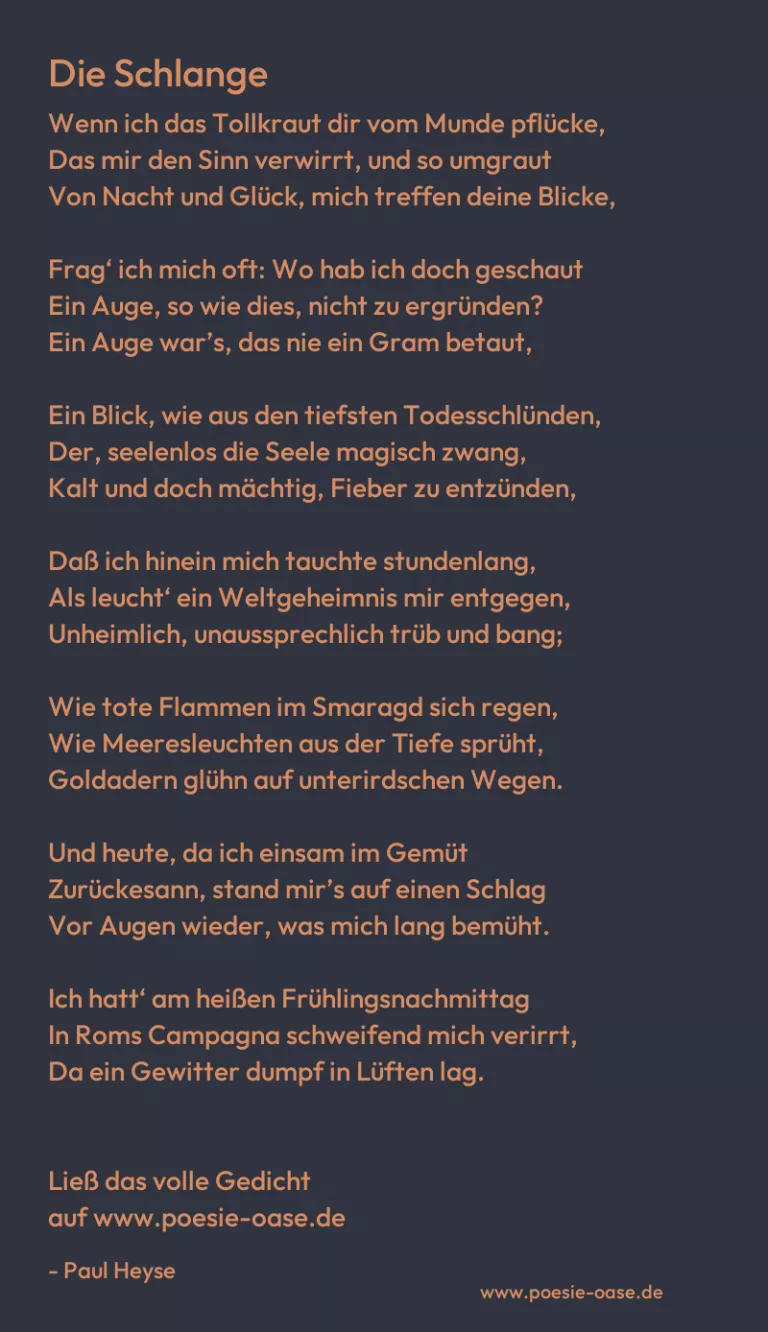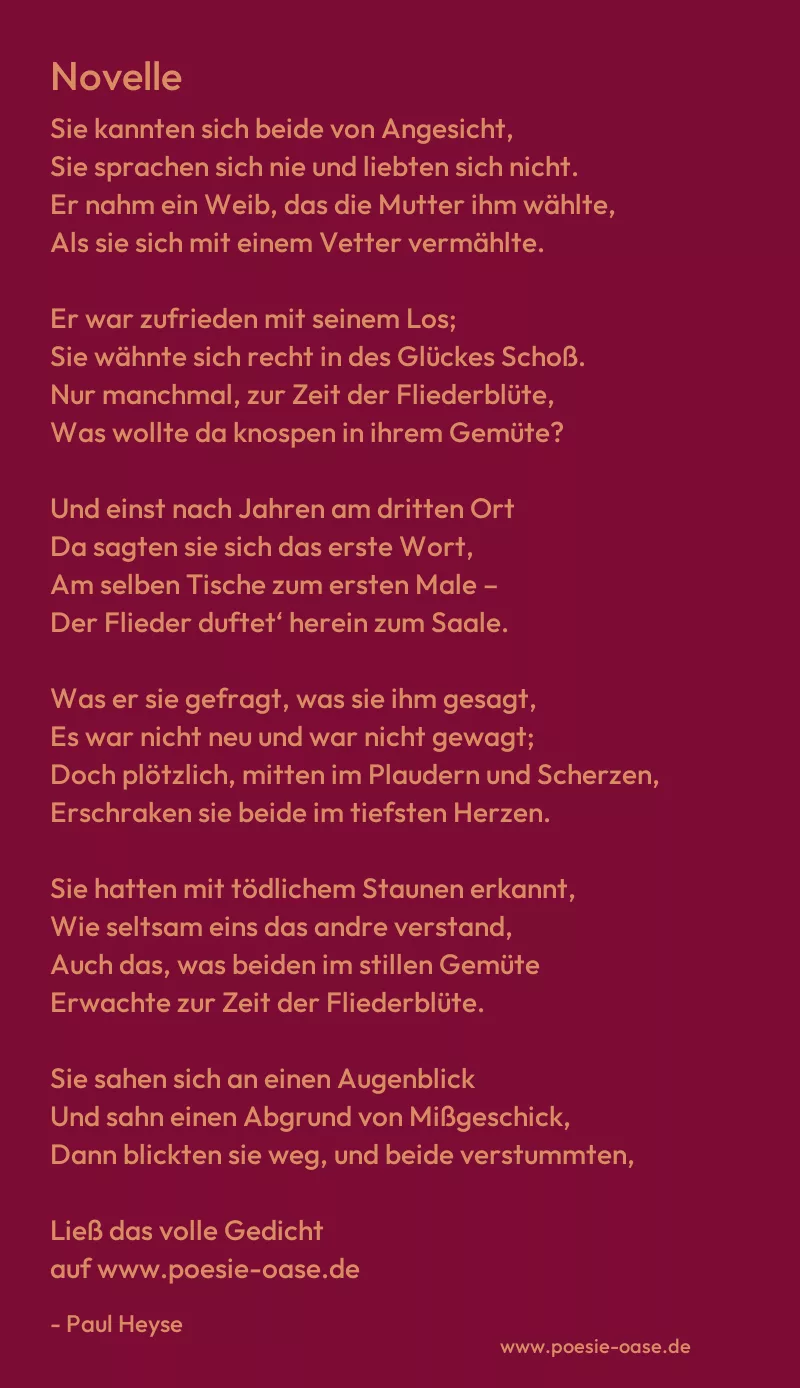Sie kannten sich beide von Angesicht,
Sie sprachen sich nie und liebten sich nicht.
Er nahm ein Weib, das die Mutter ihm wählte,
Als sie sich mit einem Vetter vermählte.
Er war zufrieden mit seinem Los;
Sie wähnte sich recht in des Glückes Schoß.
Nur manchmal, zur Zeit der Fliederblüte,
Was wollte da knospen in ihrem Gemüte?
Und einst nach Jahren am dritten Ort
Da sagten sie sich das erste Wort,
Am selben Tische zum ersten Male –
Der Flieder duftet‘ herein zum Saale.
Was er sie gefragt, was sie ihm gesagt,
Es war nicht neu und war nicht gewagt;
Doch plötzlich, mitten im Plaudern und Scherzen,
Erschraken sie beide im tiefsten Herzen.
Sie hatten mit tödlichem Staunen erkannt,
Wie seltsam eins das andre verstand,
Auch das, was beiden im stillen Gemüte
Erwachte zur Zeit der Fliederblüte.
Sie sahen sich an einen Augenblick
Und sahn einen Abgrund von Mißgeschick,
Dann blickten sie weg, und beide verstummten,
So munter rings die Gespräche summten.
Drauf ging sie nach Haus mit dem eigenen Mann,
Er führte sein Weib, so schieden sie dann
Und sagten, sie würden sich glücklich schätzen,
Die werte Bekanntschaft fortzusetzen.
Doch wie er am andern Morgen erwacht,
Was hat ihn so bitter lachen gemacht?
Und wie sie auffuhr von ihrem Kissen,
Was hat sie so heimlich weinen müssen?
Sie haben sich niemals wiedergesehn,
Sie wußten sich klug aus dem Weg zu gehn.
Nur immer zur Zeit der Fliederblüte
Wie Spätfrost schauert’s durch ihr Gemüte.