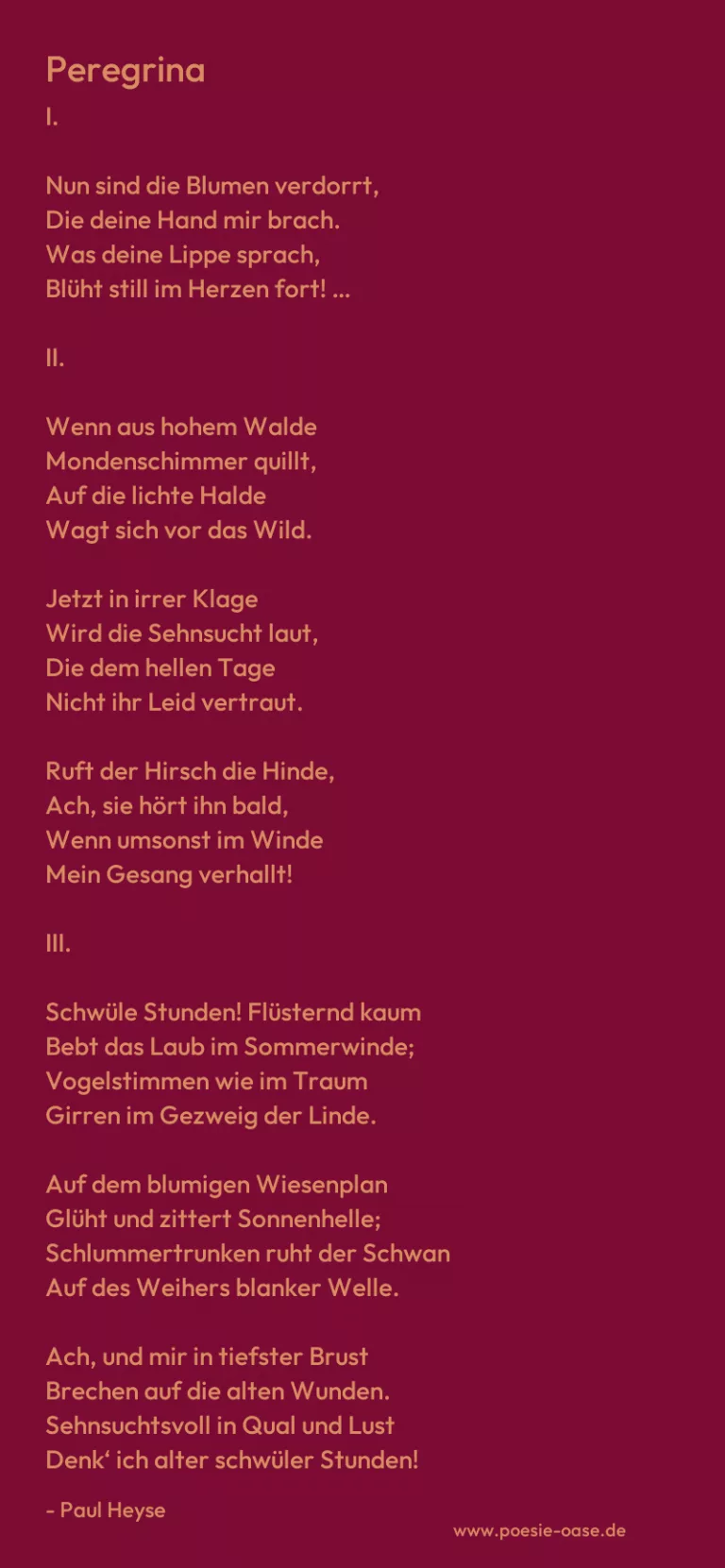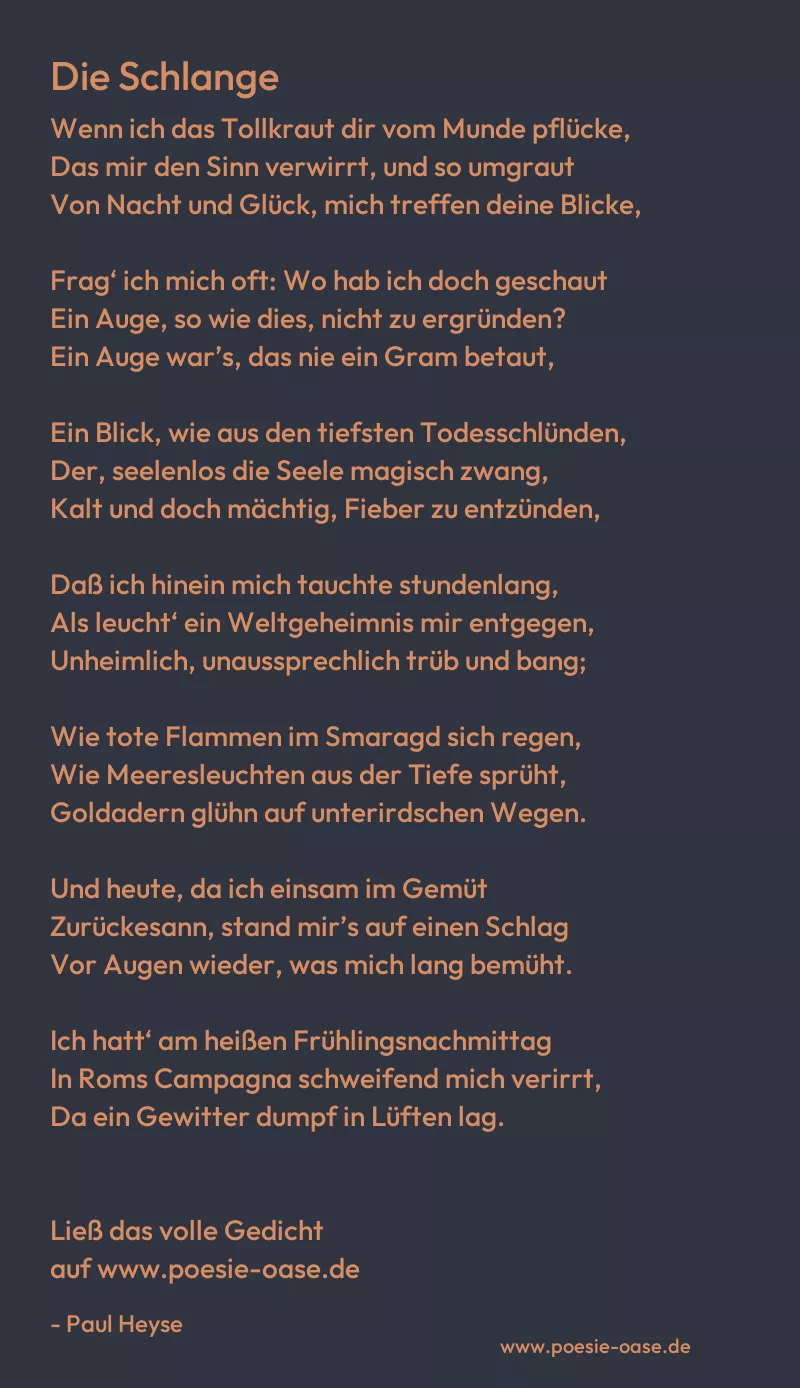Wenn ich das Tollkraut dir vom Munde pflücke,
Das mir den Sinn verwirrt, und so umgraut
Von Nacht und Glück, mich treffen deine Blicke,
Frag‘ ich mich oft: Wo hab ich doch geschaut
Ein Auge, so wie dies, nicht zu ergründen?
Ein Auge war’s, das nie ein Gram betaut,
Ein Blick, wie aus den tiefsten Todesschlünden,
Der, seelenlos die Seele magisch zwang,
Kalt und doch mächtig, Fieber zu entzünden,
Daß ich hinein mich tauchte stundenlang,
Als leucht‘ ein Weltgeheimnis mir entgegen,
Unheimlich, unaussprechlich trüb und bang;
Wie tote Flammen im Smaragd sich regen,
Wie Meeresleuchten aus der Tiefe sprüht,
Goldadern glühn auf unterirdschen Wegen.
Und heute, da ich einsam im Gemüt
Zurückesann, stand mir’s auf einen Schlag
Vor Augen wieder, was mich lang bemüht.
Ich hatt‘ am heißen Frühlingsnachmittag
In Roms Campagna schweifend mich verirrt,
Da ein Gewitter dumpf in Lüften lag.
Kein Schattendach, nicht Herde, Hund und Hirt,
Kein Vogelruf, kein Laut, als der Zikade
Eintönig Ritornell, das heiser schwirrt.
Und ich, erschöpft vom Wandern, wo sich grade
Ein Sitz mir bot, streckt ich die Glieder hin,
Erwartend, daß die Schwüle sich entlade.
Mir war so weltentrückt, so fremd zu Sinn,
So fern von allem Heimlichen und Schönen;
Vergehn und Nichtsein schien allein Gewinn.
Und plötzlich weckte mich ein heftig Dröhnen;
In Flammen lodernd stand das Firmament
Und Sturm fuhr übers öde Feld mit Stöhnen.
Und wie ein neuer Blitz die Wolken trennt,
Seh ich, dicht vor mir, eine braune Schlange
Auf dornumranktem Felsen-Postament.
Geringelt lag sie da – wer sagt, wie lange?
Die grauen Augen traurig und erstaunt
Auf mich geheftet, die geschuppte Wange
Dicht auf den Stein gedrückt, nicht wohlgelaunt,
Doch müde, schien’s, und ohne Mordbegier,
Vielleicht vom Donnerton in Schlaf geraunt.
Und ich blieb still. Der Atem stockte mir;
Ich mußt‘ in dies gefeite Auge schauen,
Und so wohl eine Stunde ruhten wir.
Da erst begann die Wolkennacht zu tauen.
Sacht stand ich auf, Sie aber, regungslos,
Blieb, wo sie war. Ich wandte mich voll Grauen.
Furchtbar vom Himmel rauschte das Getos
Des Lenzorkans. Doch wie die Blitze flammten,
Ich sah im Geist das Schlangenauge bloß.
So, dacht, ich, glühn die Augen der Verdammten,
Die niederfahren aller Hoffnung bar,
Für immer fern dem Licht, dem sie entstammten;
So blickt, Erlösung hoffend immerdar,
Die niedre Kreatur mit stummem Flehen,
Der eine Seele nicht erschaffen war.
Und erst bei milder Herbsteslüfte Wehn,
Sooft auch früher ein Gelüst sich regte,
Könnt‘ ich hinaus, die Stätte wiedersehn.
Ich fand den Ort, wo ich mich niederlegte,
Und – wundersam! da ruhte noch das Tier,
Das Auge offen, das sich nicht bewegte.
Mich faßt‘ ein Schauer. Hat die Feindin hier
Gelauert sommerlang, mich doch zu fassen?
Und wieder Aug‘ in Auge staunten wir.
Und feige schien mir’s, ihr das Feld zu lassen.
Ich schlug nach ihr; da fielen ihre Ringe
In Staub. Nur aus dem Auge, das gelassen
Ins Leere stierte, war mir’s, als entschwinge
Sich ein gefangner Blitz. Da ließ ich sie,
Daß sie nicht noch im Tode mich bezwinge:
Doch ihren Scheideblick vergaß ich nie.