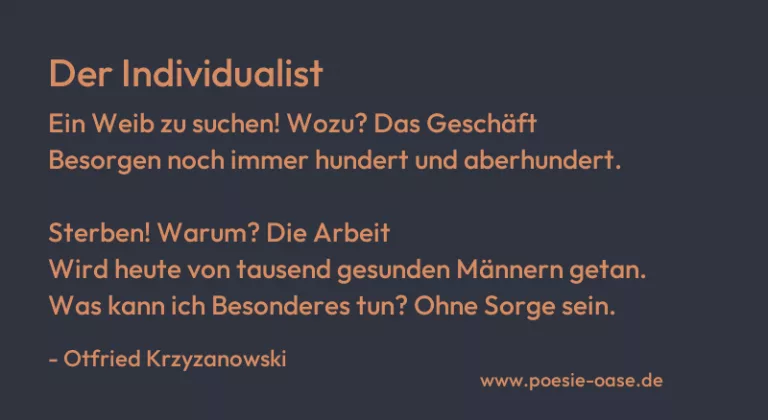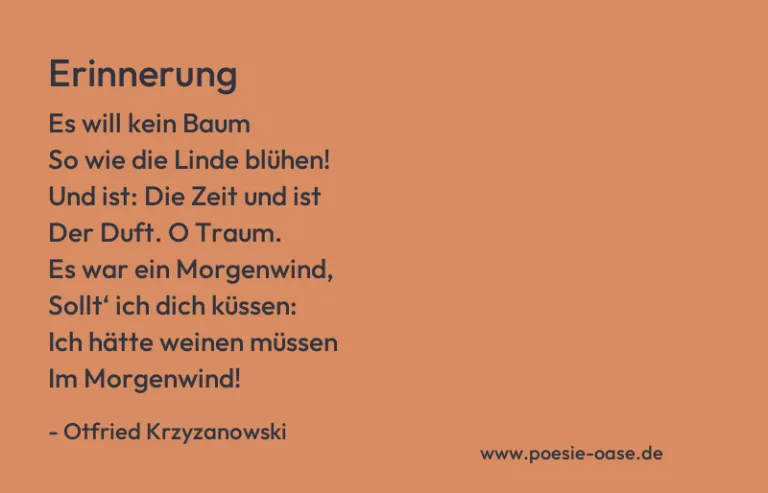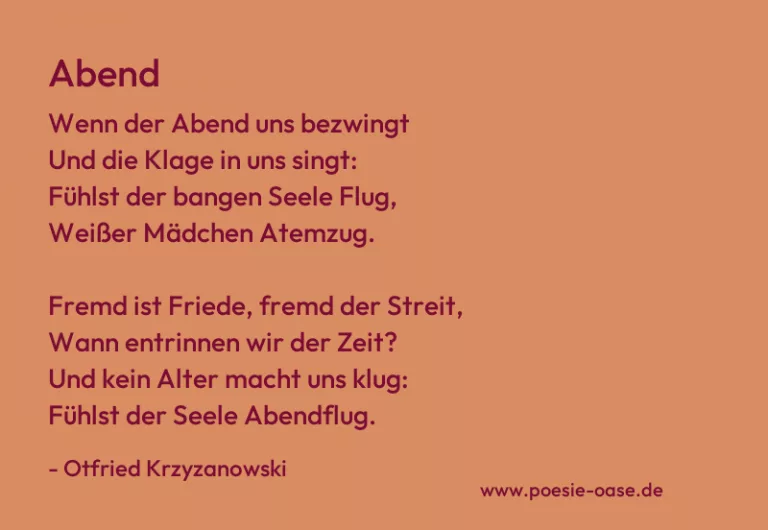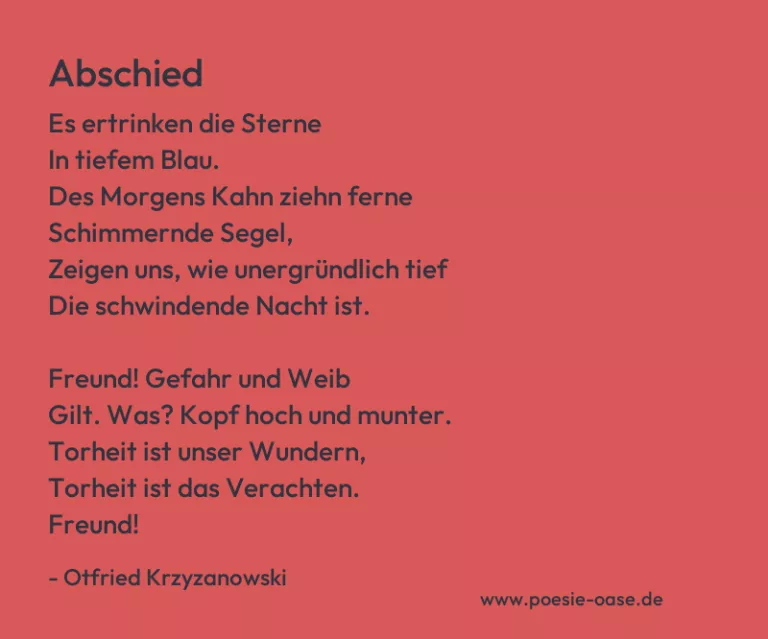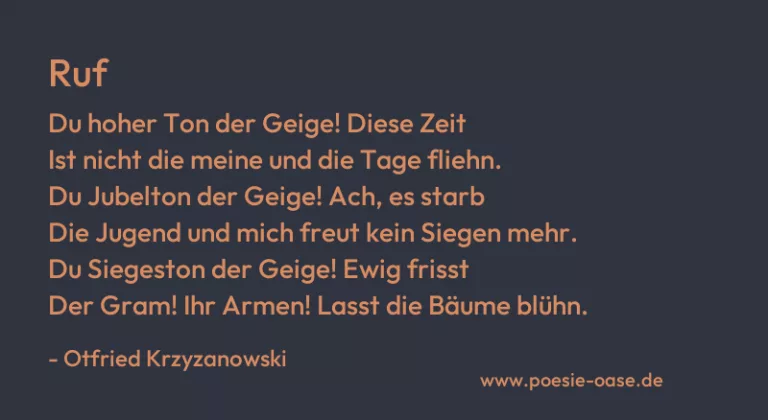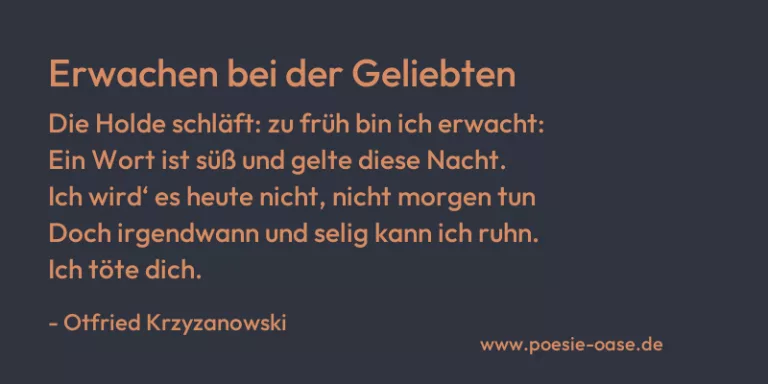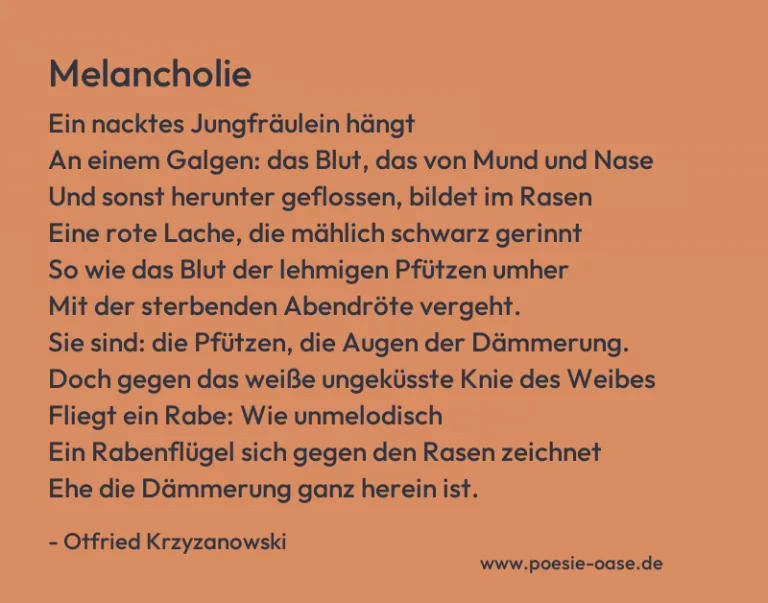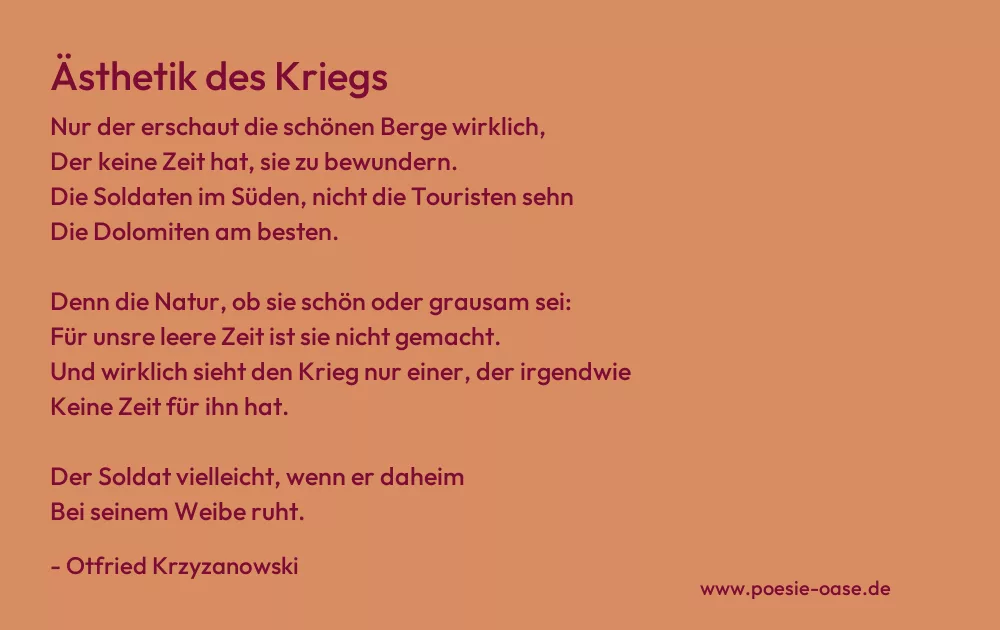Ästhetik des Kriegs
Nur der erschaut die schönen Berge wirklich,
Der keine Zeit hat, sie zu bewundern.
Die Soldaten im Süden, nicht die Touristen sehn
Die Dolomiten am besten.
Denn die Natur, ob sie schön oder grausam sei:
Für unsre leere Zeit ist sie nicht gemacht.
Und wirklich sieht den Krieg nur einer, der irgendwie
Keine Zeit für ihn hat.
Der Soldat vielleicht, wenn er daheim
Bei seinem Weibe ruht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
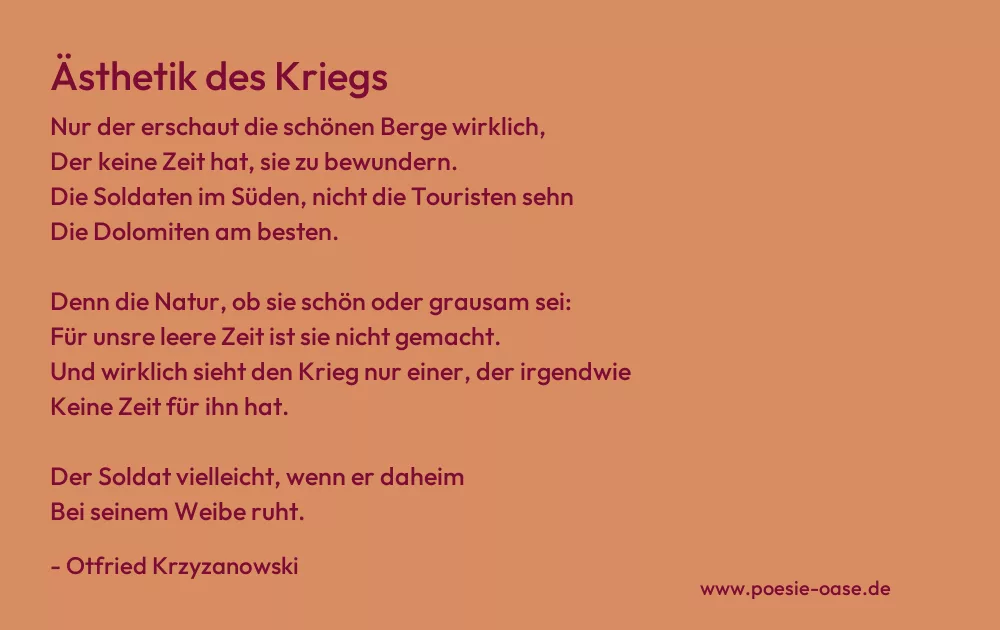
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ästhetik des Kriegs“ von Otfried Krzyzanowski beschäftigt sich auf subtile Weise mit der Wahrnehmung von Krieg, Natur und der Bedeutung des Moments. Die erste Zeile, „Nur der erschaut die schönen Berge wirklich, / Der keine Zeit hat, sie zu bewundern“, legt den Fokus auf eine paradoxe Perspektive. Die „schönen Berge“ können hier als Symbol für die unberührte, authentische Natur verstanden werden, die nicht in einem Zustand des bloßen Staunens oder der bewussten Bewunderung wahrgenommen wird. Derjenige, der keine Zeit hat, die Berge zu bewundern – wie der Soldat im Krieg – wird derjenige sein, der sie „wirklich“ sieht, da er sie nicht mit einem ästhetischen Blick, sondern mit einem pragmatischen, existenziellen Blick betrachtet.
Die Zeilen „Die Soldaten im Süden, nicht die Touristen sehn / Die Dolomiten am besten“ verdeutlichen diesen Gedanken weiter. Der Soldat, der in einer Situation des Überlebens und des ständigen Einsatzes lebt, nimmt die Natur nicht als etwas Trennendes oder als Erholung wahr. Er sieht die „Dolomiten“ nicht im Rahmen einer touristischen Perspektive, sondern im Kontext seines Handelns und seiner Mission, was die Wahrnehmung der Natur auf eine existenzielle Ebene hebt. Die „Touristen“ hingegen erleben die Berge in einer ästhetischen, distanzierten Weise, die ihre Authentizität und tiefere Bedeutung nicht erfasst.
Der Vers „Denn die Natur, ob sie schön oder grausam sei: / Für unsre leere Zeit ist sie nicht gemacht“ lenkt den Blick auf die Diskrepanz zwischen der tieferen Bedeutung der Natur und der „leeren Zeit“, die der Mensch in einer konsumorientierten Gesellschaft lebt. Die Natur, ob in ihrer Schönheit oder Grausamkeit, wird als unabhängig von menschlichen Maßstäben dargestellt. Sie ist nicht „für unsre leere Zeit gemacht“, was die Idee unterstreicht, dass der Mensch die Natur nur dann wirklich verstehen kann, wenn er sich von der Illusion der Freizeit und der ästhetischen Distanz befreit und sich in eine authentische, existentielle Beziehung zu ihr begibt – wie es der Soldat tut.
Die letzte Zeile, „Der Soldat vielleicht, wenn er daheim / Bei seinem Weibe ruht“, bringt das Gedicht zu einem persönlichen und gleichzeitig universellen Punkt. Der Soldat, der die Natur nicht in ihrer Schönheit bewundern kann, sondern sie als Teil eines existenziellen Erlebens wahrnimmt, findet vielleicht in der Ruhe zu Hause bei seiner Frau einen Moment der Reflexion und des Friedens. Diese Ruhe und der Rückzug in das Private zeigen, dass es in der äußeren, kämpferischen Welt und im Krieg keine Zeit für ästhetische Wahrnehmung gibt. Erst in der Intimität und im persönlichen Rückzugsort, fern von der Gewalt und den Anforderungen des Krieges, ist der Soldat möglicherweise in der Lage, eine wahre Wahrnehmung des Lebens und der Welt zu erfahren.
Krzyzanowski zeigt mit diesem Gedicht die Absurdität und den Verlust von Schönheit in einer Welt, die von Krieg und Not geprägt ist. Die Ästhetik des Krieges wird nicht durch das Verweilen in der Natur oder das Staunen über deren Schönheit erfahren, sondern durch das Handeln und das Überleben in einer chaotischen, existenziellen Realität.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.