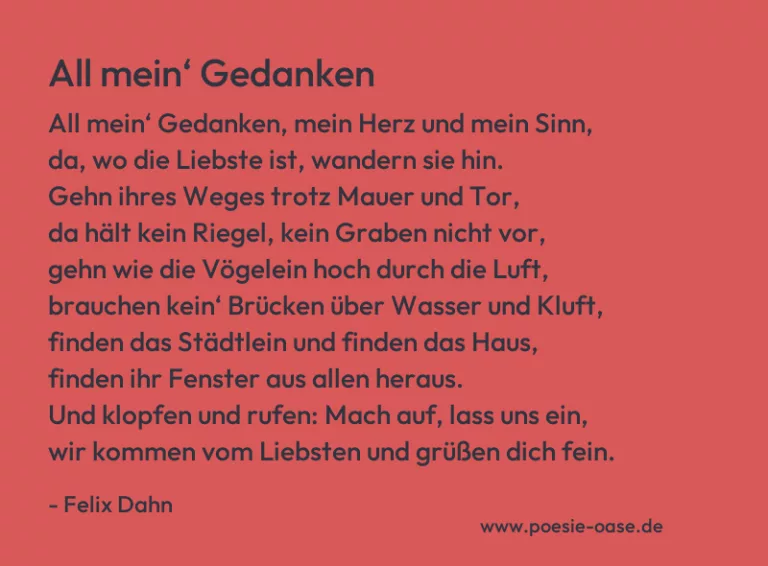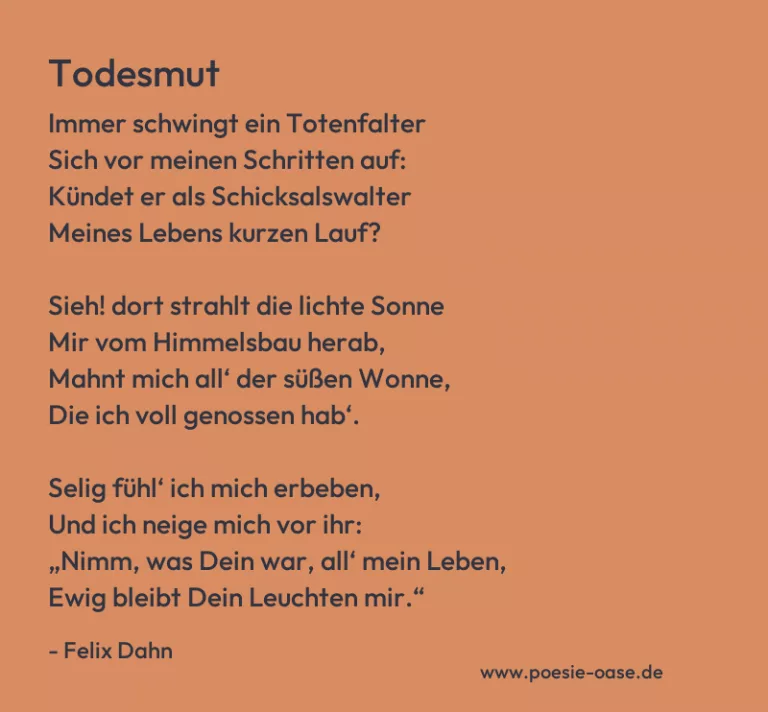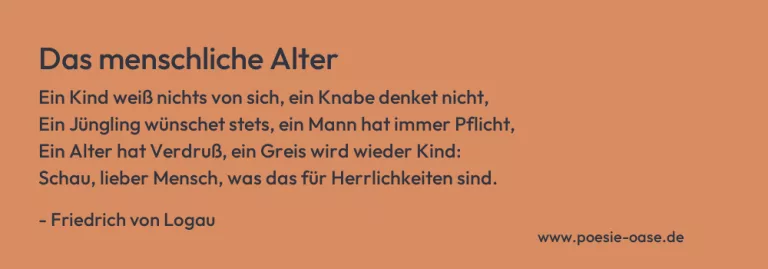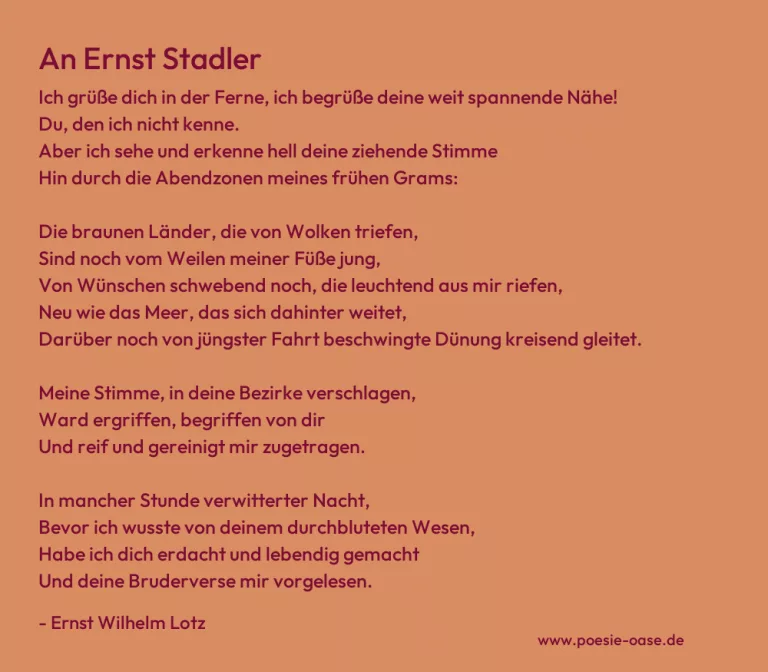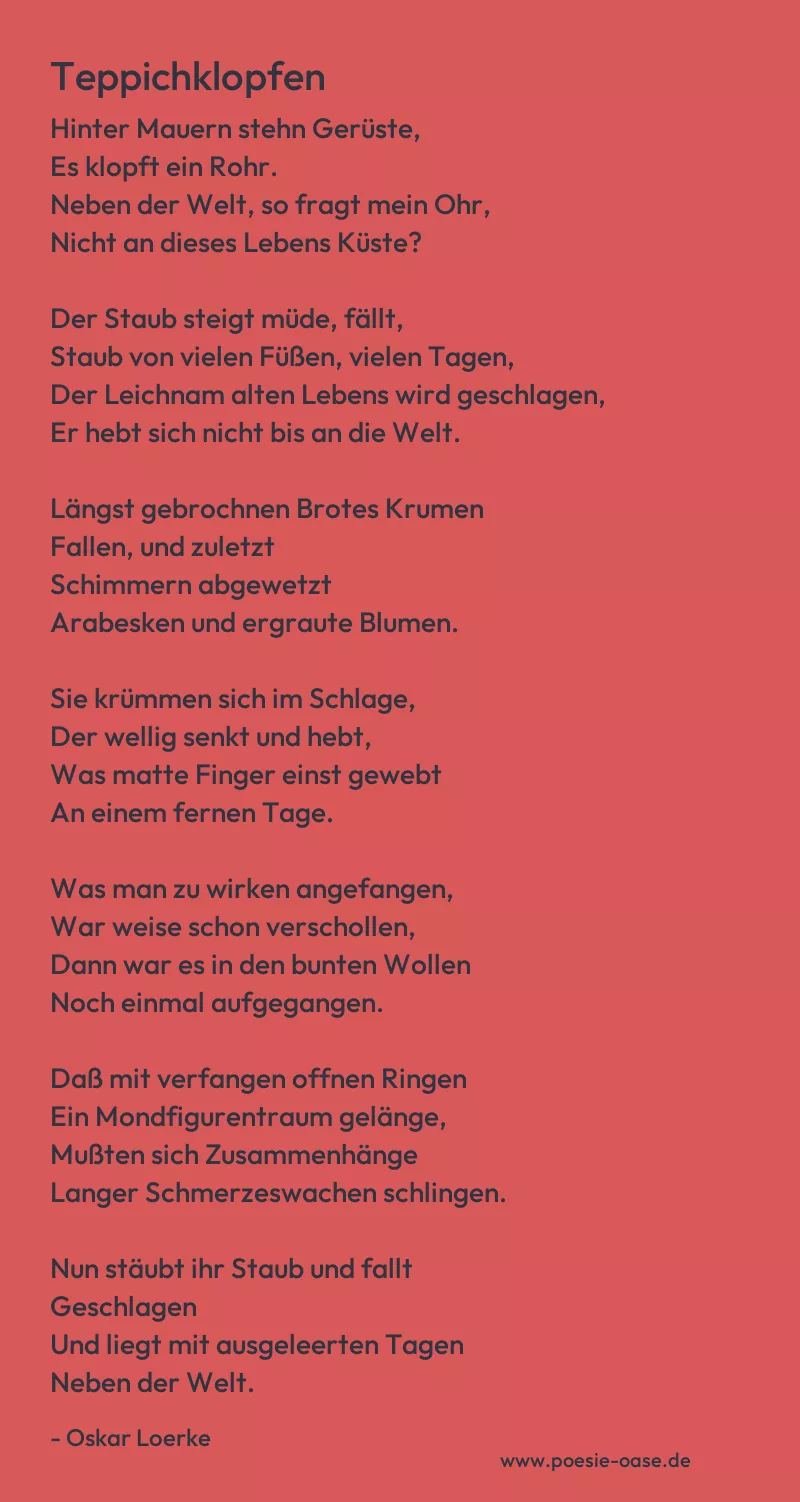Teppichklopfen
Hinter Mauern stehn Gerüste,
Es klopft ein Rohr.
Neben der Welt, so fragt mein Ohr,
Nicht an dieses Lebens Küste?
Der Staub steigt müde, fällt,
Staub von vielen Füßen, vielen Tagen,
Der Leichnam alten Lebens wird geschlagen,
Er hebt sich nicht bis an die Welt.
Längst gebrochnen Brotes Krumen
Fallen, und zuletzt
Schimmern abgewetzt
Arabesken und ergraute Blumen.
Sie krümmen sich im Schlage,
Der wellig senkt und hebt,
Was matte Finger einst gewebt
An einem fernen Tage.
Was man zu wirken angefangen,
War weise schon verschollen,
Dann war es in den bunten Wollen
Noch einmal aufgegangen.
Daß mit verfangen offnen Ringen
Ein Mondfigurentraum gelänge,
Mußten sich Zusammenhänge
Langer Schmerzeswachen schlingen.
Nun stäubt ihr Staub und fallt
Geschlagen
Und liegt mit ausgeleerten Tagen
Neben der Welt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
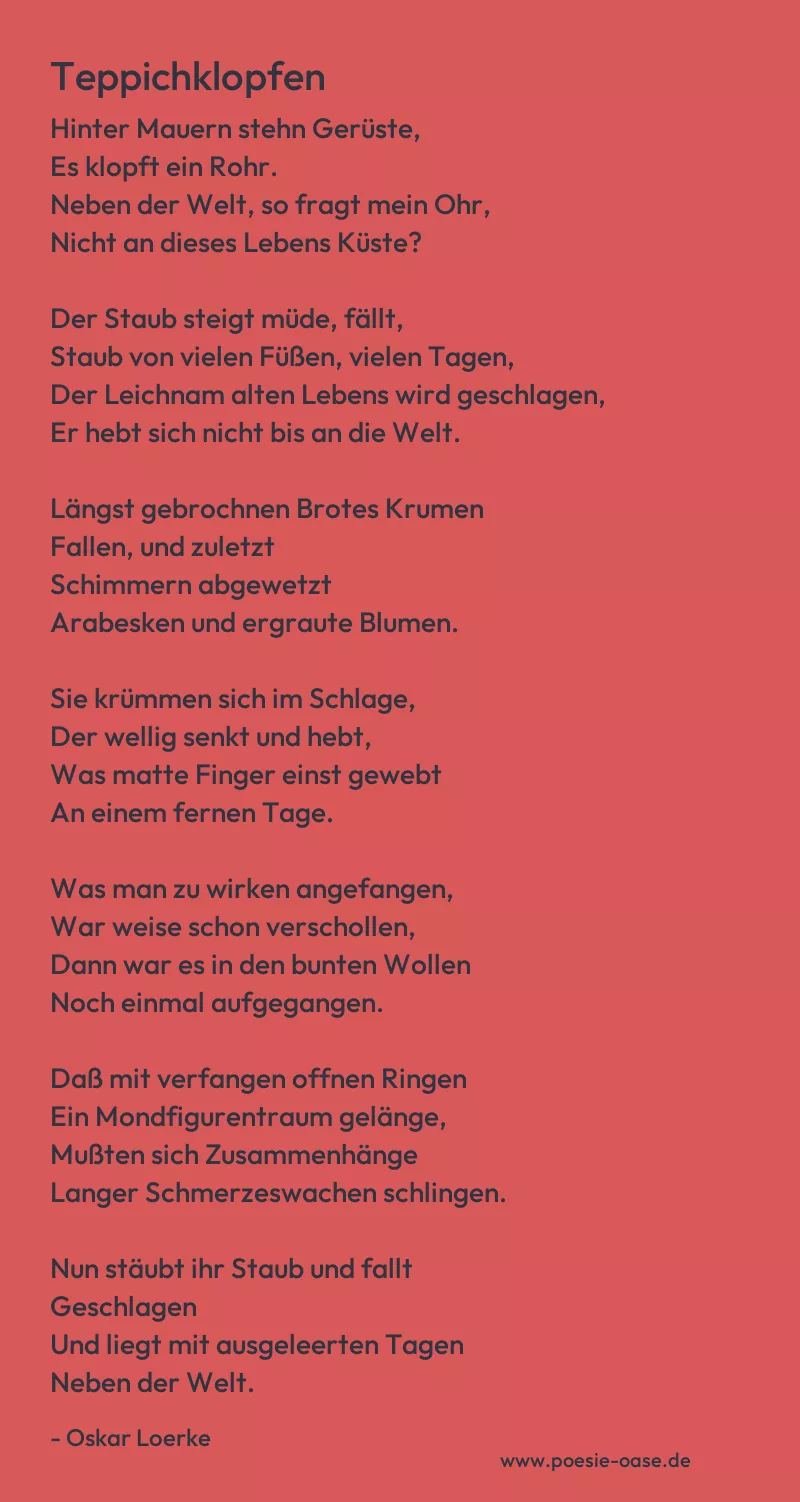
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Teppichklopfen“ von Oskar Loerke nutzt die Metapher des Teppichklopfens, um die Themen von Vergänglichkeit, Erinnerung und der schweren Last vergangener Zeiten zu behandeln. Zu Beginn des Gedichts wird ein Bild von „Gerüsten“ hinter Mauern gezeichnet, was auf den Aufbau und die Zerstörung von Strukturen hinweist. Das „Rohr“, das klopft, verstärkt das Bild der Unruhe und des fortwährenden Umbaus, während die Frage „Nicht an dieses Lebens Küste?“ das Gefühl der Entfremdung und der Distanz zum eigenen Leben und der gegenwärtigen Welt widerspiegelt. Das Gedicht ist von einer Atmosphäre der Isolation geprägt, in der das Ohr des Erzählers vergeblich nach einer Verbindung zur Welt sucht.
Im zweiten Teil des Gedichts wird das Bild des „Staubs“ weiterentwickelt, der „müde“ steigt und „fällt“. Dieser Staub ist ein Symbol für das Vergehen von Zeit und Leben, die von den „vielen Füßen, vielen Tagen“ hinterlassen werden. Der „Leichnam alten Lebens“ wird „geschlagen“, was auf eine Form der Reinigung oder Zerstörung hinweist, doch der „Leichnam“ erhebt sich nicht und bleibt „nicht bis an die Welt“. Diese Szene verdeutlicht die Unerbittlichkeit der Vergänglichkeit und die vergebliche Anstrengung, das Vergangene wiederzubeleben oder zu bewahren.
Das Bild von „gebrochenem Brot“ und „abgewetzten Arabesken“ verstärkt das Thema des Verfalls und der Verlorenheit. Die „Krumen“ des Brotes fallen, was als Metapher für das Zerbröckeln von Lebenswerken oder Erinnerungen interpretiert werden kann. Die „Arabesken und ergrauten Blumen“ sind Zeichen der Vergänglichkeit und des Verblassens von Schönheit und Bedeutung. Diese Bilder deuten darauf hin, dass, was einmal von Bedeutung war, nun nur noch als verblasste Erinnerung existiert, die sich im Staub auflöst.
In den nächsten Versen wird die Vorstellung entwickelt, dass das, was einst „gewebt“ wurde – möglicherweise ein Traum, ein Plan oder eine Vision – nun in den „Schlägen“ der Zeit verloren geht. Der „ferne Tag“, an dem das Gewebe erschaffen wurde, ist längst vergangen, und das, was „zu wirken angefangen“ wurde, scheint „verschollen“. Doch dann taucht die Vorstellung auf, dass diese Dinge in den „bunten Wollen“ erneut aufleben, was die Möglichkeit einer Wiederbelebung oder eines neuen Versuchs, das Vergangene zu erfassen, andeutet. Doch auch hier bleibt der Erfolg fraglich, da der „Mondfigurentraum“ und das Verfangen von „offnen Ringen“ in „langen Schmerzeswachen“ schließlich nur eine weitere Manifestation von Leid und Enttäuschung sind.
Das Gedicht endet mit dem Bild des Staubs, der erneut „stäubt“ und „fällt“. Der „Staub“ steht hier für das endgültige Verschwinden und die Ernüchterung. Die Dinge sind „geschlagen“ und „liegen mit ausgeleerten Tagen neben der Welt“. Diese Worte suggerieren das Ende einer Ära, das Versagen von Bemühungen und die Unvermeidlichkeit des Verfalls. Loerke beschreibt eine Welt, in der alles, was geschaffen wurde, letztlich im Staub der Zeit untergeht – ein düsteres Bild der Vergänglichkeit und der vergeblichen Anstrengung, das, was einmal war, zu bewahren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.