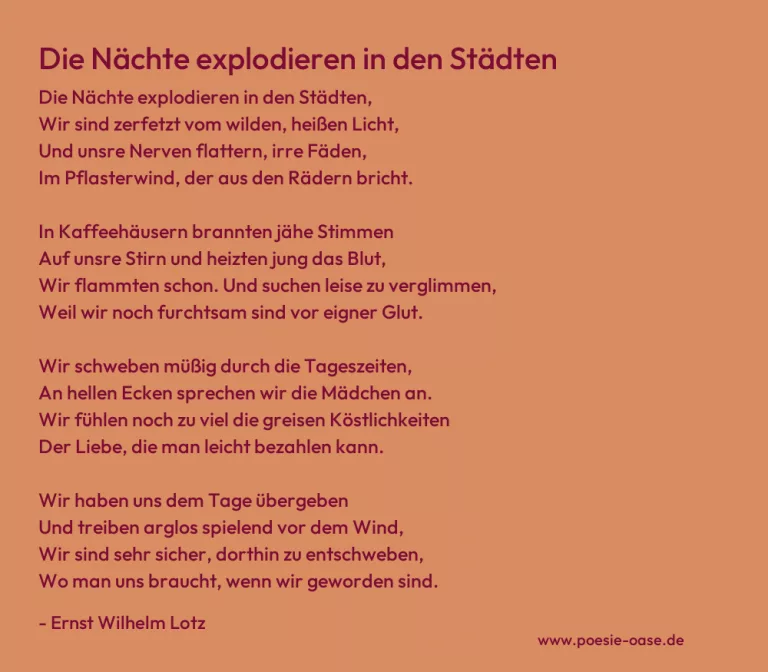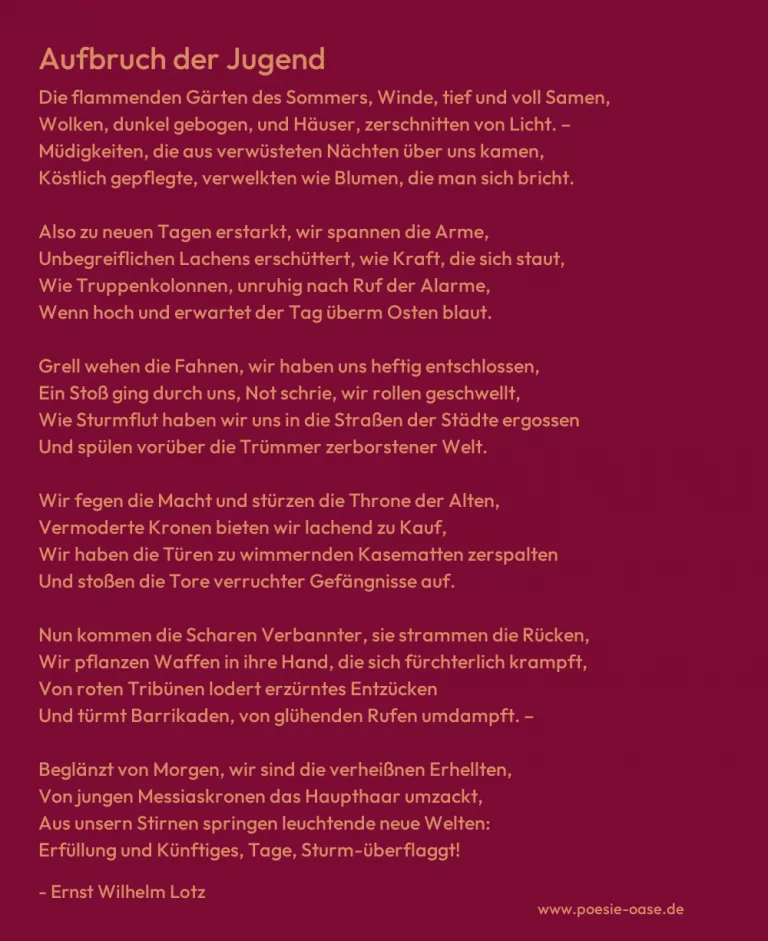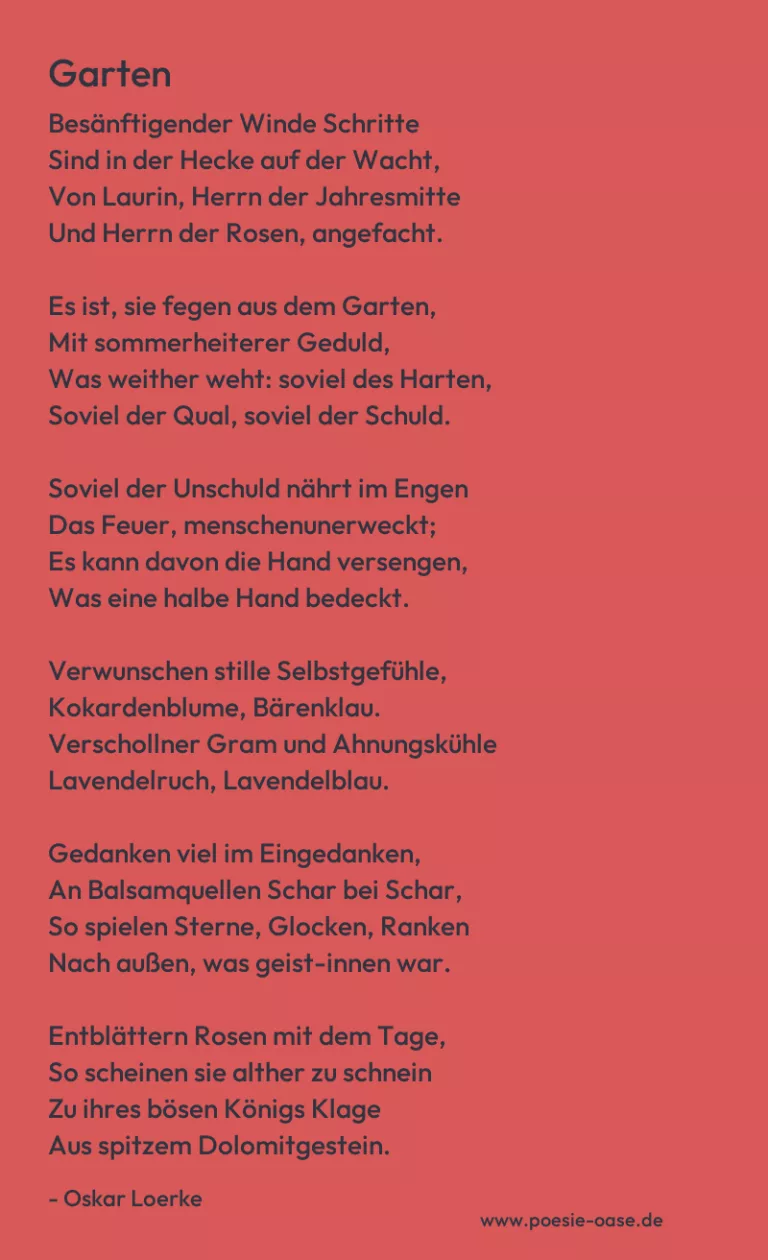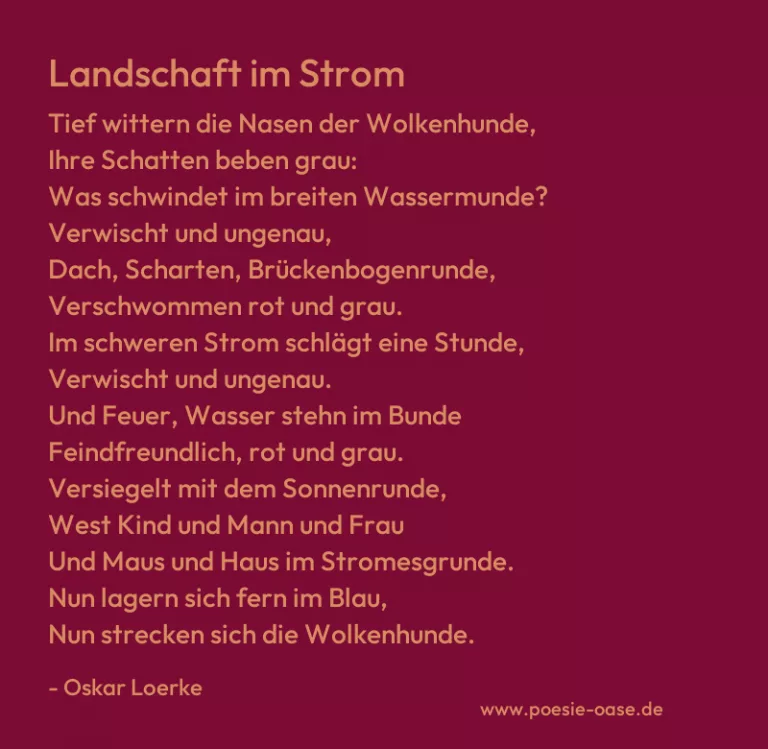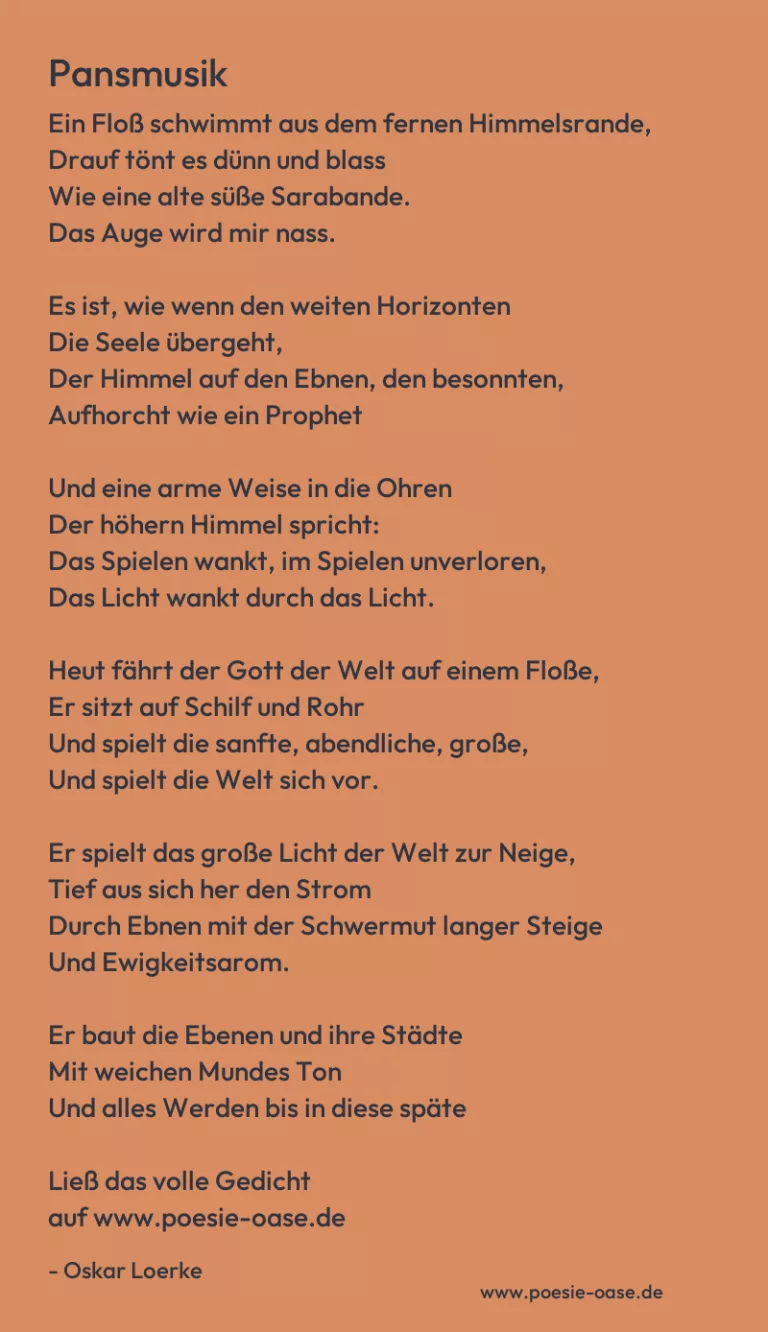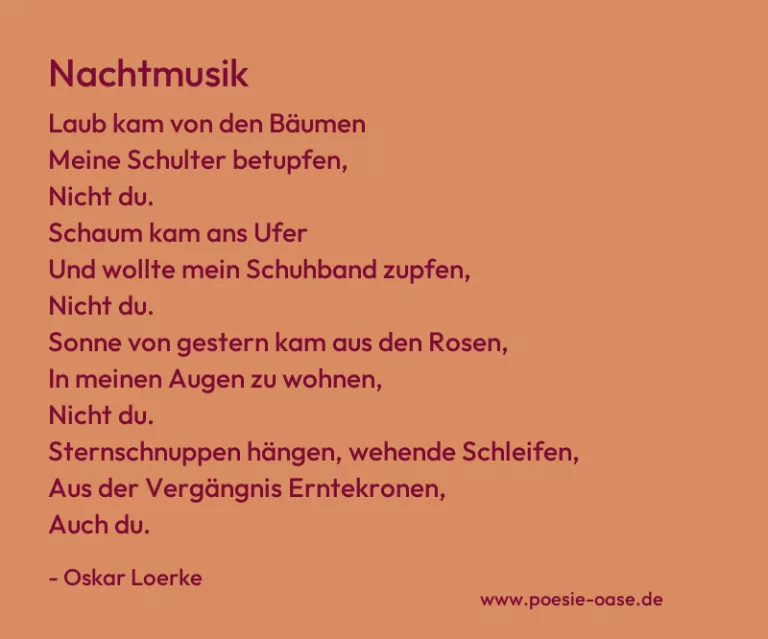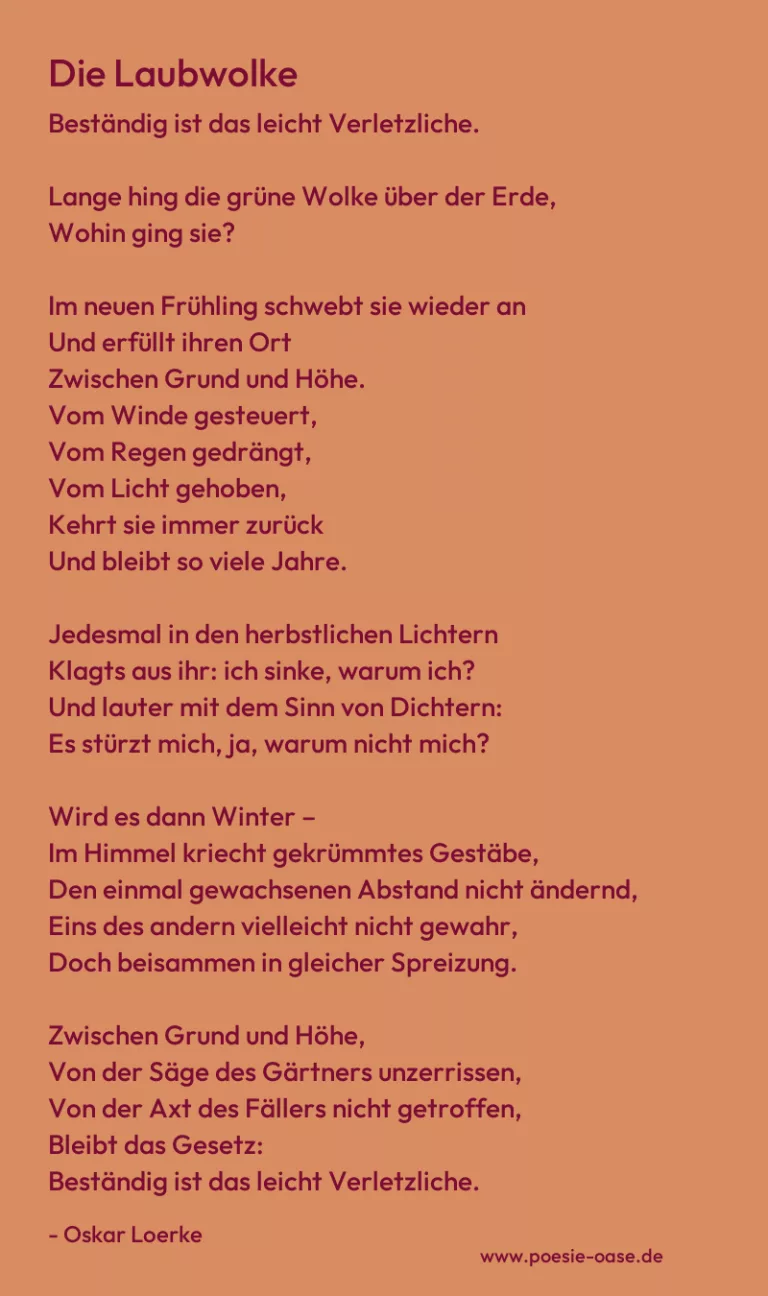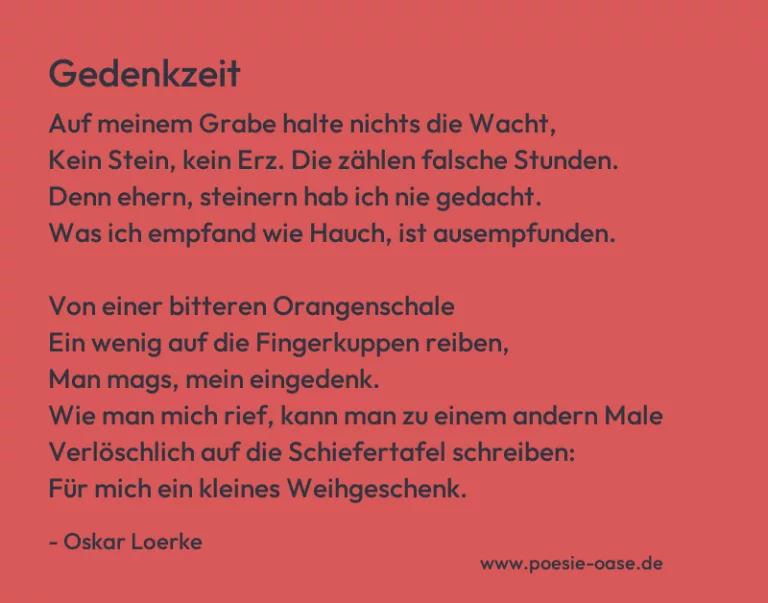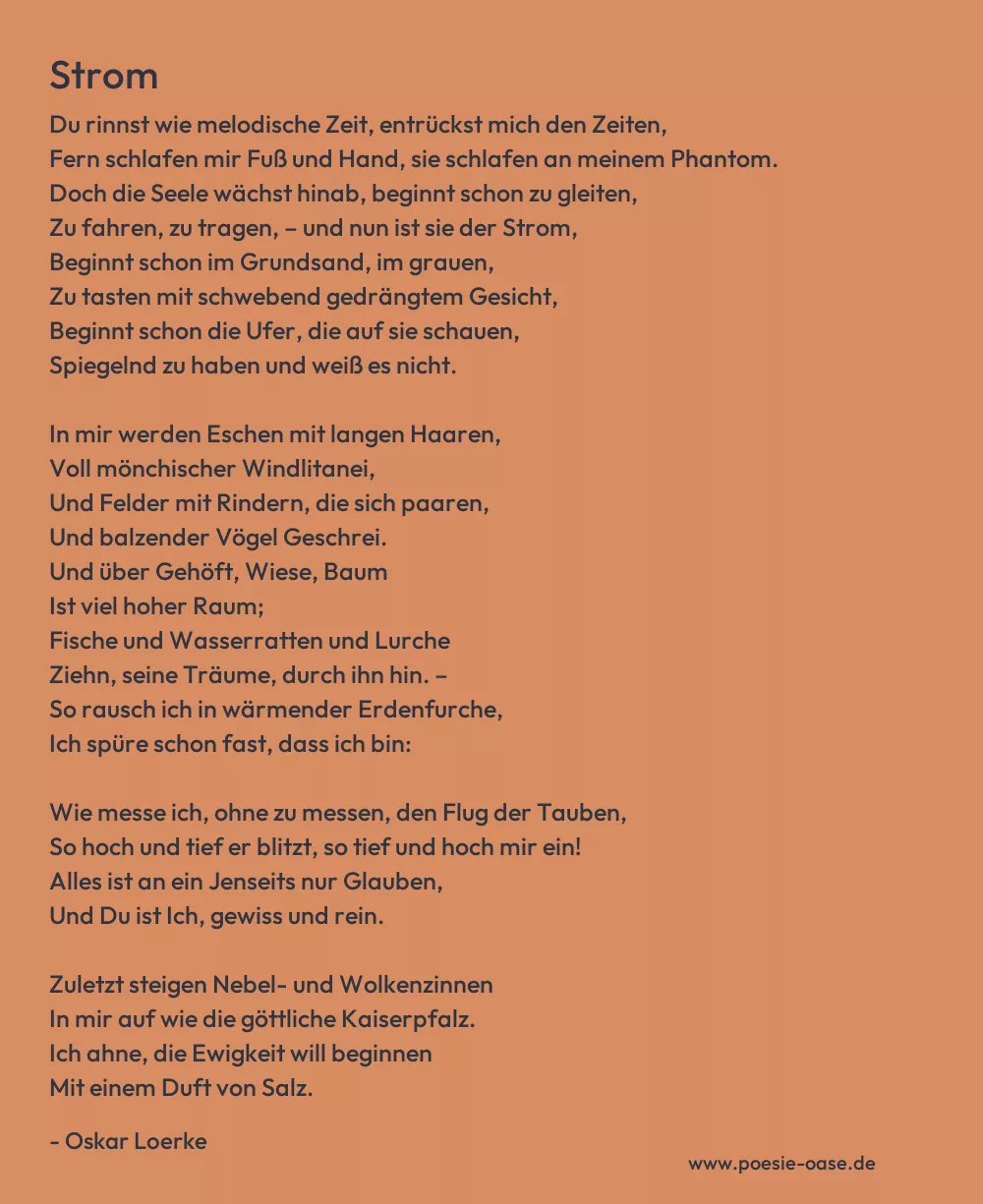Alltag, Flüsse & Meere, Gedanken, Gemeinfrei, Glaube & Spiritualität, Herbst, Leichtigkeit, Leidenschaft, Liebe & Romantik, Mythen & Legenden, Natur, Universum
Strom
Du rinnst wie melodische Zeit, entrückst mich den Zeiten,
Fern schlafen mir Fuß und Hand, sie schlafen an meinem Phantom.
Doch die Seele wächst hinab, beginnt schon zu gleiten,
Zu fahren, zu tragen, – und nun ist sie der Strom,
Beginnt schon im Grundsand, im grauen,
Zu tasten mit schwebend gedrängtem Gesicht,
Beginnt schon die Ufer, die auf sie schauen,
Spiegelnd zu haben und weiß es nicht.
In mir werden Eschen mit langen Haaren,
Voll mönchischer Windlitanei,
Und Felder mit Rindern, die sich paaren,
Und balzender Vögel Geschrei.
Und über Gehöft, Wiese, Baum
Ist viel hoher Raum;
Fische und Wasserratten und Lurche
Ziehn, seine Träume, durch ihn hin. –
So rausch ich in wärmender Erdenfurche,
Ich spüre schon fast, dass ich bin:
Wie messe ich, ohne zu messen, den Flug der Tauben,
So hoch und tief er blitzt, so tief und hoch mir ein!
Alles ist an ein Jenseits nur Glauben,
Und Du ist Ich, gewiss und rein.
Zuletzt steigen Nebel- und Wolkenzinnen
In mir auf wie die göttliche Kaiserpfalz.
Ich ahne, die Ewigkeit will beginnen
Mit einem Duft von Salz.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
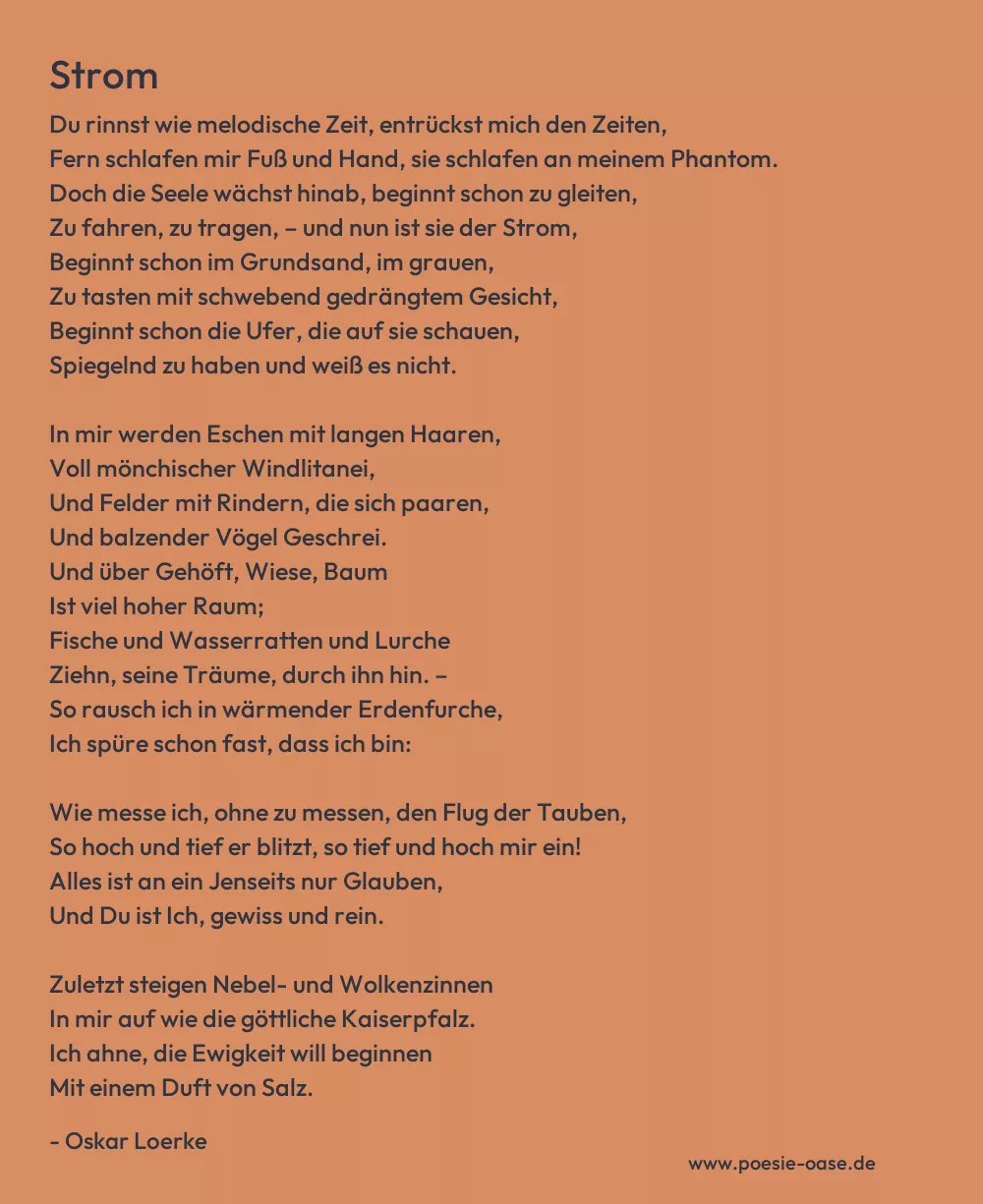
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Strom“ von Oskar Loerke ist eine poetische Reise in die Tiefe des eigenen Seins, das sich mit der Zeit und der Natur verbindet. Zu Beginn wird das Bild des Fließens als Metapher für die „melodische Zeit“ genutzt. Der Erzähler wird durch den Strom von der äußeren Welt, symbolisiert durch „Fuß und Hand“, entrückt, während die „Seele“ zu wachsen und sich mit dem Strom zu verbinden beginnt. Diese Transformation ist nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch: Die „Seele“ wird selbst zum „Strom“, der „im Grundsand“ tastend und schwebend beginnt, die „Ufer“ zu erreichen, ohne sich ihrer Bedeutung vollständig bewusst zu sein. Der Strom wird hier als Metapher für den Fluss des Lebens und der inneren Entwicklung verstanden, der sich ohne das vollständige Verständnis seines eigenen Weges entfaltet.
In der zweiten Strophe expandiert das Bild des Stroms zu einer vielschichtigen Naturvision, in der „Eschen mit langen Haaren“ und „Felder mit Rindern“ auftauchen. Diese Elemente, zusammen mit dem „balzenden Geschrei der Vögel“, schaffen ein lebendiges, pulsierendes Bild der Natur, das durch den Fluss des Lebens verbunden ist. Die „hohen Raum“ und die Tiere, die durch das Bild ziehen, symbolisieren die Vielzahl an Eindrücken und Erfahrungen, die der Mensch in seinem inneren „Strom“ mit sich trägt. Dieser natürliche Verlauf, der durch „Erdenfurche“ rauschend in die Tiefe geht, stellt das Bild eines Lebens dar, das in ständiger Bewegung ist und sich mit allem verbindet, was um ihn herum existiert.
In der dritten Strophe wird das Bild des Stroms noch philosophischer und abstrakter. Die Frage „Wie messe ich, ohne zu messen, den Flug der Tauben?“ verweist auf die Schwierigkeit, das Unfassbare und Unmessbare zu begreifen, was auch die Unberechenbarkeit des Lebens und der Zeit widerspiegelt. Der Erzähler erkennt, dass alles nur an ein „Jenseits“ geglaubt werden kann und dass er selbst und das, was ihn umgibt, untrennbar miteinander verbunden sind – „Du ist Ich, gewiss und rein“. Dies deutet auf eine mystische Verschmelzung von Individuum und Universum hin, in der das Selbst und die Welt eins werden.
Die letzte Strophe schließt das Gedicht mit einer visionären und spirituellen Perspektive ab. Der „Nebel- und Wolkenzinnen“, die „in mir aufsteigen“, schaffen das Bild einer transzendenten, fast göttlichen Erhebung. Die „göttliche Kaiserpfalz“ steht als Symbol für eine höhere spirituelle Ebene, die der Erzähler zu erreichen scheint. Das „Duft von Salz“ verweist auf das Element des Lebens, das das Unendliche und die Ewigkeit symbolisieren könnte. Das Gedicht endet somit mit einem Gefühl der Erhebung, des Übergangs und der Annäherung an das Unendliche, das durch den Strom des Lebens, der Zeit und der spirituellen Erfahrung führt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.