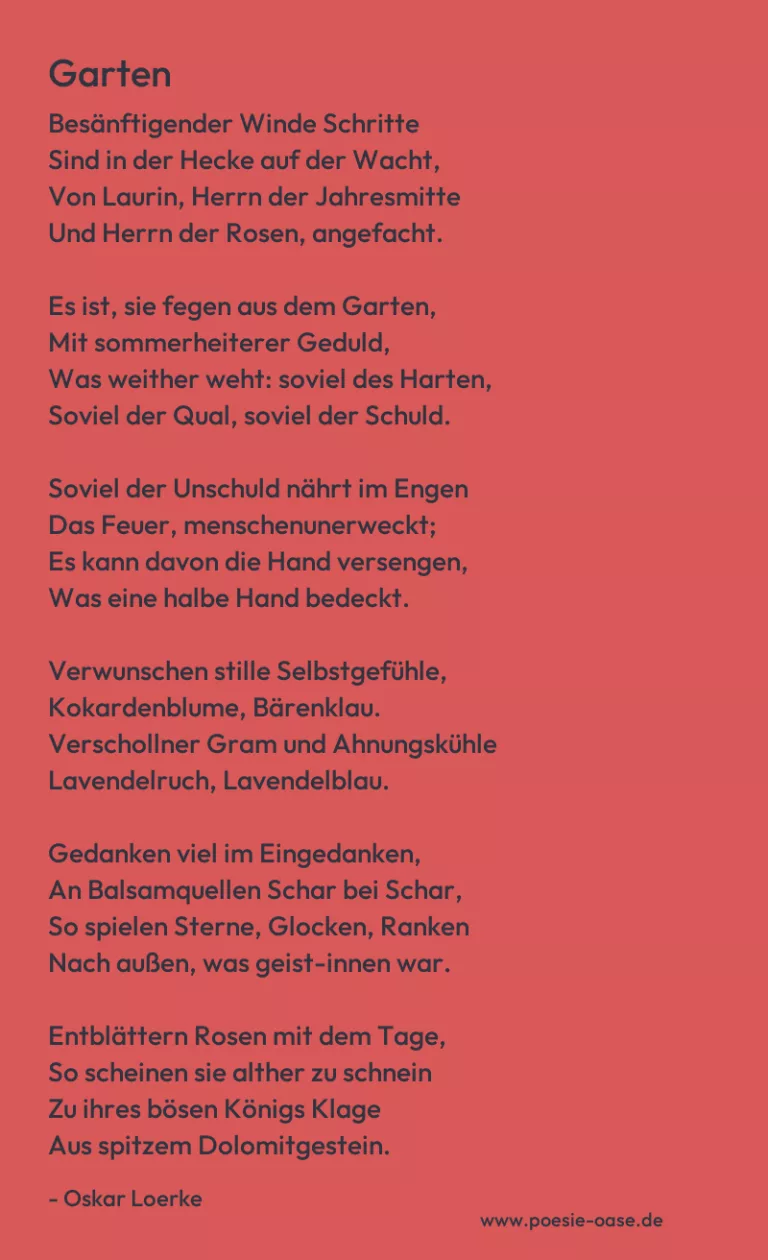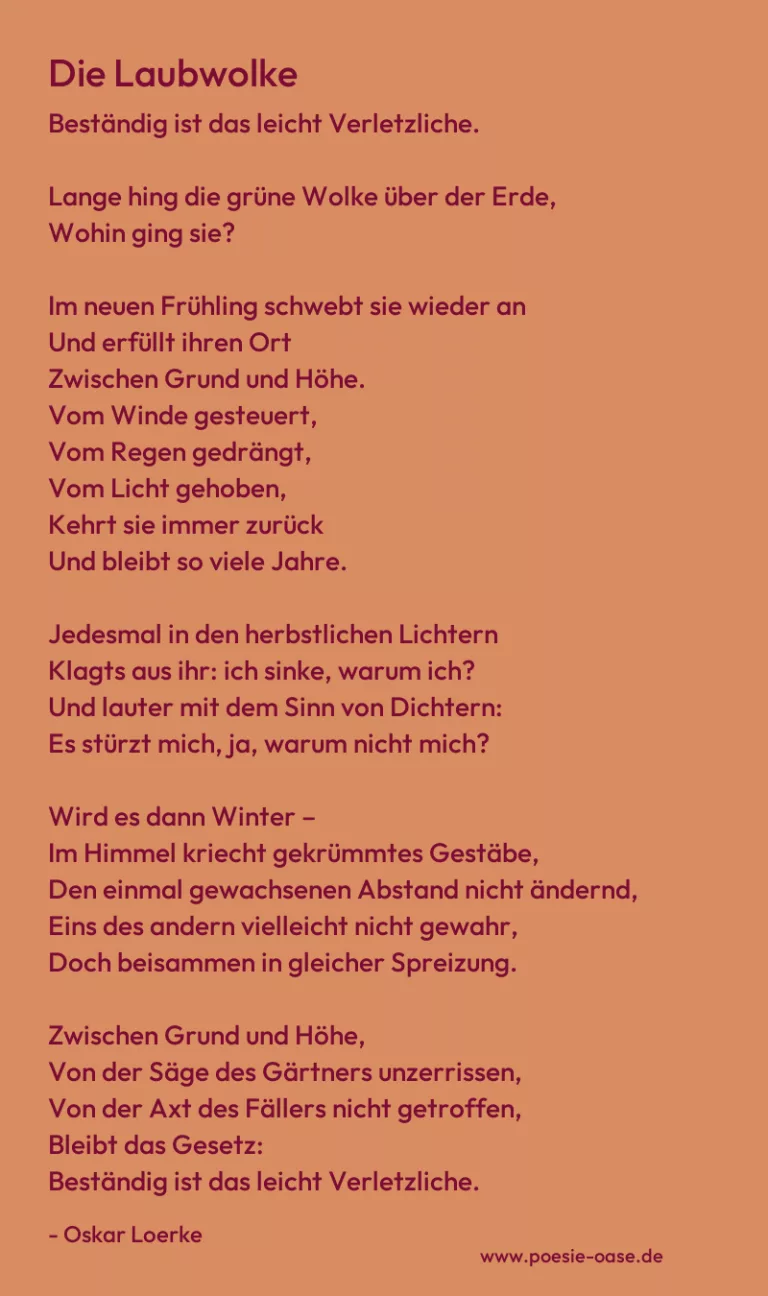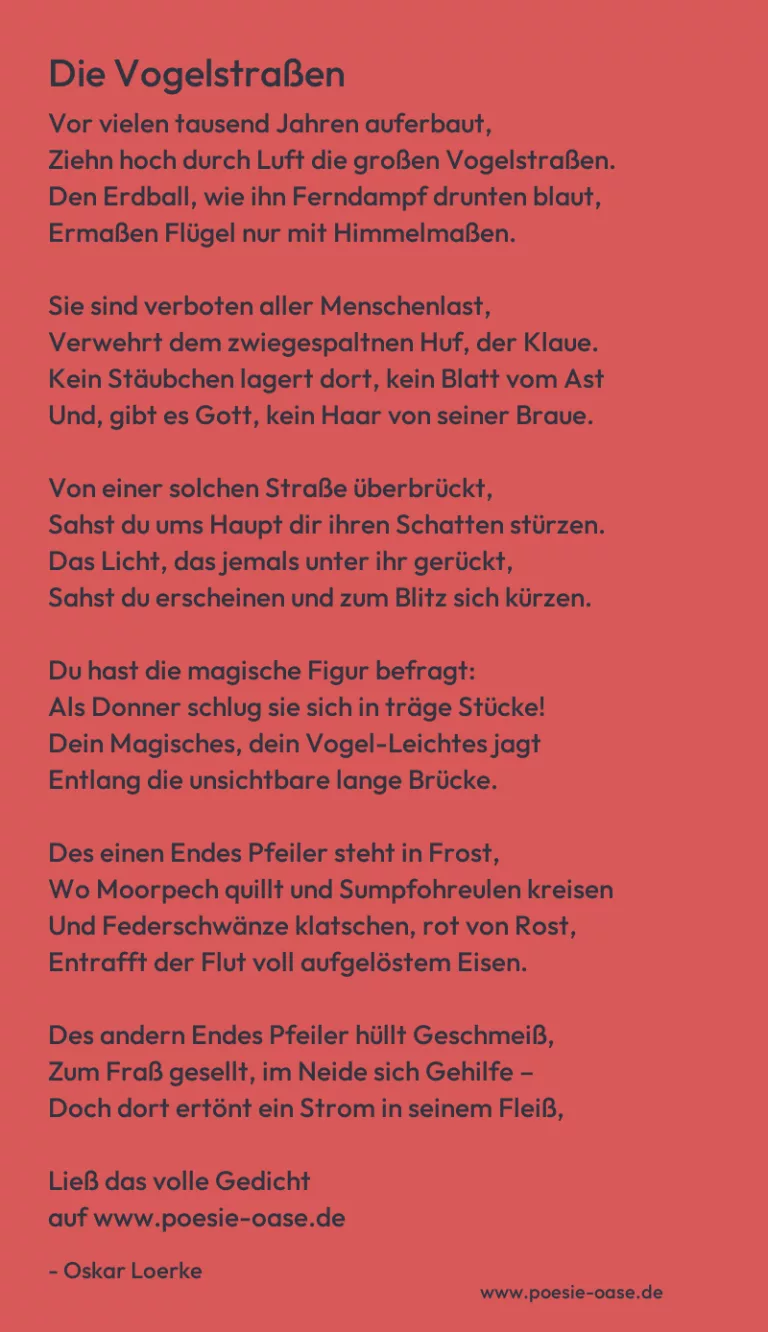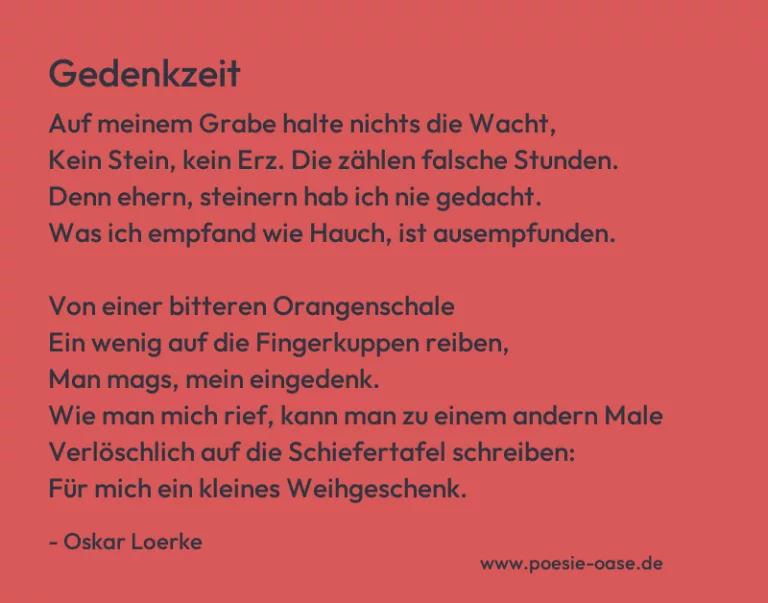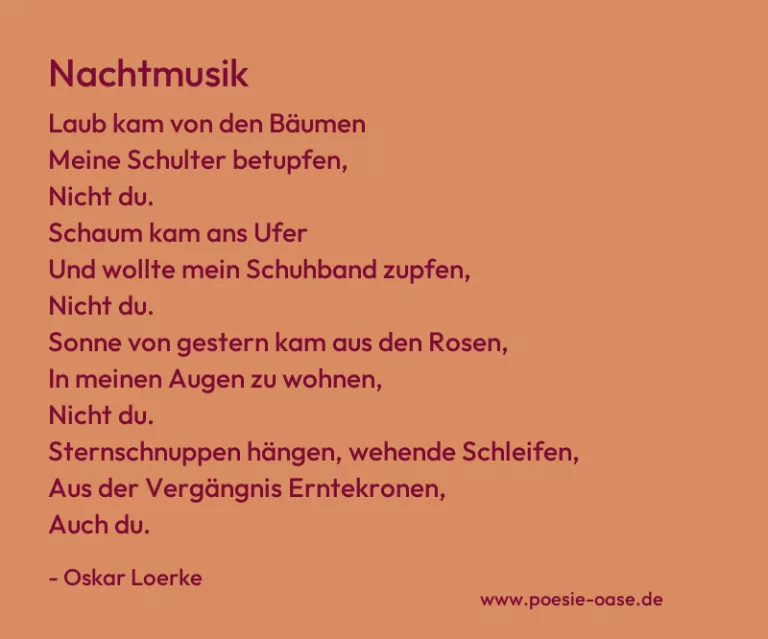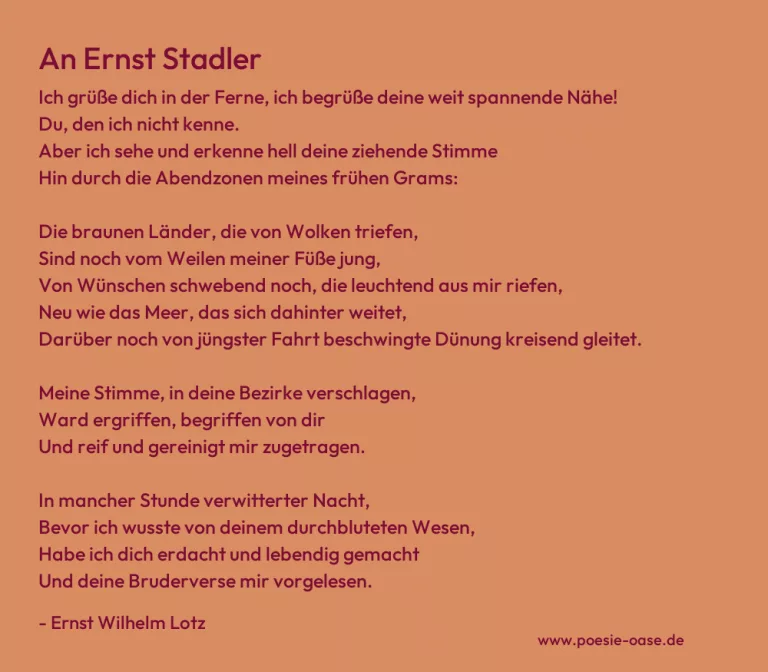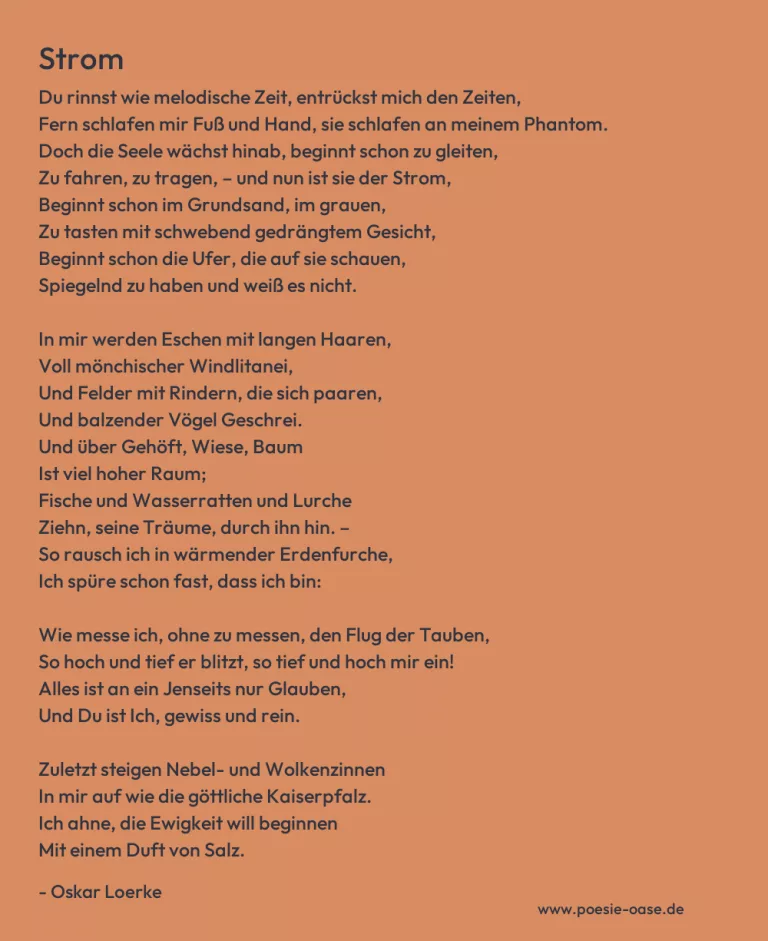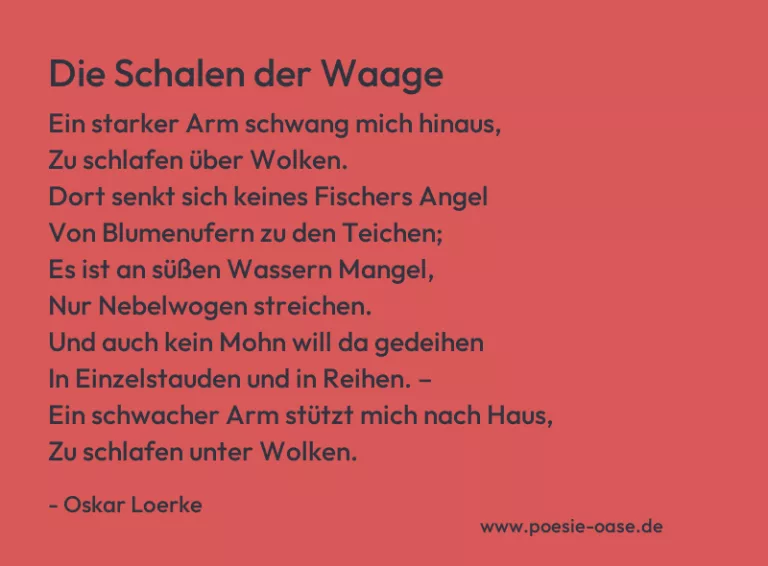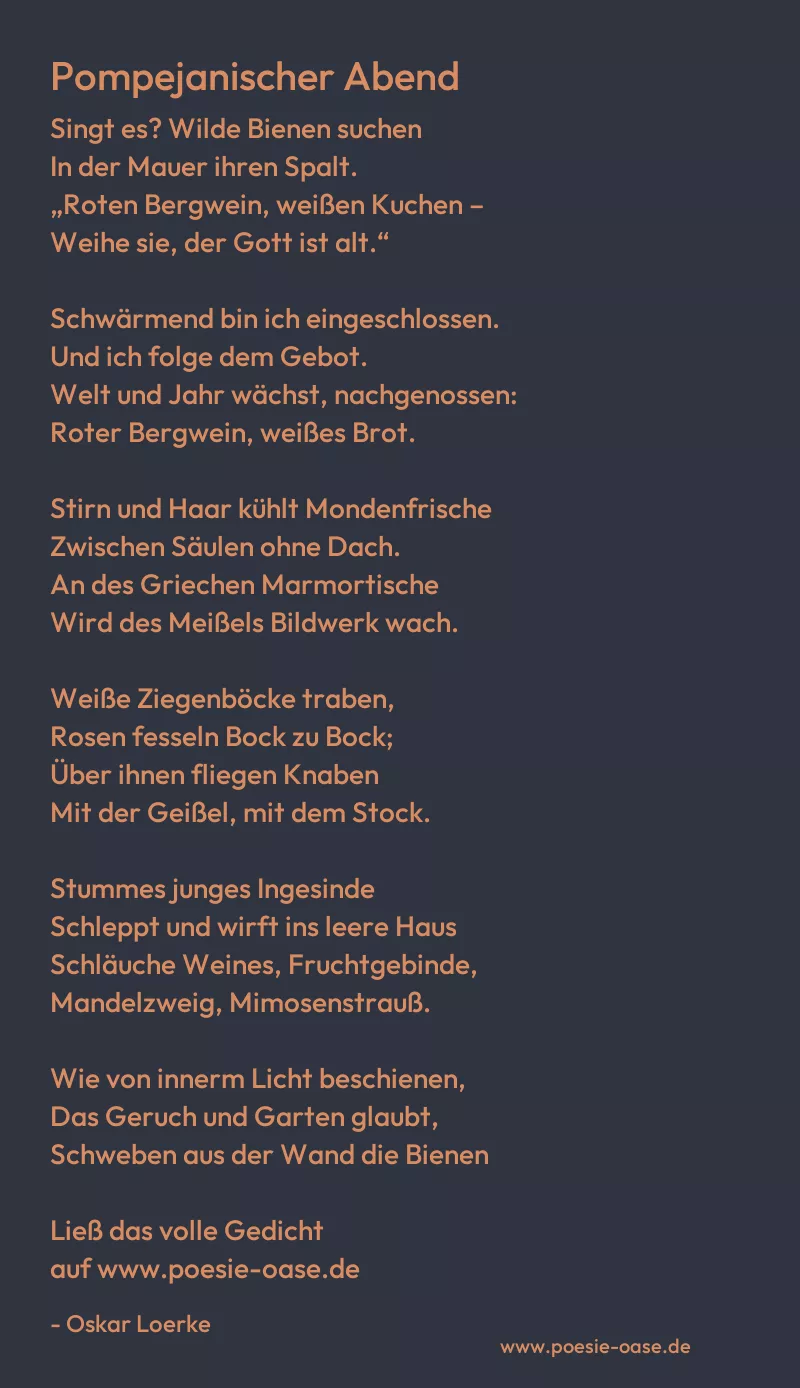Singt es? Wilde Bienen suchen
In der Mauer ihren Spalt.
„Roten Bergwein, weißen Kuchen –
Weihe sie, der Gott ist alt.“
Schwärmend bin ich eingeschlossen.
Und ich folge dem Gebot.
Welt und Jahr wächst, nachgenossen:
Roter Bergwein, weißes Brot.
Stirn und Haar kühlt Mondenfrische
Zwischen Säulen ohne Dach.
An des Griechen Marmortische
Wird des Meißels Bildwerk wach.
Weiße Ziegenböcke traben,
Rosen fesseln Bock zu Bock;
Über ihnen fliegen Knaben
Mit der Geißel, mit dem Stock.
Stummes junges Ingesinde
Schleppt und wirft ins leere Haus
Schläuche Weines, Fruchtgebinde,
Mandelzweig, Mimosenstrauß.
Wie von innerm Licht beschienen,
Das Geruch und Garten glaubt,
Schweben aus der Wand die Bienen
Musizierend mir ums Haupt.
Ach, sie ruhn im Mauerloche:
Sterne schweben um das Mahl;
Süßer trägt am Himmelsjoche
Als am Balkendach der Saal.
Singt es nicht? „Wer kann, ermesse
Unser aller großen Herrn!
Feuer wühlt des Berges Esse,
Feuer wühlt im Traubenkern.“ –
Boten wird ein Gott beordern,
Seine Söhne, kinderklein,
Und sie grüßen und sie fordern
Meiner Augen Traumtag ein.