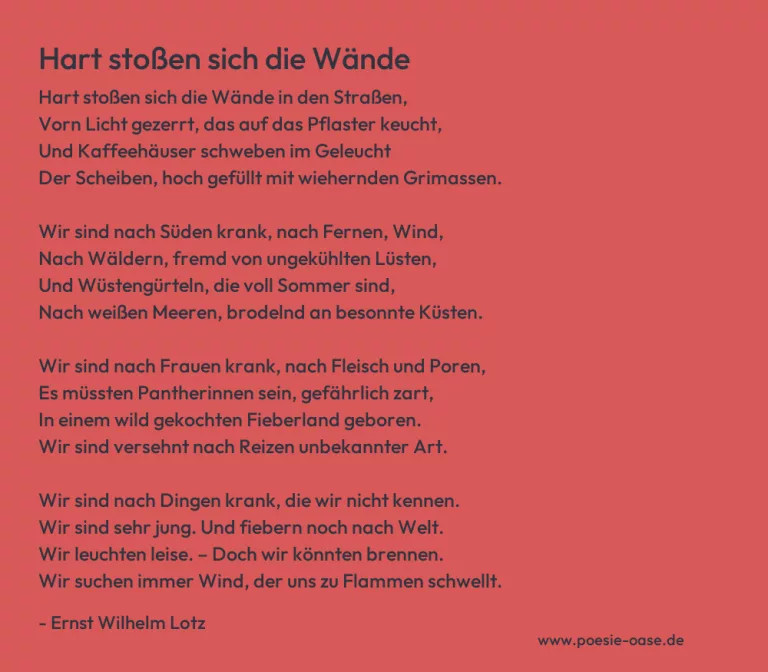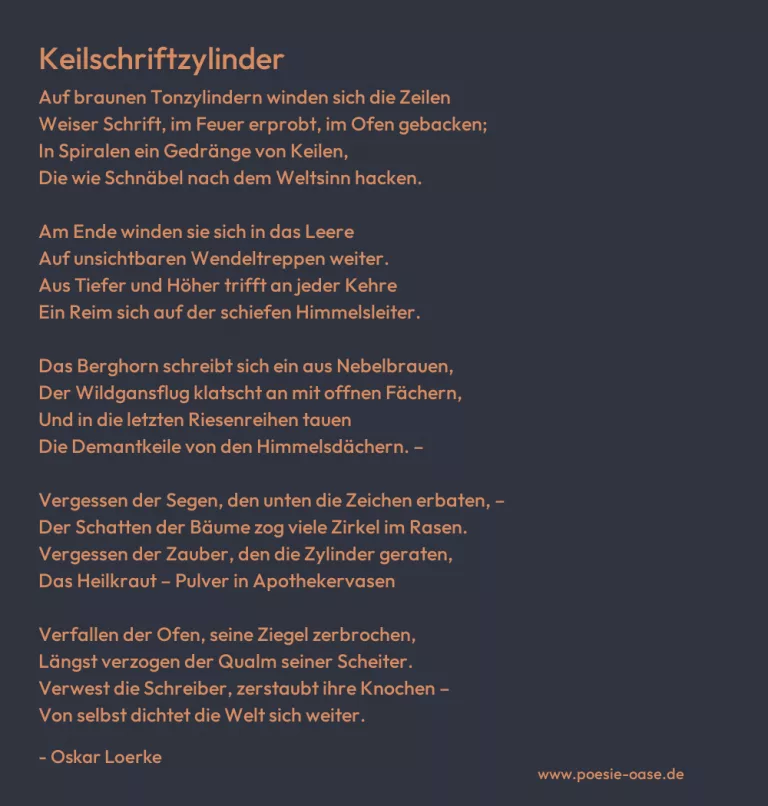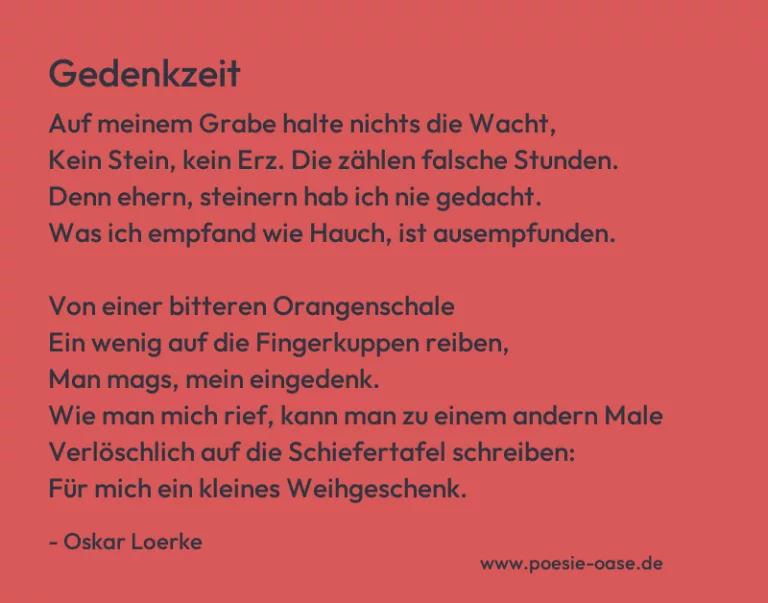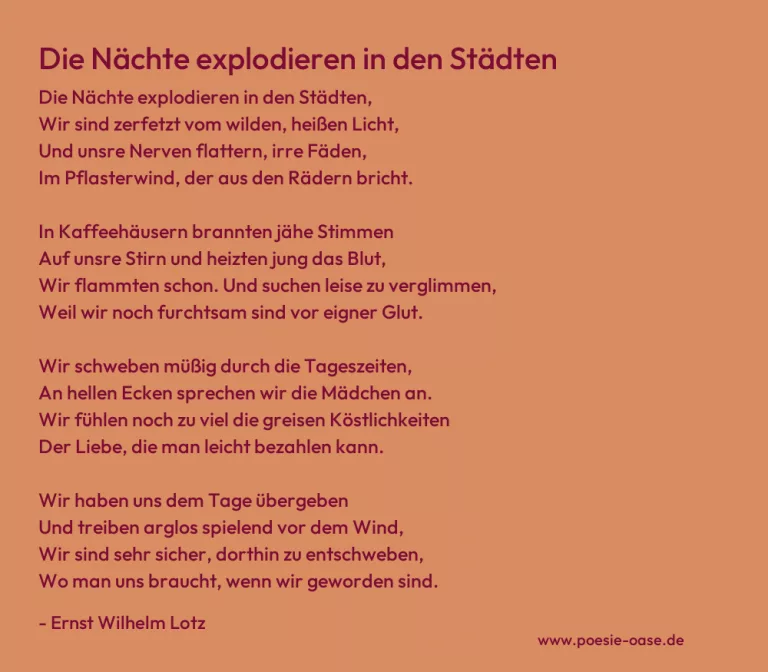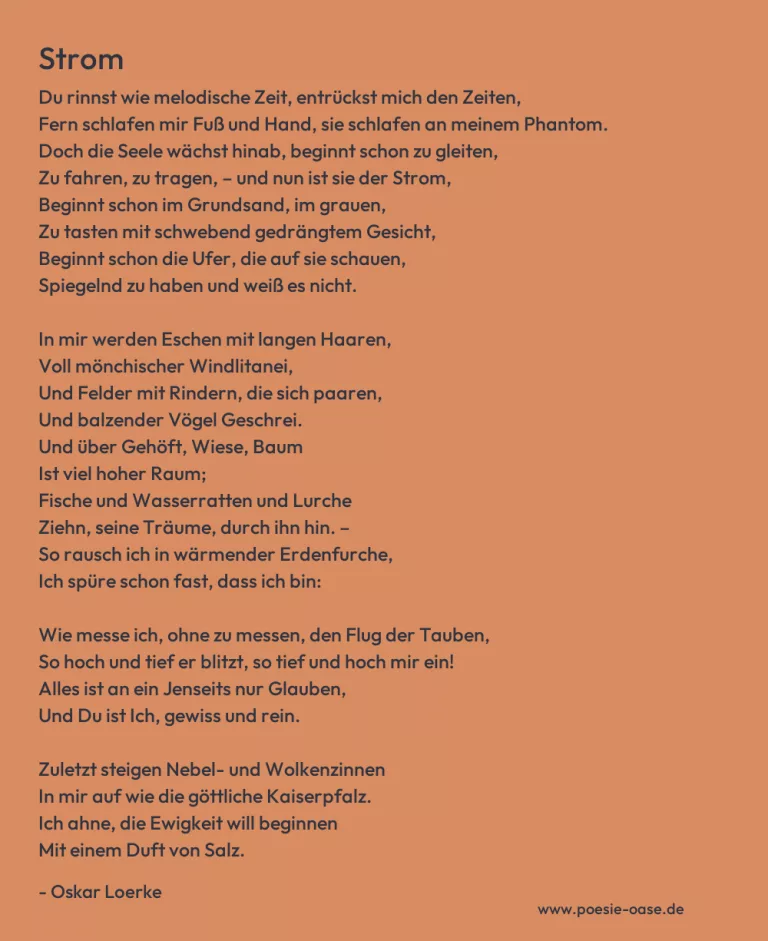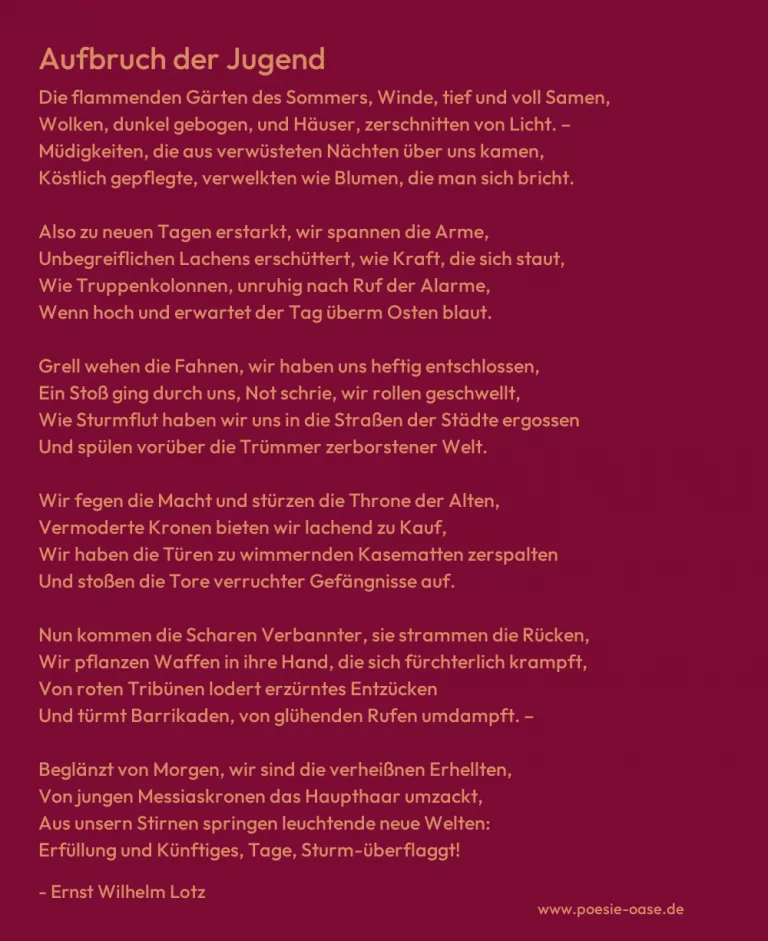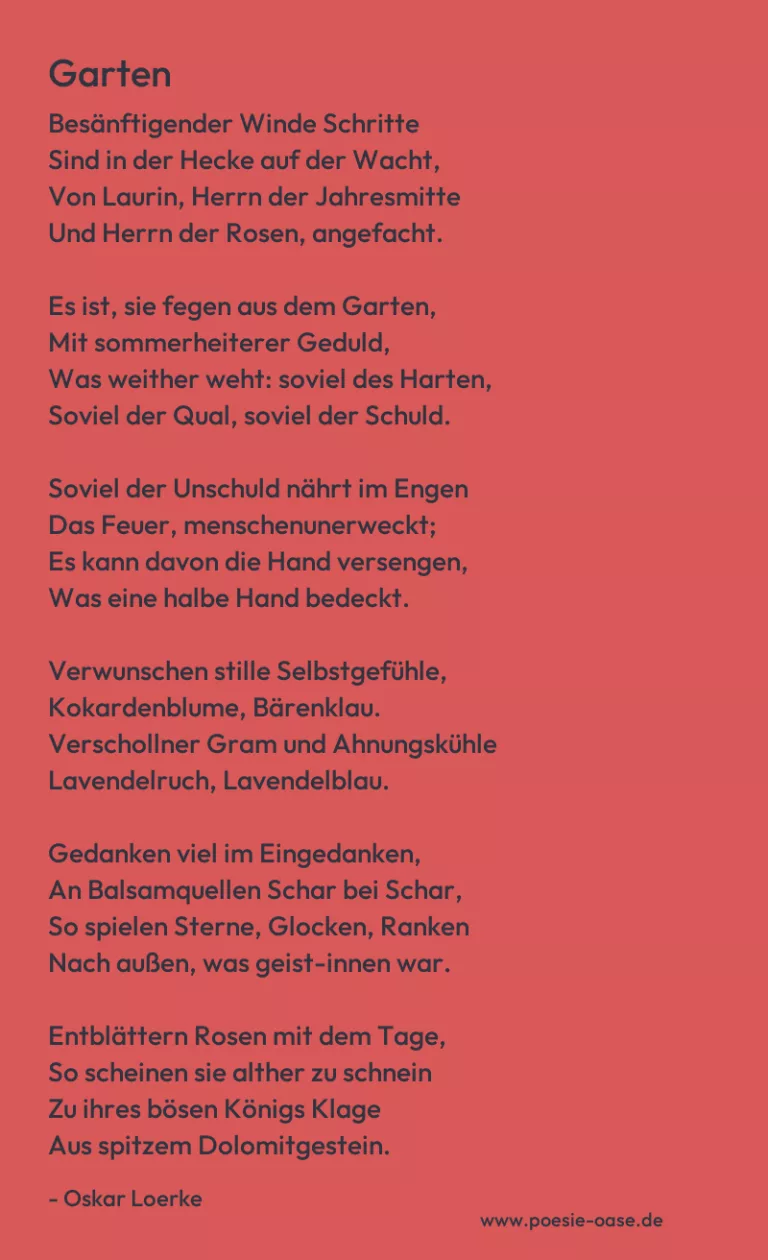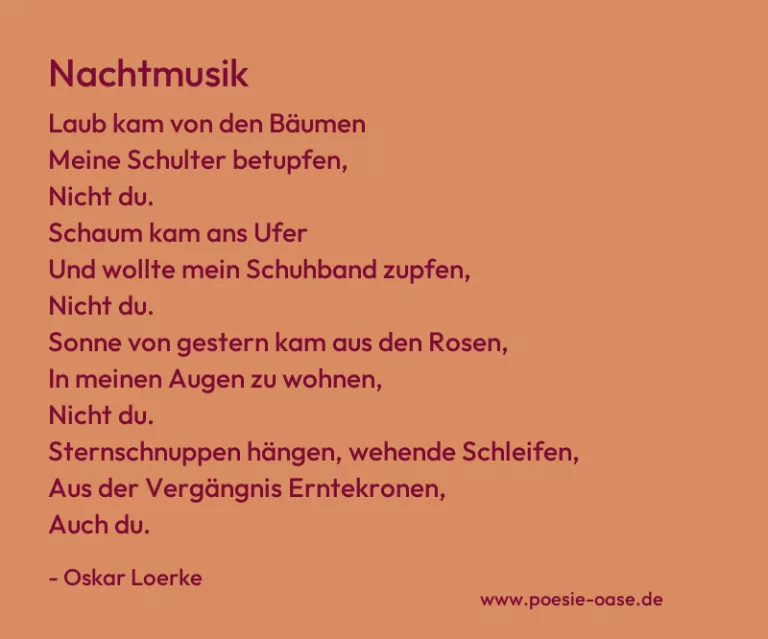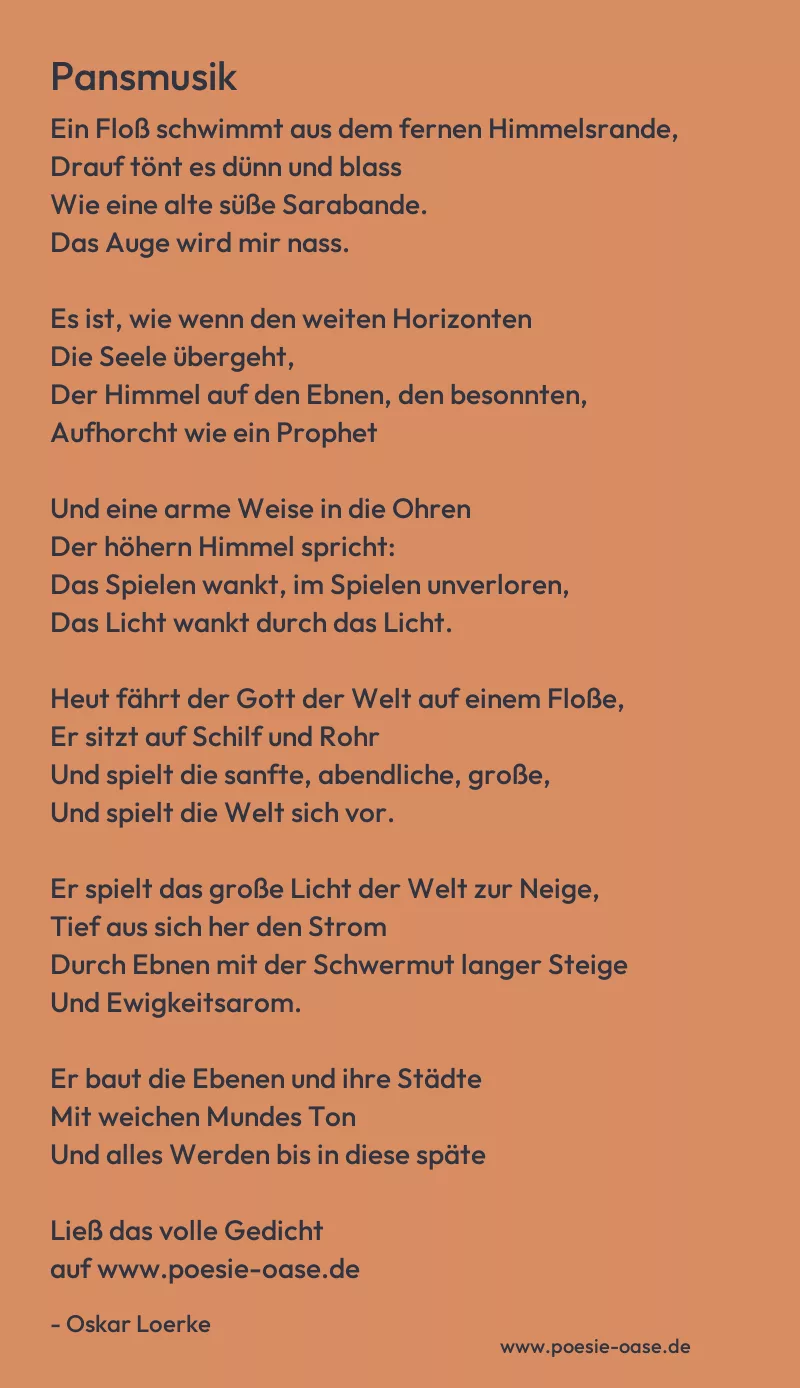Flüsse & Meere, Gemeinfrei, Glaube & Spiritualität, Götter, Herbst, Herzschmerz, Kindheit & Jugend, Natur, Religion, Spiritualität, Tiere, Unschuld
Pansmusik
Ein Floß schwimmt aus dem fernen Himmelsrande,
Drauf tönt es dünn und blass
Wie eine alte süße Sarabande.
Das Auge wird mir nass.
Es ist, wie wenn den weiten Horizonten
Die Seele übergeht,
Der Himmel auf den Ebnen, den besonnten,
Aufhorcht wie ein Prophet
Und eine arme Weise in die Ohren
Der höhern Himmel spricht:
Das Spielen wankt, im Spielen unverloren,
Das Licht wankt durch das Licht.
Heut fährt der Gott der Welt auf einem Floße,
Er sitzt auf Schilf und Rohr
Und spielt die sanfte, abendliche, große,
Und spielt die Welt sich vor.
Er spielt das große Licht der Welt zur Neige,
Tief aus sich her den Strom
Durch Ebnen mit der Schwermut langer Steige
Und Ewigkeitsarom.
Er baut die Ebenen und ihre Städte
Mit weichen Mundes Ton
Und alles Werden bis in diese späte
Verspieltsein und Verlohn:
Doch alles wie zu stillendem Genusse
Den Augen bloß, dem Ohr.
So fährt er selig auf dem großen Flusse
Und spielt die Welt sich vor.
So fährt sein Licht und ist bald bei den größern,
Orion, Schwan und Bär:
Sie alle scheinen Flöße schon mit Flößern
Der Welt ins leere Meer.
Bald wird die Grundharmonika verhallen,
Die Seele schläft mir ein,
Bald wird der Wind aus seiner Höhe fallen,
Die Tiefe nicht mehr sein.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
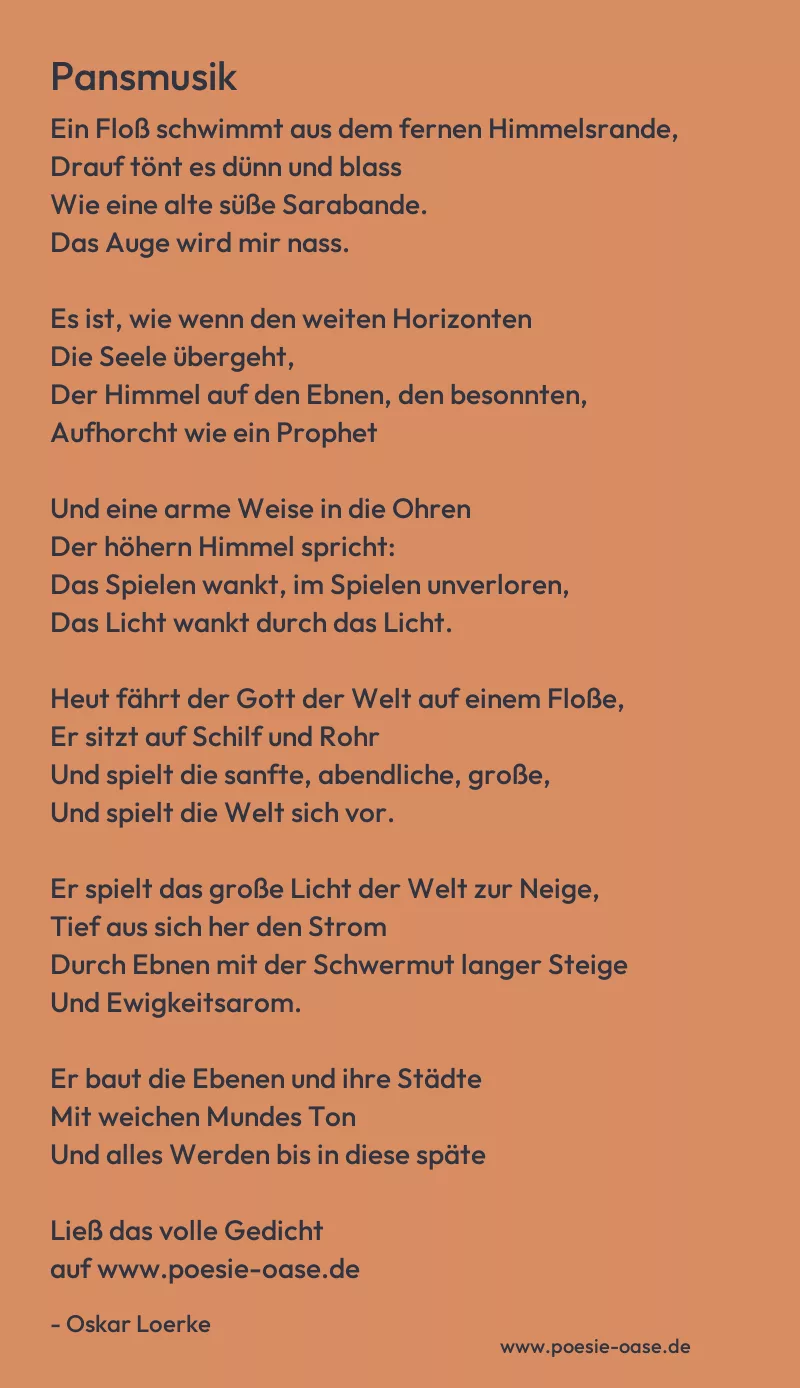
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Pansmusik“ von Oskar Loerke ist eine mystisch durchdrungene Meditation über Weltentstehung, Vergänglichkeit und die schöpferische Kraft der Musik. Es verbindet naturhafte Bilder mit mythischer Symbolik und beschreibt eine visionäre Szene, in der Pan – der arkadische Hirtengott – auf einem Floß über die Welt gleitet und durch seine Musik die Schöpfung beeinflusst.
Bereits in der ersten Strophe kündet ein feines, fast ätherisches musikalisches Motiv – eine „alte süße Sarabande“ – vom Auftauchen eines göttlichen Wesens. Die Musik scheint von einem Floß am Himmelsrand herüberzutönen und löst beim lyrischen Ich eine tiefe emotionale Regung aus. Der Vergleich mit der Sarabande, einem langsamen höfischen Tanz, betont die feierliche und melancholische Stimmung, während die „nasse“ Reaktion des Auges eine Verbindung zur inneren Rührung oder Erkenntnis herstellt.
In den folgenden Strophen weitet sich der Blick: Der Horizont selbst scheint beseelt, der Himmel horcht wie ein Prophet auf die himmlische Melodie. Diese Musik, „arm“ und doch bedeutungsvoll, durchdringt alles – sie wandelt, bewegt sich, verliert sich nicht, bleibt aber flüchtig. Das Licht – Sinnbild von Erkenntnis und Dasein – „wankt durch das Licht“, was ein Bild für die Durchlässigkeit und Unstetigkeit des Seins sein könnte.
Zentral ist die Figur des Pan, der auf einem Floß sitzt, umgeben von Schilf und Rohr – typische Attribute des Naturgottes. Er spielt nicht nur ein Lied, sondern „spielt die Welt sich vor“, was eine doppelte Bedeutung hat: Zum einen schafft er die Welt durch sein Spiel, zum anderen betrachtet er sie als etwas, das vor ihm, dem Gott, abläuft. In seiner Musik klingt „Schwermut“, aber auch „Ewigkeitsarom“ – das Werk ist melancholisch und zugleich von überzeitlicher Schönheit durchdrungen.
Gegen Ende steigert sich das Gedicht in eine kosmische Vision: Die Sterne selbst – Orion, Schwan, Bär – erscheinen wie weitere Flöße auf dem Strom der Welt. Die Musik Pans wird zur Grundharmonie des Daseins, die allmählich verklingt. In der letzten Strophe wird die Auflösung der Welt angedeutet: Der Wind fällt, die Tiefe verschwindet, die Seele schläft ein. Damit schließt das Gedicht mit einer ruhigen, fast transzendenten Auslöschung – als würde das göttliche Spiel in die Stille der Ewigkeit übergehen.
„Pansmusik“ ist somit ein vielschichtiges poetisches Werk über das Verhältnis von Kunst, Natur und Schöpfung. Es stellt Musik als göttlichen Urimpuls dar, der die Welt in Bewegung setzt – und sie schließlich auch wieder sanft in die Stille führt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.