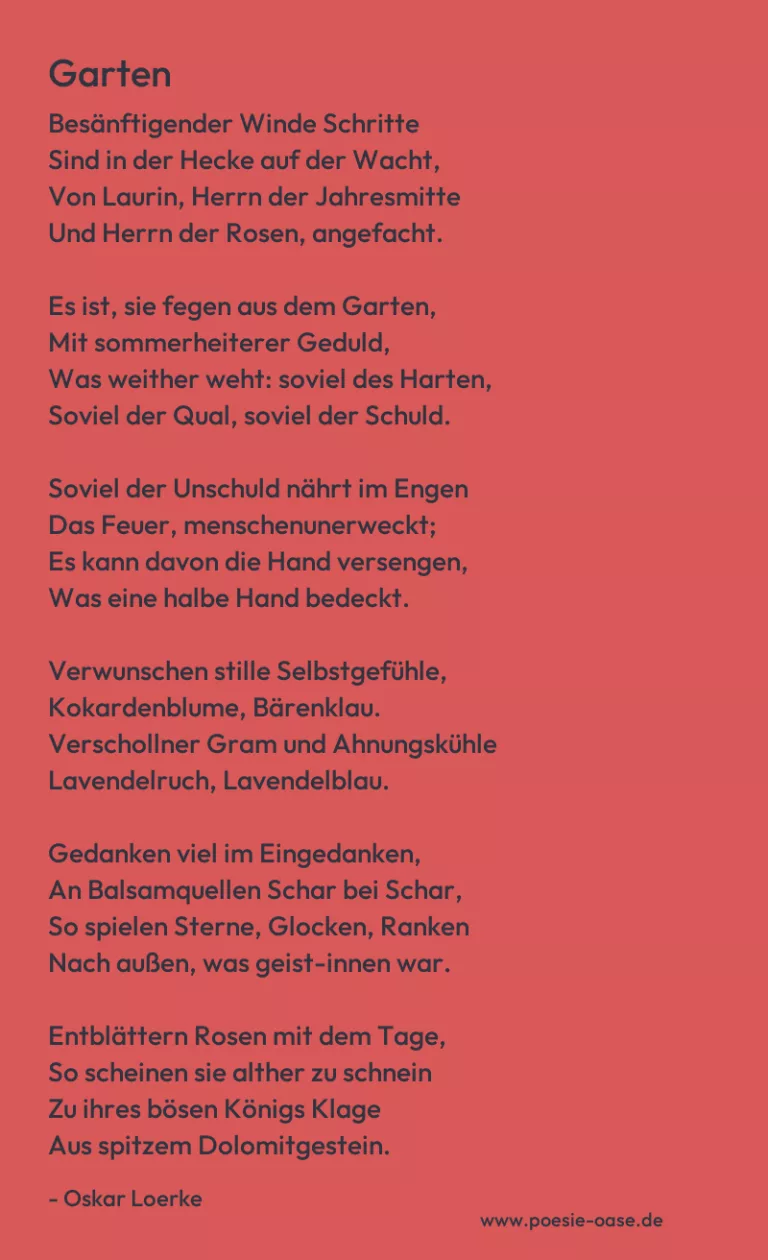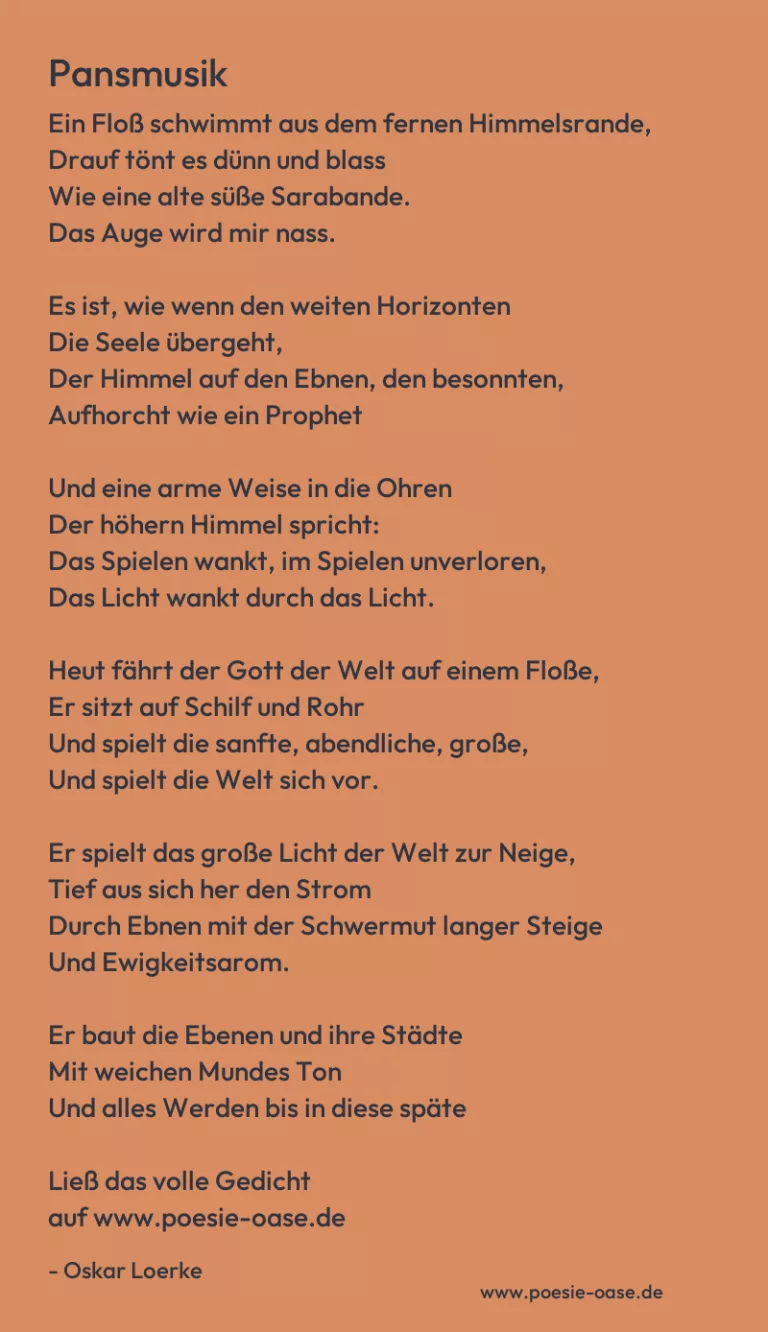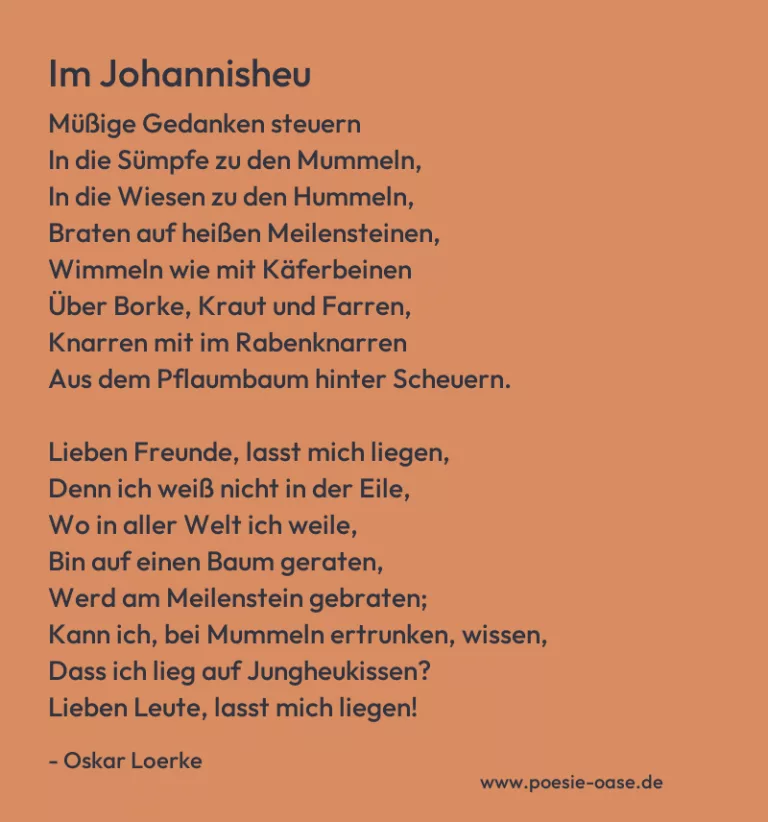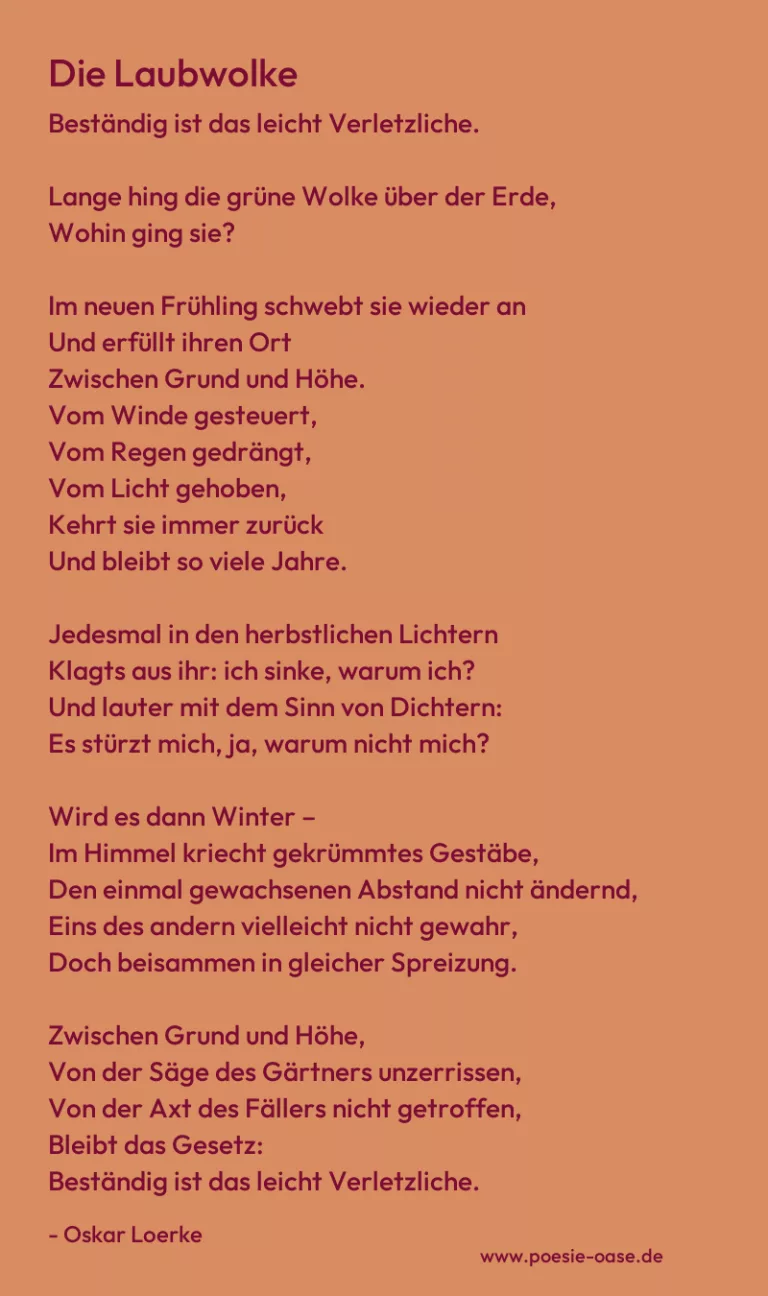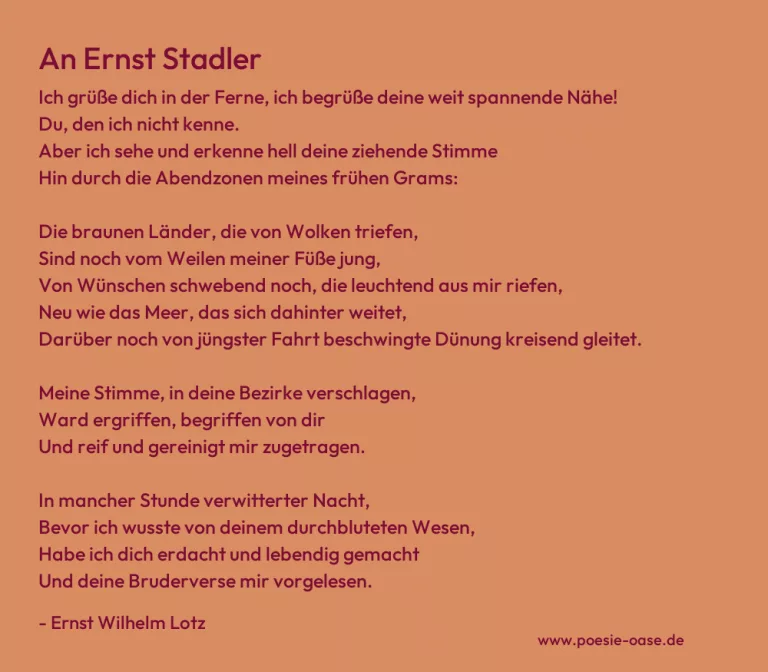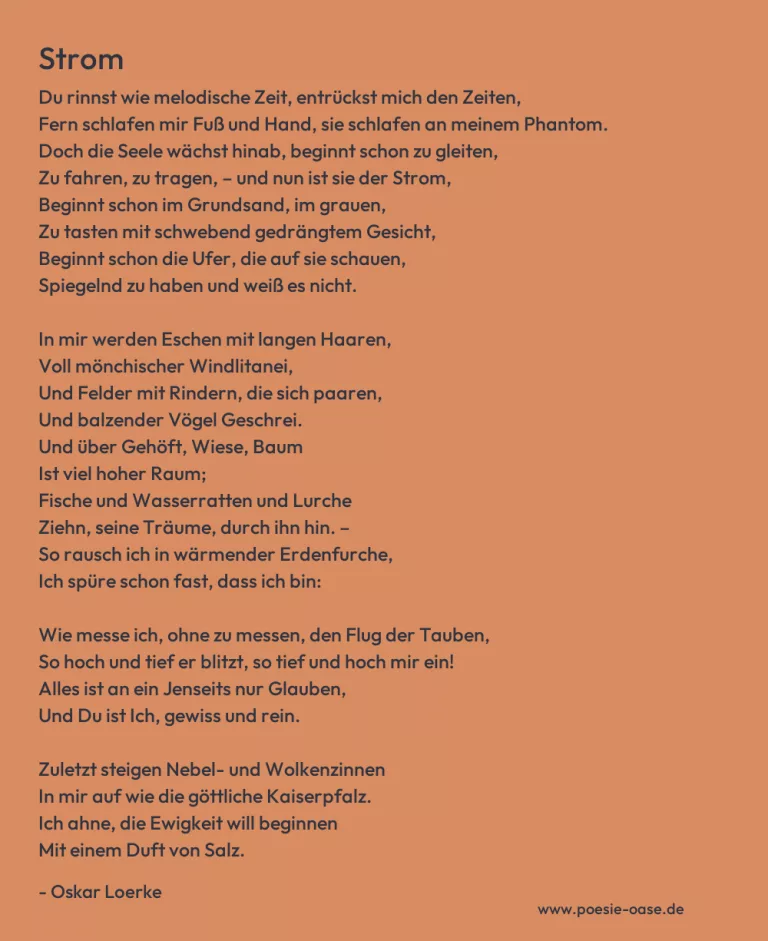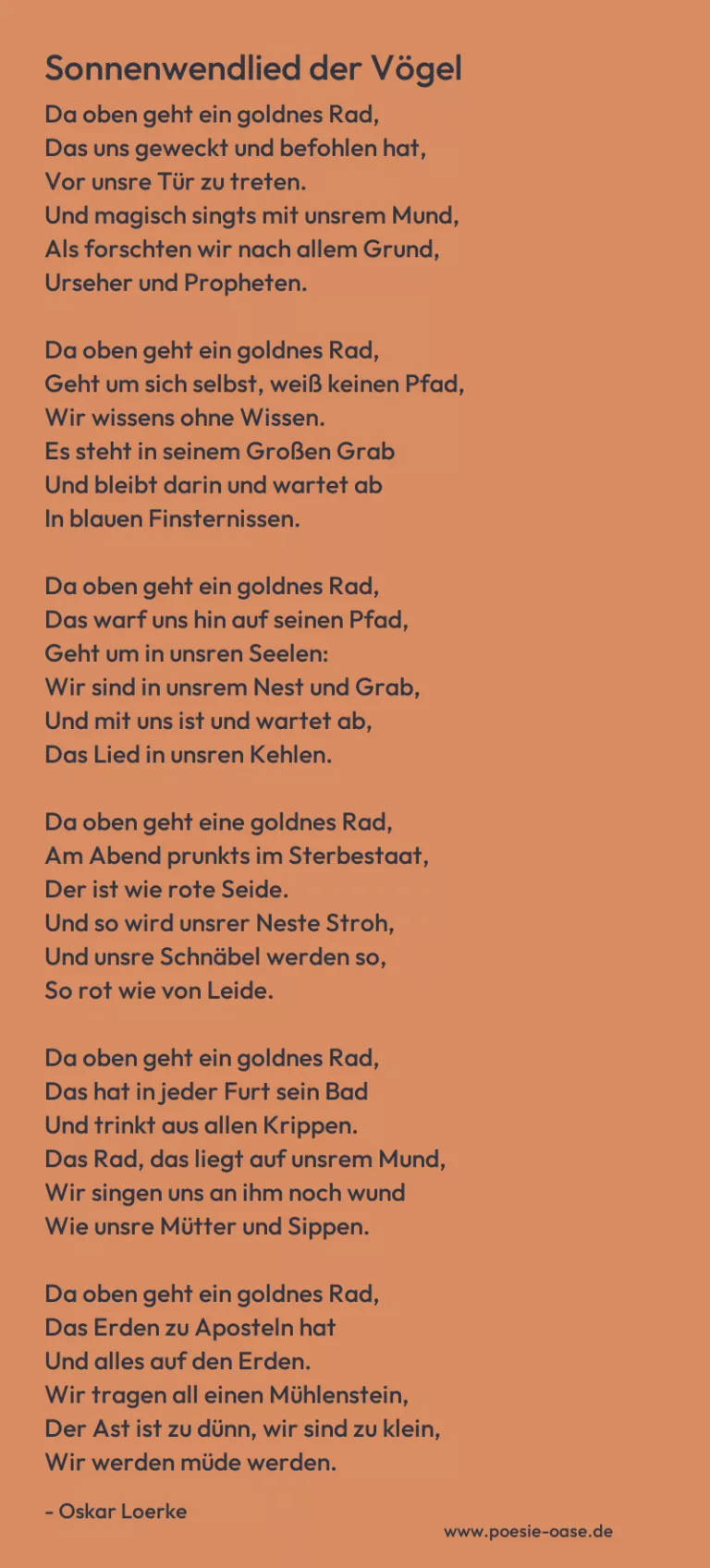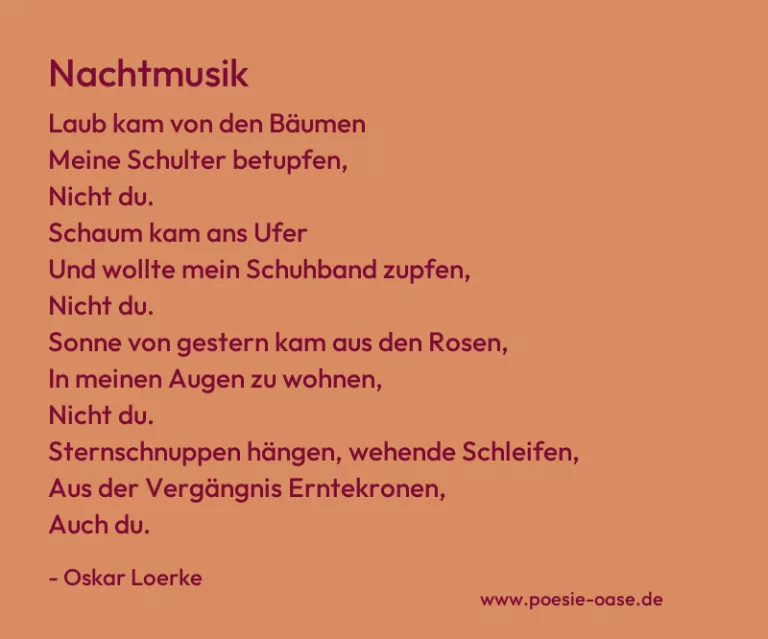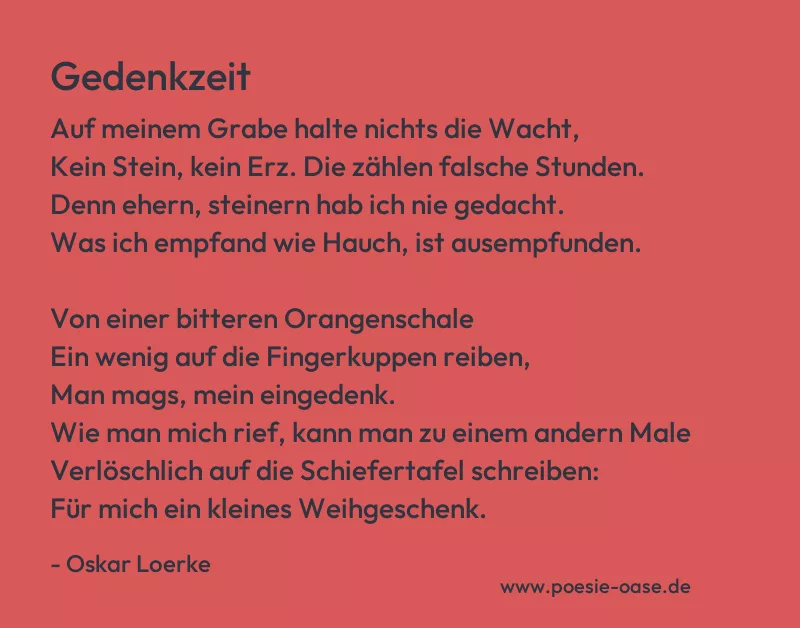Gedenkzeit
Auf meinem Grabe halte nichts die Wacht,
Kein Stein, kein Erz. Die zählen falsche Stunden.
Denn ehern, steinern hab ich nie gedacht.
Was ich empfand wie Hauch, ist ausempfunden.
Von einer bitteren Orangenschale
Ein wenig auf die Fingerkuppen reiben,
Man mags, mein eingedenk.
Wie man mich rief, kann man zu einem andern Male
Verlöschlich auf die Schiefertafel schreiben:
Für mich ein kleines Weihgeschenk.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
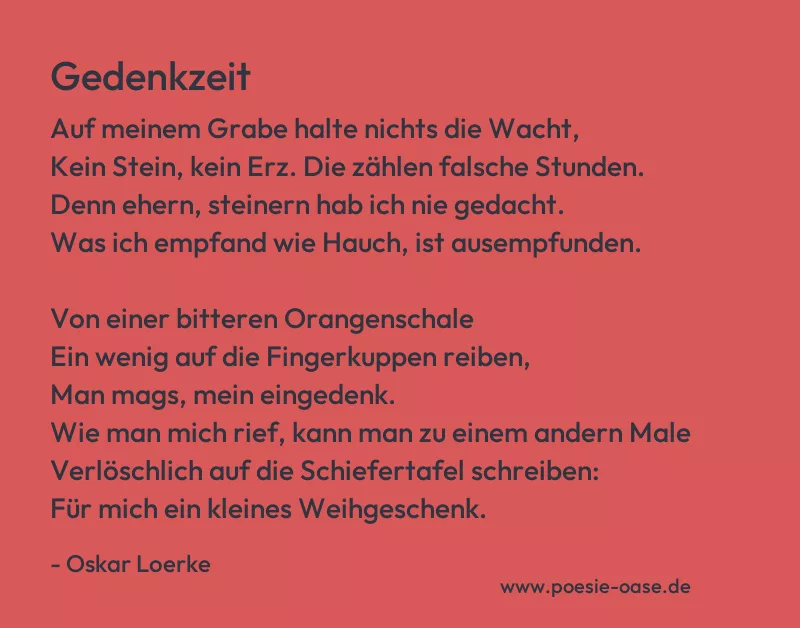
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Gedenkzeit“ von Oskar Loerke beschäftigt sich mit der Vergänglichkeit des Lebens und der Bedeutung von Erinnerung. Zu Beginn verweist der Sprecher darauf, dass auf seinem Grab nichts als Erinnerung bleibt – kein „Stein, kein Erz“, keine monumentale Struktur, die die Zeit überdauern soll. Der Verweis auf die „falschen Stunden“ deutet darauf hin, dass traditionelle Vorstellungen von Erinnerung und Dauer vergänglich und letztlich bedeutungslos sind. Der Sprecher selbst hat nie in festen, „ehern, steinern“ Kategorien gedacht, was darauf hinweist, dass er die Zeit und das Leben eher als fließend, nicht als starr und bleibend empfand. Der „Hauch“, den er beschrieb, steht als Symbol für die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Leichtigkeit der eigenen Existenz.
In der nächsten Strophe wird das Bild einer „bitteren Orangenschale“ verwendet, um die Flüchtigkeit und den Geschmack des Lebens zu symbolisieren. Der „Hauch“ des Lebens wird verglichen mit dem sanften Reiben einer Schale auf den „Fingerkuppen“, was einen flüchtigen, sinnlichen Moment beschreibt, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Diese „bittere Orangenschale“ könnte für die bittersüßen Erfahrungen im Leben stehen, die trotz ihrer Flüchtigkeit noch in der Erinnerung haften. Es ist ein subtiler Moment der Achtsamkeit, der das Leben in seiner Einfachheit und Zerbrechlichkeit feiert. Der Ausdruck „mein eingedenk“ verweist auf das Erinnern als ein kleines, aber bedeutungsvolles Detail, das den Sprecher charakterisiert.
Die letzte Strophe bringt eine weitere Schicht des Gedichts zum Ausdruck, indem sie die Vorstellung von Erinnerung als etwas Fließendes und Vergängliches darstellt. „Wie man mich rief, kann man zu einem andern Male“ und die Idee, dass es auf einer „Schiefertafel“ notiert werden könnte, deuten darauf hin, dass Erinnerung nicht von Dauer ist – sie wird gelöscht, verändert und in einer neuen Form weitergetragen. Diese Vorstellung einer „verlöschlichen“ Erinnerung steht im Gegensatz zu der Vorstellung von einer festen, beständigen Erinnerung, die in steinerner Form aufbewahrt wird. Die Erinnerung an den Sprecher wird eher als „kleines Weihgeschenk“ beschrieben, was den Akt des Erinnerns als etwas persönliches und intimes darstellt – ein Geschenk, das nicht in einer monumentalen Form existiert, sondern in den flüchtigen, persönlichen Momenten des Lebens, die uns verbinden.
Insgesamt zeigt Loerke in diesem Gedicht eine subtile und zugleich tiefgründige Perspektive auf das Thema Erinnerung und Vergänglichkeit. Es wird nicht auf eine unsterbliche Erinnerung an den eigenen Tod hingewiesen, sondern vielmehr auf das Feiern der flüchtigen, sinnlichen Momente, die im Gedächtnis haften bleiben. Loerke hinterfragt die traditionellen Vorstellungen von Beständigkeit und zeigt auf, dass der wahre Wert des Lebens in den kleinen, vergänglichen Momenten und in der persönlichen Erinnerung liegt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.