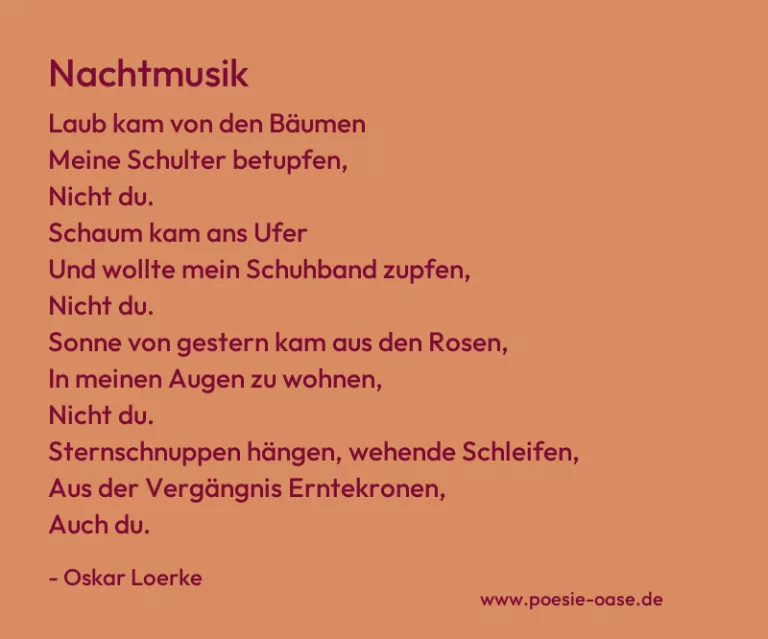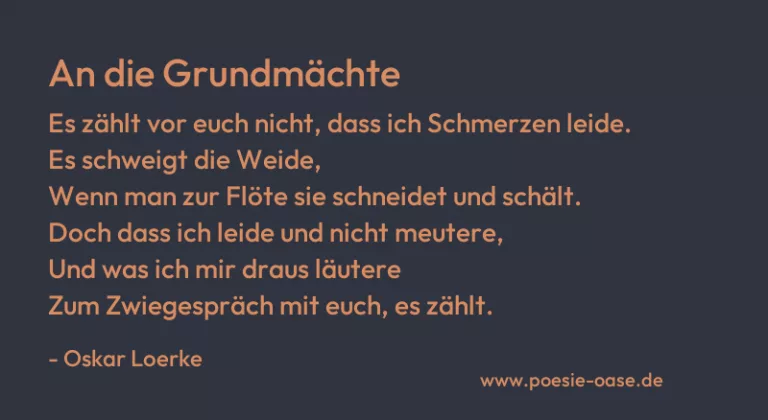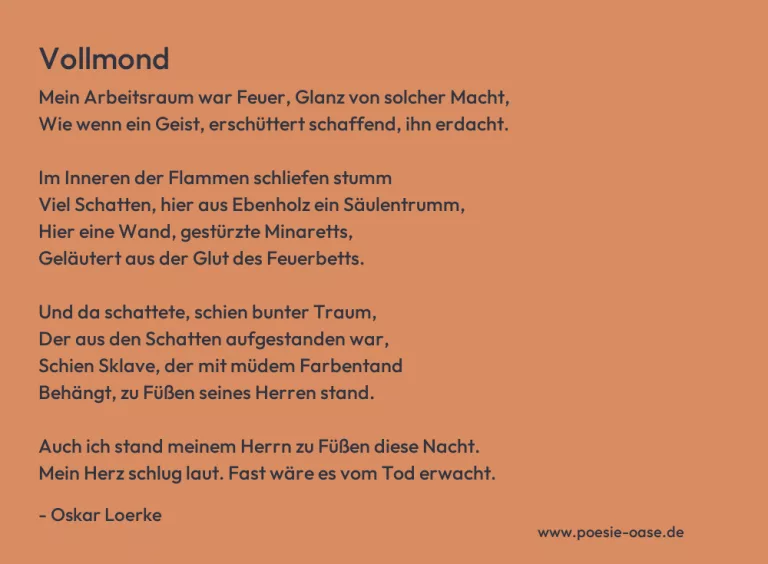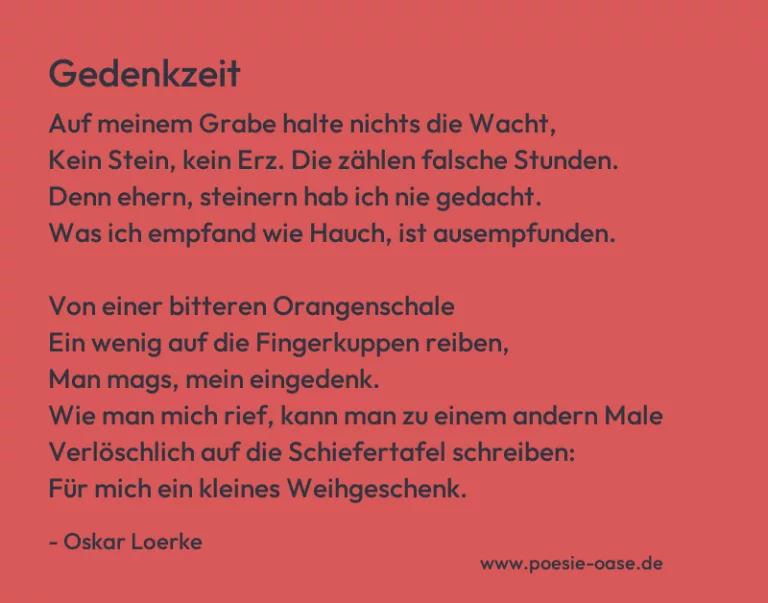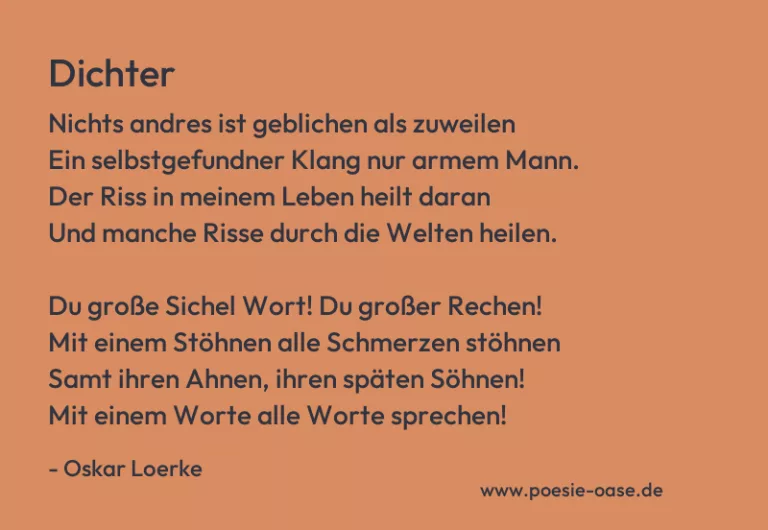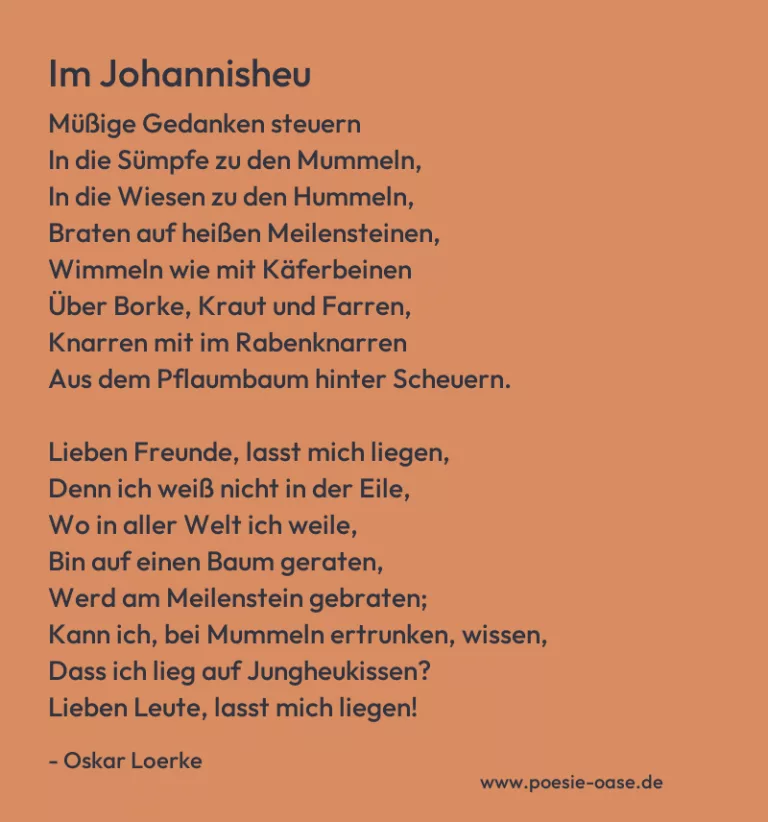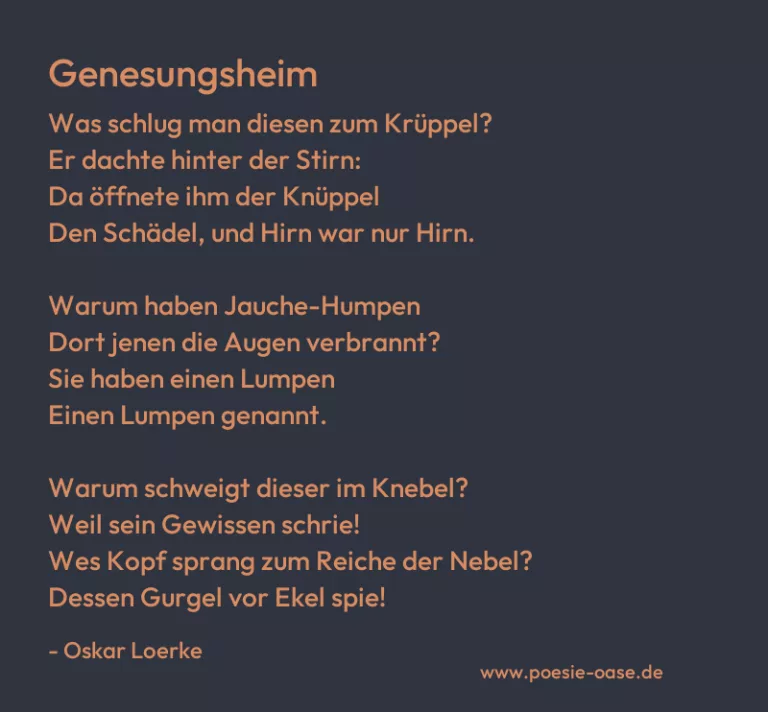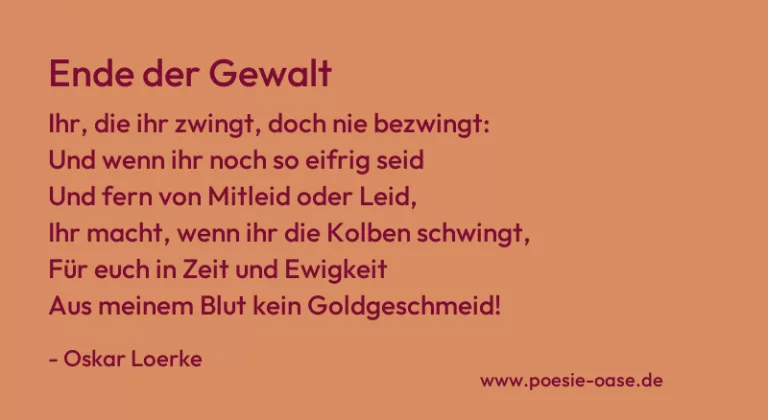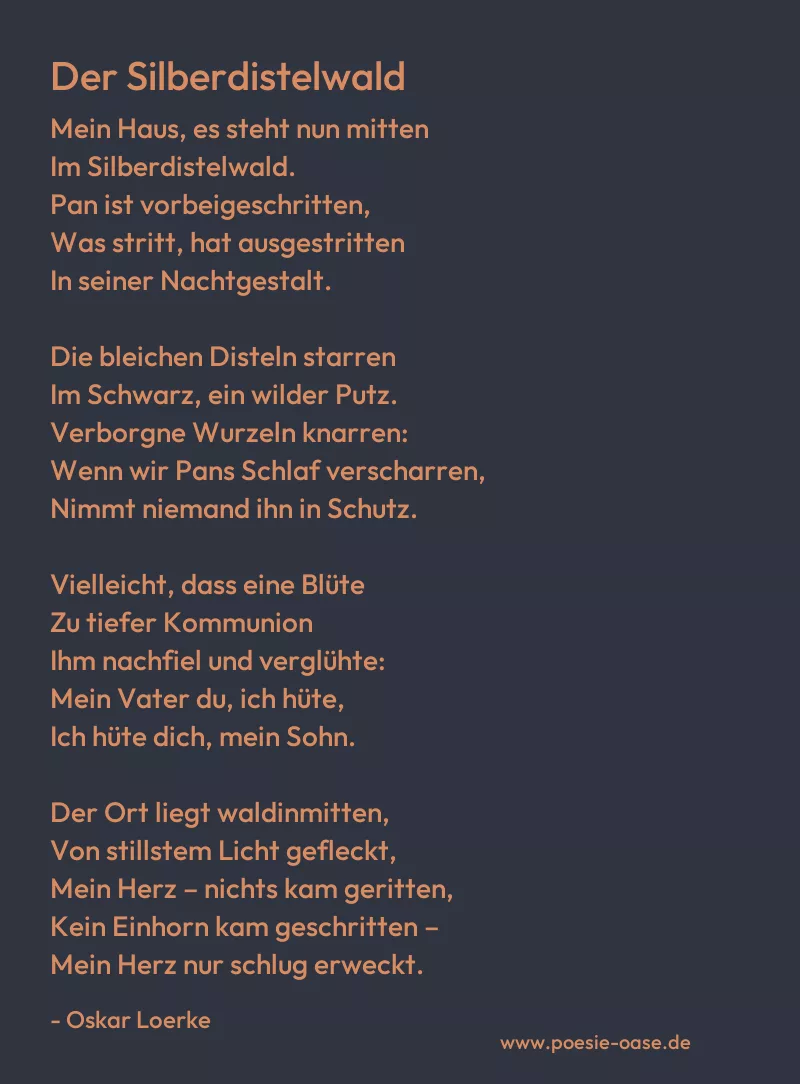Der Silberdistelwald
Mein Haus, es steht nun mitten
Im Silberdistelwald.
Pan ist vorbeigeschritten,
Was stritt, hat ausgestritten
In seiner Nachtgestalt.
Die bleichen Disteln starren
Im Schwarz, ein wilder Putz.
Verborgne Wurzeln knarren:
Wenn wir Pans Schlaf verscharren,
Nimmt niemand ihn in Schutz.
Vielleicht, dass eine Blüte
Zu tiefer Kommunion
Ihm nachfiel und verglühte:
Mein Vater du, ich hüte,
Ich hüte dich, mein Sohn.
Der Ort liegt waldinmitten,
Von stillstem Licht gefleckt,
Mein Herz – nichts kam geritten,
Kein Einhorn kam geschritten –
Mein Herz nur schlug erweckt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
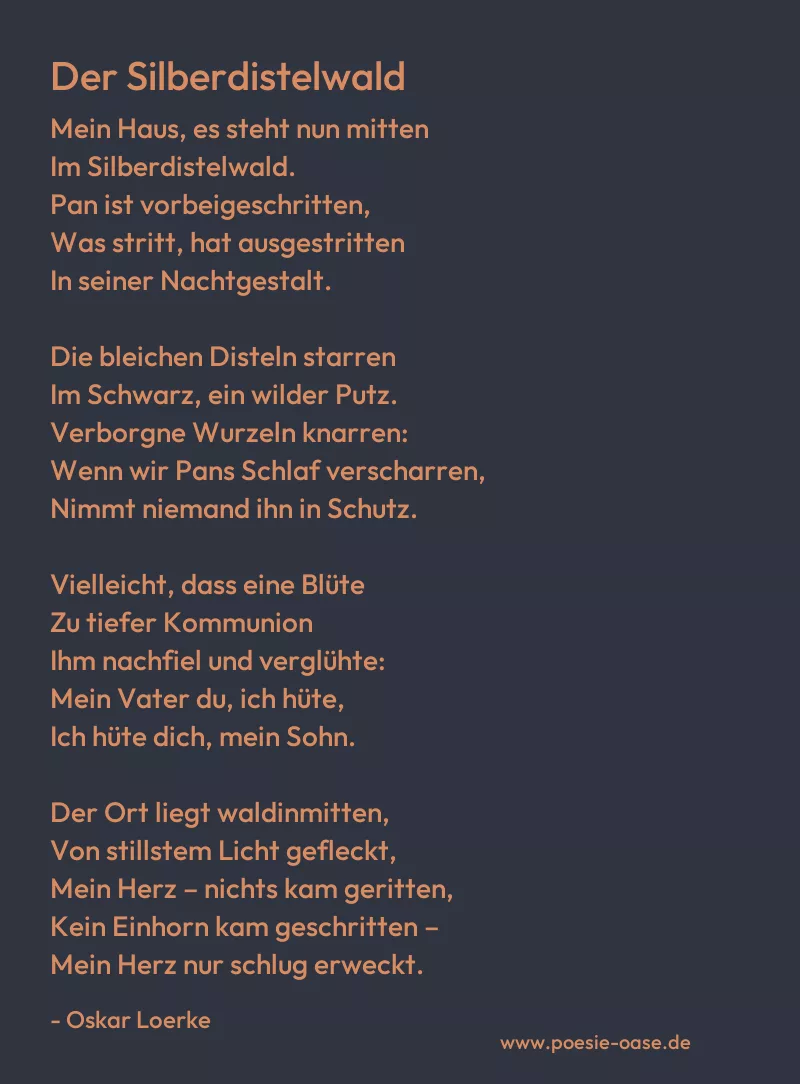
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Silberdistelwald“ von Oskar Loerke schildert eine mystische, symbolträchtige Landschaft, die von einem tiefen, geheimnisvollen Erleben geprägt ist. Die Bildsprache verbindet Natur und Mythologie, wobei der „Silberdistelwald“ als eine düstere, beinahe unheimliche Kulisse für das Geschehen dient. Das „Haus“, das im Zentrum des Gedichts steht, scheint in dieser unheimlichen Umgebung zu stehen, als würde es von den Kräften der Natur und des Mythos beeinflusst. Die Erwähnung von „Pan“, der mit seiner „Nachtgestalt“ vorbeischreitet, verweist auf die mythologische Figur des Pan, der in der griechischen Mythologie als Gott der Wildnis und der Natur mit chaotischen und ungezähmten Kräften verbunden wird.
Der Silberdistelwald selbst ist von bleichen Disteln geprägt, die als starr und düster beschrieben werden. Diese Disteln symbolisieren die Härte und das Bedrohliche der Natur. Das Bild der „verborgnen Wurzeln“, die „knarren“, verstärkt den Eindruck eines geheimen, möglicherweise unheilvollen Ortes. Gleichzeitig lässt die Vorstellung, dass „Pans Schlaf verscharren“ keine schützende Hand bietet, erahnen, dass der Ort von einem rauen, ungezügelten Naturgeist durchzogen ist, bei dem es keine Geborgenheit oder Rückhalt gibt.
Die dritte Strophe führt eine mystische Dimension ein, in der eine Blüte zu einer „tiefen Kommunion“ mit Pan zu verglühen scheint. Die Worte „Mein Vater du, ich hüte, ich hüte dich, mein Sohn“ schaffen eine Verbindung zwischen dem Sprecher und einer übergeordneten, vielleicht sogar archetypischen Gestalt. Es ist unklar, ob der Sprecher in diesem Moment tatsächlich mit Pan oder einer anderen göttlichen oder spirituellen Figur spricht, doch diese Aussage deutet auf eine Beziehung zwischen den Generationen hin, die durch eine Art schützender, fürsorglicher Haltung geprägt ist. Die Symbole der Blüte und des Vergehens verweisen auf eine Vergänglichkeit, die mit dem zyklischen Tod und der Wiedergeburt verbunden ist.
Das Gedicht schließt mit einem mystischen Bild: Der Ort liegt „wäldinmitten“ und wird von „stillstem Licht gefleckt“, was auf eine Art innerer Erleuchtung oder Erkenntnis hindeutet. Doch das „Herz“ des Sprechers ist nicht von äußeren, märchenhaften Bildern wie „Einhörnern“ oder „gerittenen“ Wesen erweckt worden, sondern es schlägt aus einer inneren Kraft heraus. Dies könnte auf eine persönliche, spirituelle Erweckung hinweisen, die nicht durch äußere Fantasie, sondern durch ein tiefes inneres Erleben und die Auseinandersetzung mit den Grundkräften der Natur und des Lebens zustande kommt. Loerke gelingt es hier, eine dichte, fast magische Atmosphäre zu erzeugen, in der Natur, Mythos und persönliche Erfahrung miteinander verschmelzen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.