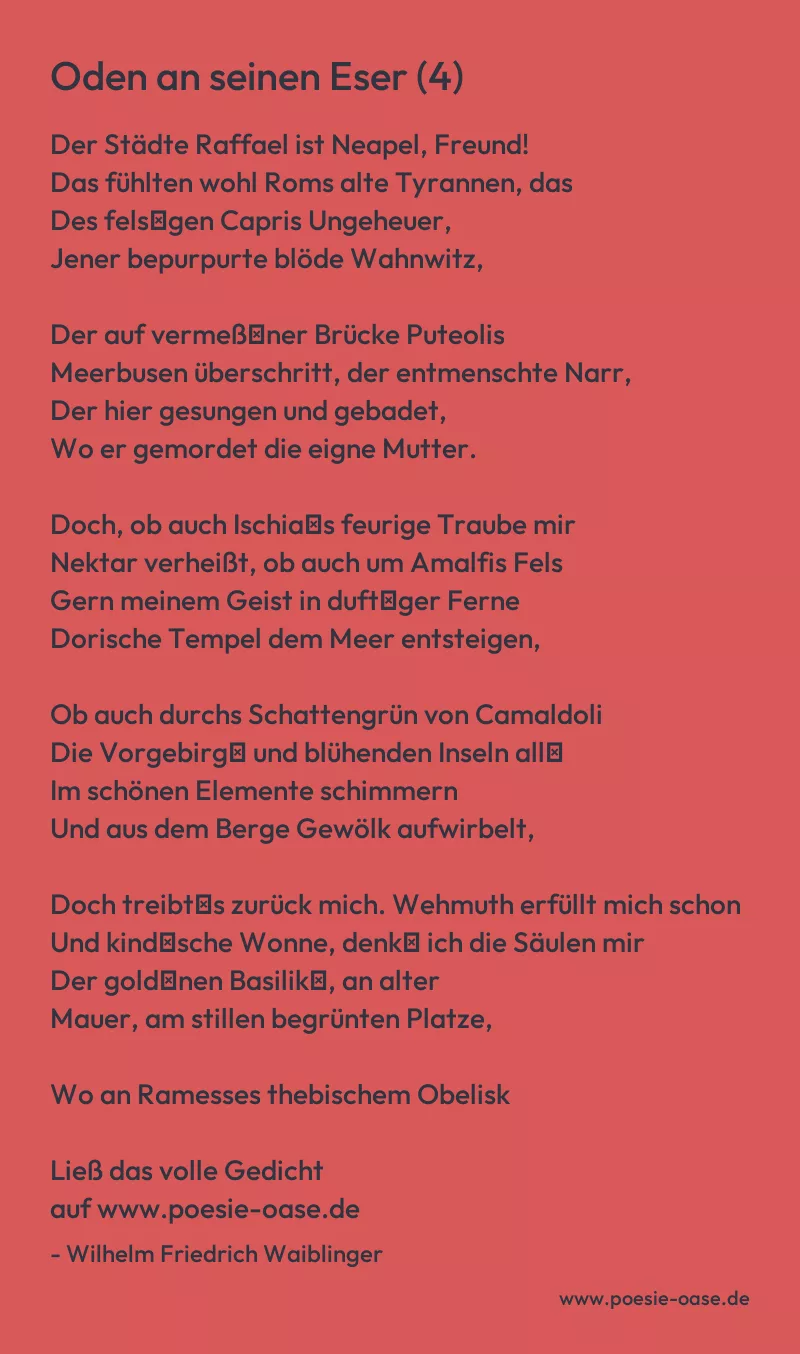Der Städte Raffael ist Neapel, Freund!
Das fühlten wohl Roms alte Tyrannen, das
Des fels′gen Capris Ungeheuer,
Jener bepurpurte blöde Wahnwitz,
Der auf vermeß′ner Brücke Puteolis
Meerbusen überschritt, der entmenschte Narr,
Der hier gesungen und gebadet,
Wo er gemordet die eigne Mutter.
Doch, ob auch Ischia′s feurige Traube mir
Nektar verheißt, ob auch um Amalfis Fels
Gern meinem Geist in duft′ger Ferne
Dorische Tempel dem Meer entsteigen,
Ob auch durchs Schattengrün von Camaldoli
Die Vorgebirg′ und blühenden Inseln all′
Im schönen Elemente schimmern
Und aus dem Berge Gewölk aufwirbelt,
Doch treibt′s zurück mich. Wehmuth erfüllt mich schon
Und kind′sche Wonne, denk′ ich die Säulen mir
Der gold′nen Basilik′, an alter
Mauer, am stillen begrünten Platze,
Wo an Ramesses thebischem Obelisk
Der Brunnen plätschert, einsame Straßen auch,
Hier Kuppeln in der Abendröthe,
Dort des zertrümmerten Colosseums
In Sonnenflammen athmende Riesenwand
Prachtvoll mir zeigen! Trauernde Roma, hier
Der Völker großem Gott, dem ew′gen
Schicksal geheiligt ertönt mein Lied dir.
Zweimal hast du mit eiserner Hand die Welt
Gedrückt, Herrschsüchtige, größer als du war nur
Das Schicksal, drum auch zweimal hat′s dir
Strafend entwunden den schweren Scepter,
Den Kön′ge, Senatoren, Cäsare einst
Geführt, und unerbittlicher noch zuletzt
Dreifach gekrönte Priester, deren
Heiliger Waffe der Hohenstaufen
Großherz′ger Heldenstamm als ein Opfer sank
Der Völkerblindheit, denen die Kaiserhand
Den Bügel hielt, und deren Bannstrahl
Könige stürzte vom Thron der Väter.
Ach, sänft′ge nun, o Rom, dein tyrannisch Herz,
Und beuge dich der Zeit. Der gefallene
Herrschgier′ge Engel rang vergebens
Einst mit dem Himmel um seine Krone.
Im Grabe deiner großen Auguste, wo
Britannicus ein heuchlerisch Todtenmahl
Geehrt, vergißt in Spiel und Stierkampf
Nun das entartete Volk die Vorwelt.
Des Forums Siegesbögen und Tempel, jetzt
Durchzieht sie nur schwermüthiger Mönche Schwarm,
Der Wand′rer nur aus fernen Landen,
Fremd, wie der Römer im eignen Rom ist.
Eins bleibt dir noch, der himmlische Genius
Der Kunst ist′s! Freund, drum laß mich, da Andres nicht
Vergönnt ist, einer bessern Zukunft
Thaten und Werke der Muse weihen.