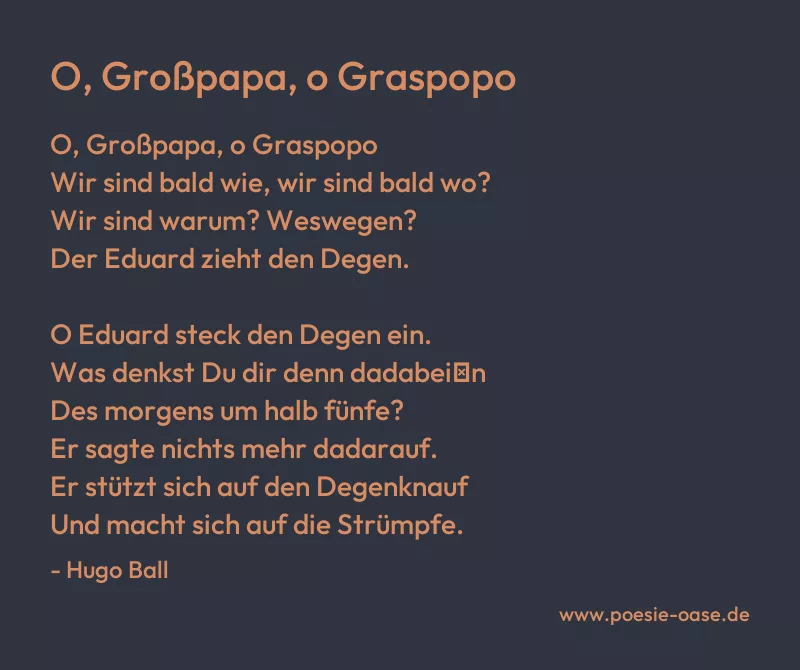O, Großpapa, o Graspopo
O, Großpapa, o Graspopo
Wir sind bald wie, wir sind bald wo?
Wir sind warum? Weswegen?
Der Eduard zieht den Degen.
O Eduard steck den Degen ein.
Was denkst Du dir denn dadabei′n
Des morgens um halb fünfe?
Er sagte nichts mehr dadarauf.
Er stützt sich auf den Degenknauf
Und macht sich auf die Strümpfe.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
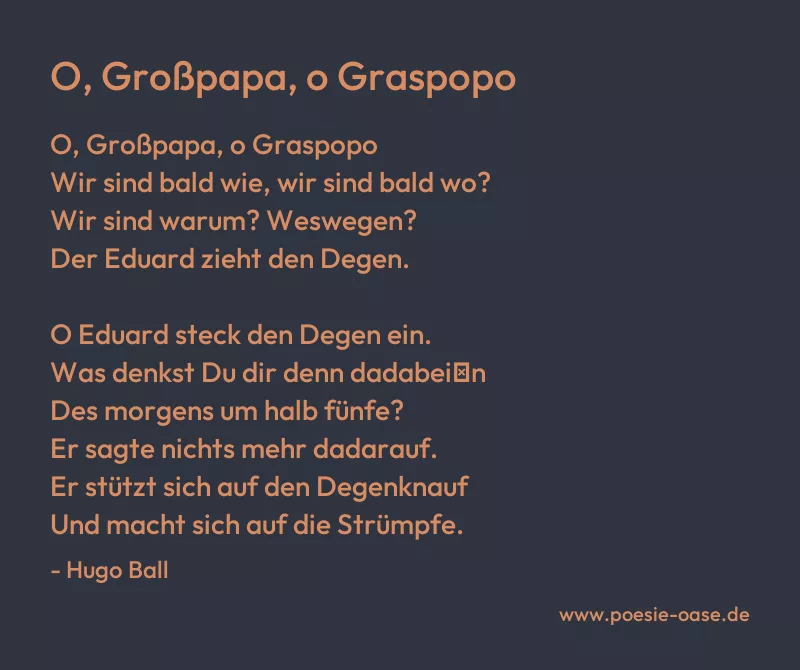
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „O, Großpapa, o Graspopo“ von Hugo Ball ist ein Dada-Gedicht, das sich durch seine scheinbare Sinnlosigkeit und den bewussten Verzicht auf konventionelle sprachliche Strukturen auszeichnet. Es spielt mit der Sprache, zerlegt sie in fragmentierte Elemente und erzeugt dadurch eine surreale und humorvolle Atmosphäre. Die Verwendung von Nonsens-Wörtern wie „Graspopo“ und die ungewöhnlichen Fragen („Wir sind bald wie, wir sind bald wo? / Wir sind warum? Weswegen?“) wecken Irritation und laden zur Hinterfragung des Konventionellen ein.
Die Figur des Eduard, der in den darauffolgenden Zeilen auftritt, stellt einen weiteren Aspekt der Dada-Bewegung dar: die Kritik an Krieg und Militär. Die Aufforderung, den Degen einzustecken, verbunden mit dem Hinweis auf die frühe Morgenstunde, deutet auf eine Absurdität des militärischen Denkens hin. Eduard scheint ziellos oder aus unklaren Gründen den Degen zu ziehen, was die Sinnlosigkeit von Gewalt und Krieg hervorhebt. Die Reaktion Eduards, die in Schweigen und dem Stützen auf den Degenknauf besteht, verstärkt diesen Eindruck der Absurdität und des Unverständnisses.
Die formalen Aspekte des Gedichts tragen ebenfalls zur dadaistischen Wirkung bei. Der Reim, obwohl vorhanden, ist unregelmäßig und wirkt dadurch beiläufig. Die Zeilen sind kurz und abgehackt, was dem Ganzen einen fragmentarischen Charakter verleiht. Hugo Ball verwendet diese Mittel, um die bürgerlichen Konventionen zu untergraben und eine neue, unkonventionelle Form der Poesie zu schaffen. Die Wiederholung des „O“ zu Beginn des Gedichts und die direkte Anrede suggerieren zudem eine spielerische, fast kindliche Qualität, die im Kontrast zur vermeintlichen Ernsthaftigkeit der Frage nach dem „Warum“ steht.
Letztlich ist das Gedicht eine Kritik an den traditionellen Werten und Normen der Gesellschaft, insbesondere an Militarismus und Krieg, sowie ein Ausdruck des dadaistischen Protestes gegen bürgerliche Konventionen. Es fordert den Leser heraus, die Welt mit neuen Augen zu sehen, festgefahrene Denkmuster zu hinterfragen und die Absurdität des Lebens zu erkennen. Das Gedicht ist ein Appell für Freiheit und Kreativität, in dem die Sprache zu einem Werkzeug des Unsinns und der Befreiung wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.