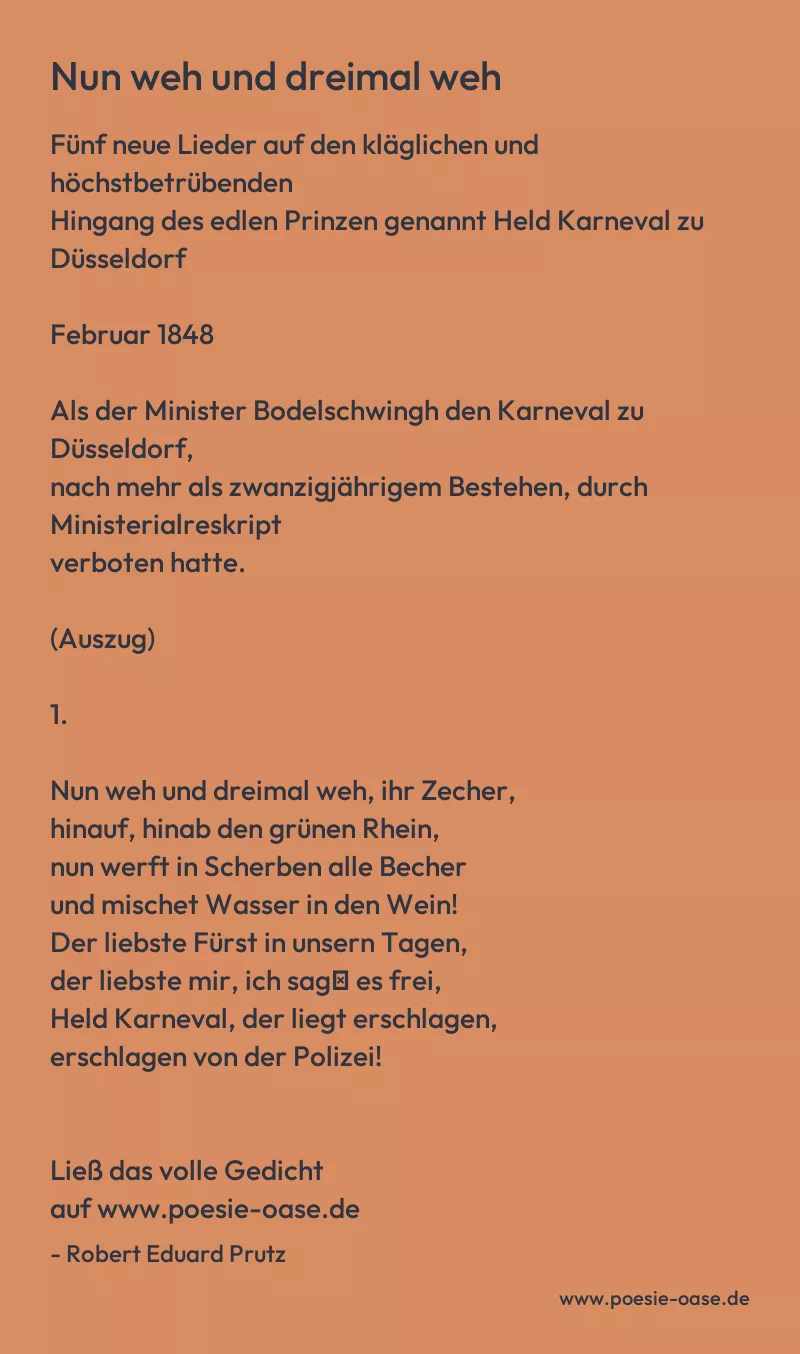Fünf neue Lieder auf den kläglichen und höchstbetrübenden
Hingang des edlen Prinzen genannt Held Karneval zu Düsseldorf
Februar 1848
Als der Minister Bodelschwingh den Karneval zu Düsseldorf,
nach mehr als zwanzigjährigem Bestehen, durch Ministerialreskript
verboten hatte.
(Auszug)
1.
Nun weh und dreimal weh, ihr Zecher,
hinauf, hinab den grünen Rhein,
nun werft in Scherben alle Becher
und mischet Wasser in den Wein!
Der liebste Fürst in unsern Tagen,
der liebste mir, ich sag′ es frei,
Held Karneval, der liegt erschlagen,
erschlagen von der Polizei!
Wer in dem Glanz der goldnen Locken,
wer sah so stolz, so froh darein?
Wen läuteten die Rheinweinglocken
so feierlich, so fröhlich ein?
So recht nach Gottes Ebenbilde,
ein König und ein Kind zugleich,
wer war, wie er, so sanft und milde,
wo war ein Joch, wie seins so weich?
Nicht Orden hatt′ er oder Wappen,
er hatte Söldner nicht noch Heer:
Die Narrengunst, die Schellenkappen,
das war sein ganzes Militär.
Und wer die meisten Becher leerte,
der allerlustigste Patron,
das war der dreimal Hochgeehrte,
der Nächste war das seinem Thron.
Nun in der Blüte seiner Jahre
hat ihn die Polizei umstrickt,
nun einsam liegt er auf der Bahre,
von einem Bodelschwingh erdrückt!
Wir aber wolln die Gläser heben
und rufen dennoch frank und frei:
Der tote Karneval soll leben
und pereat die Polizei!