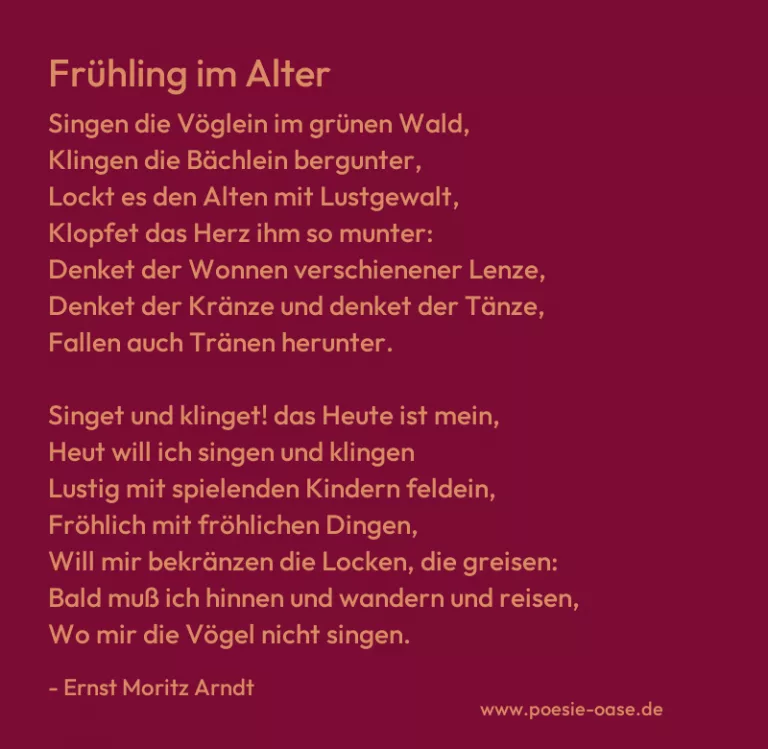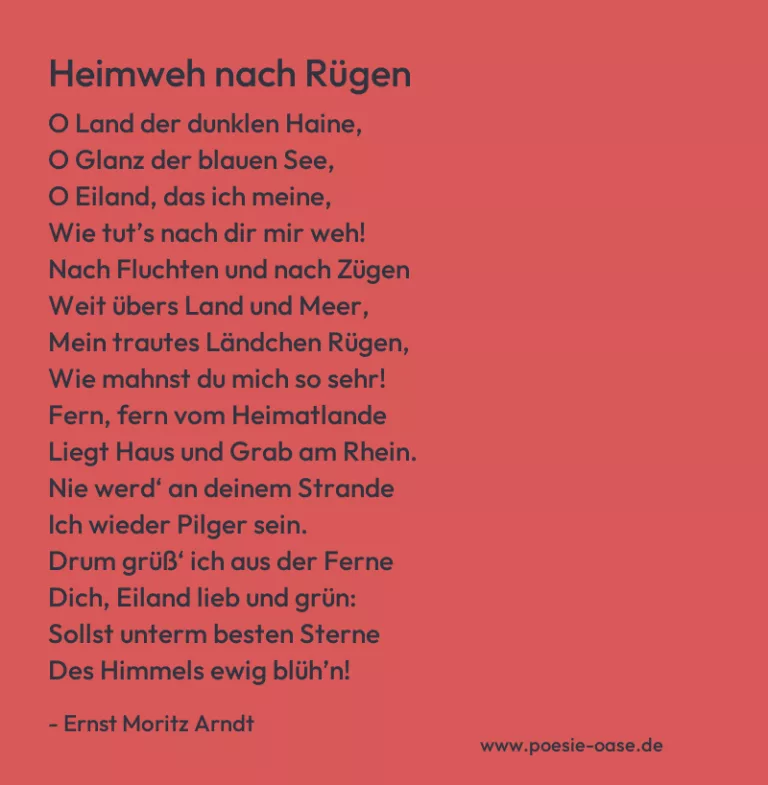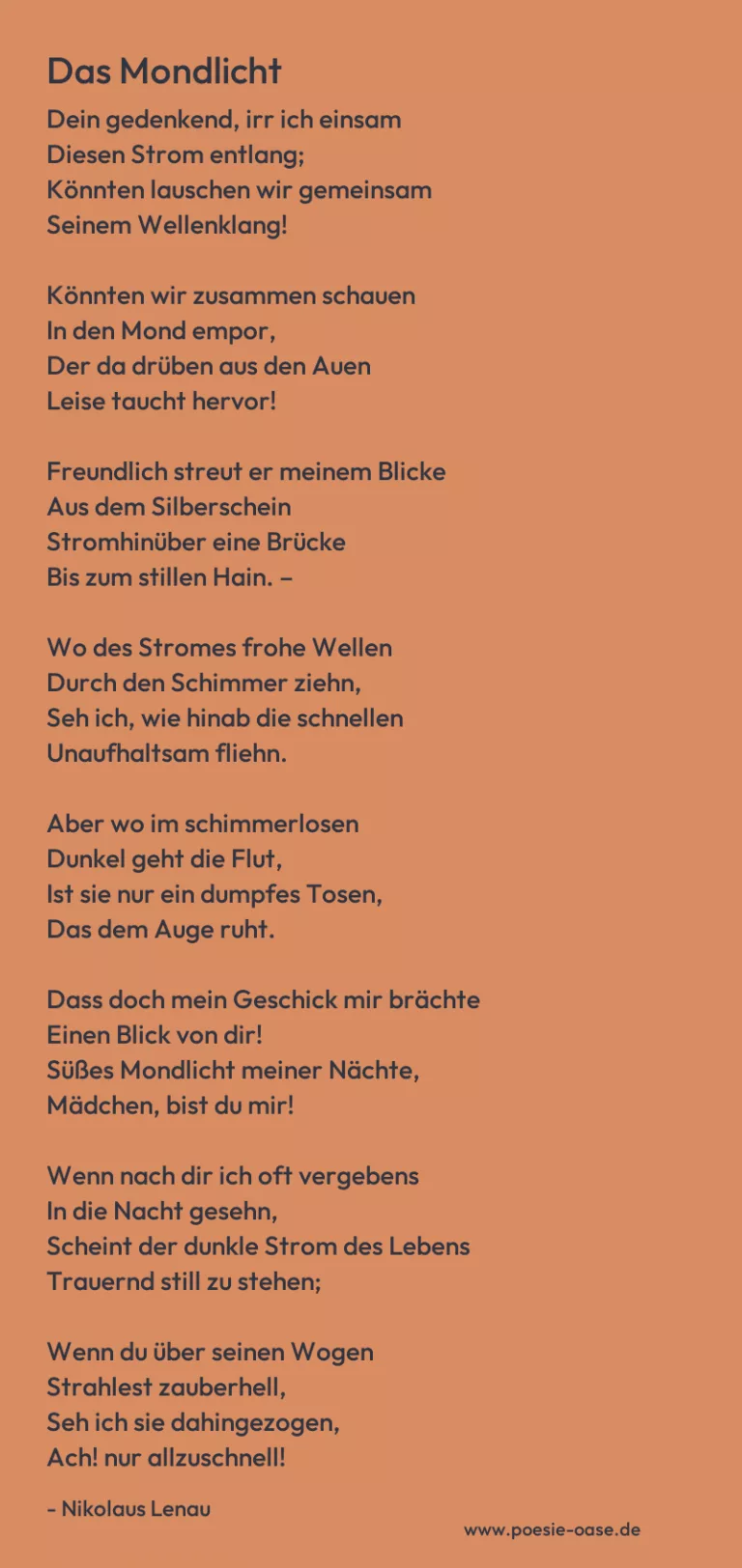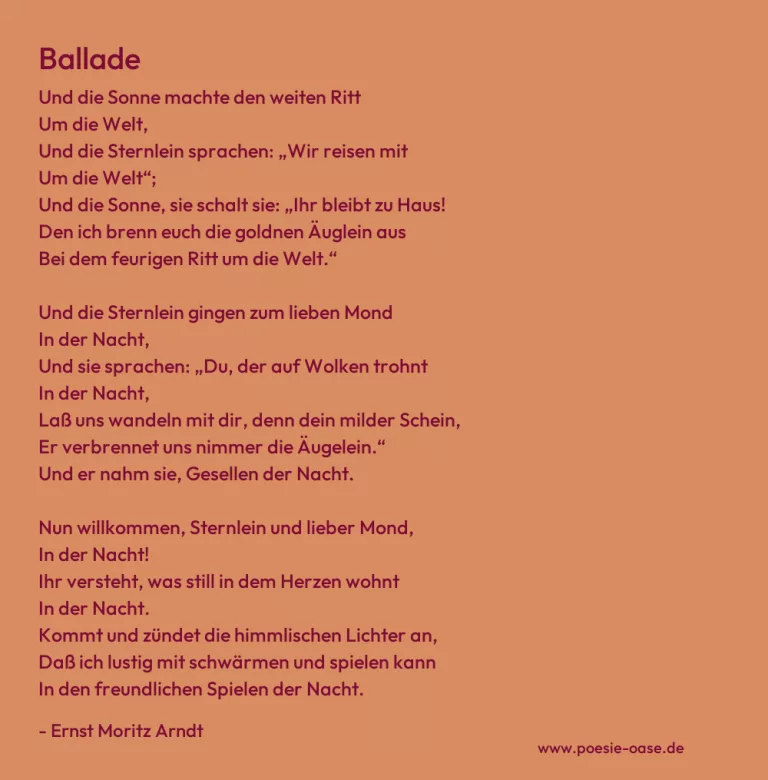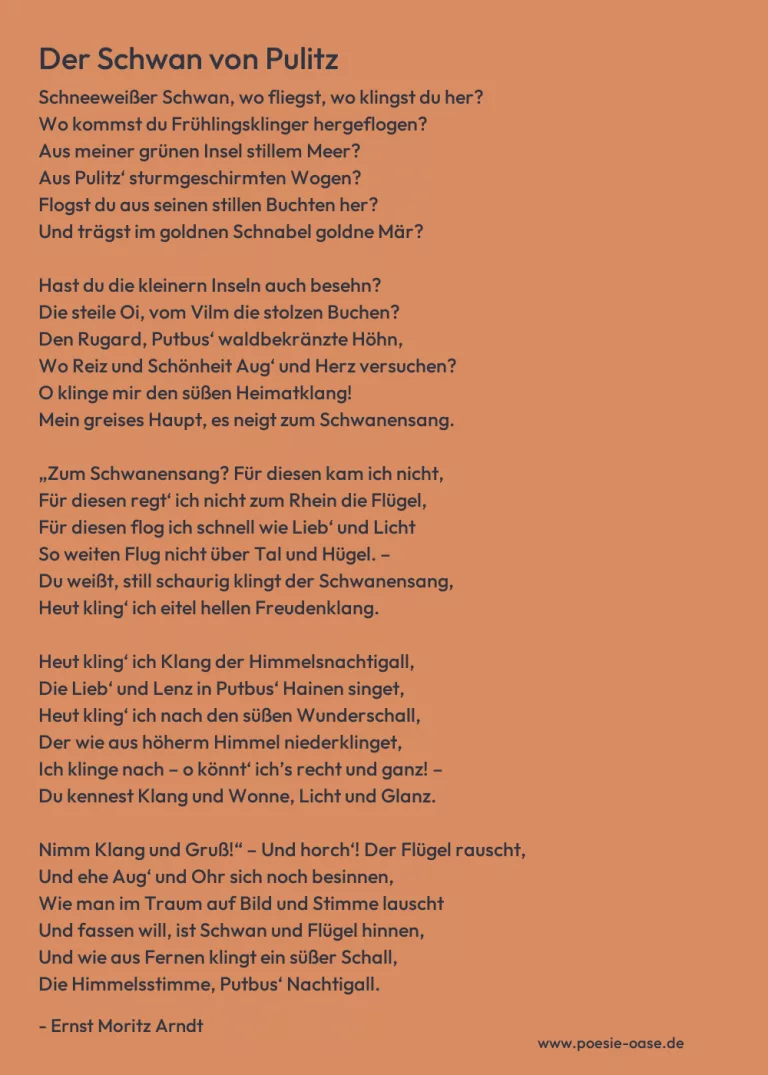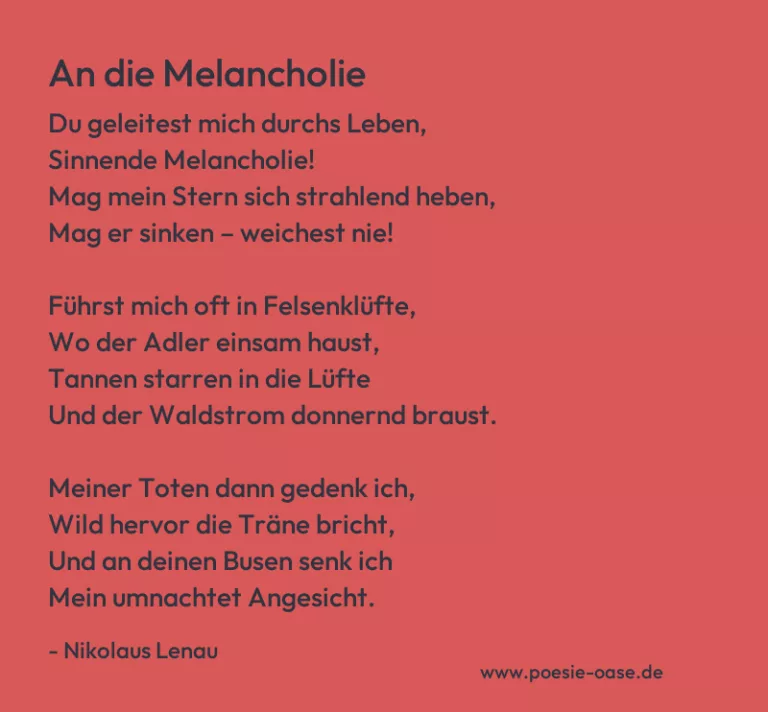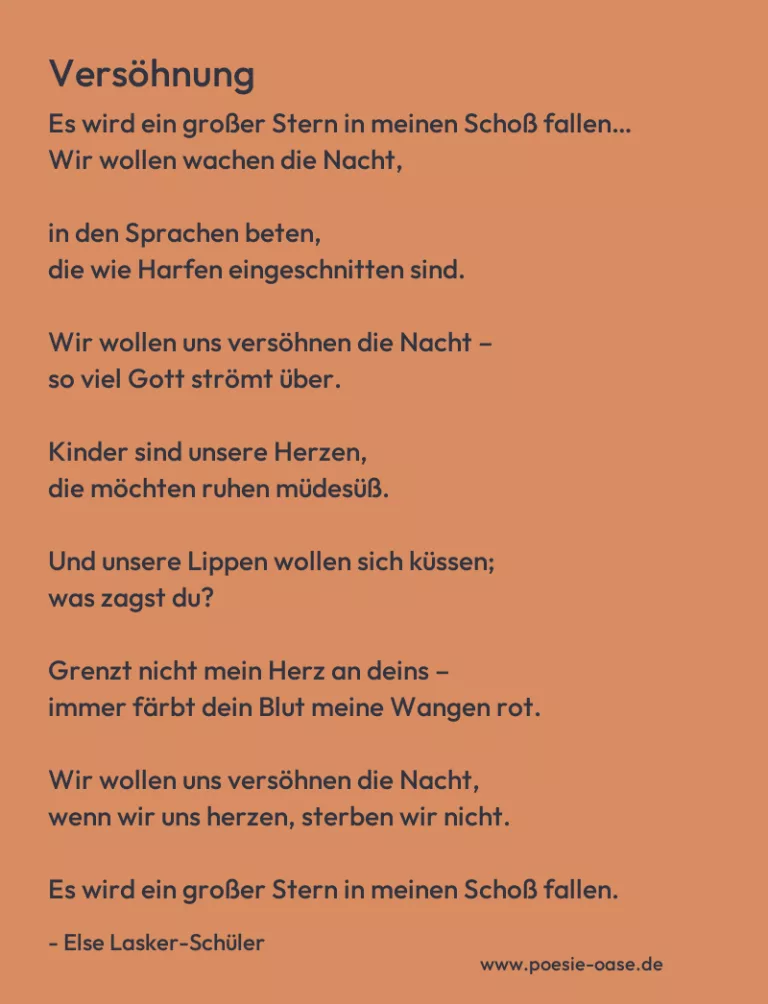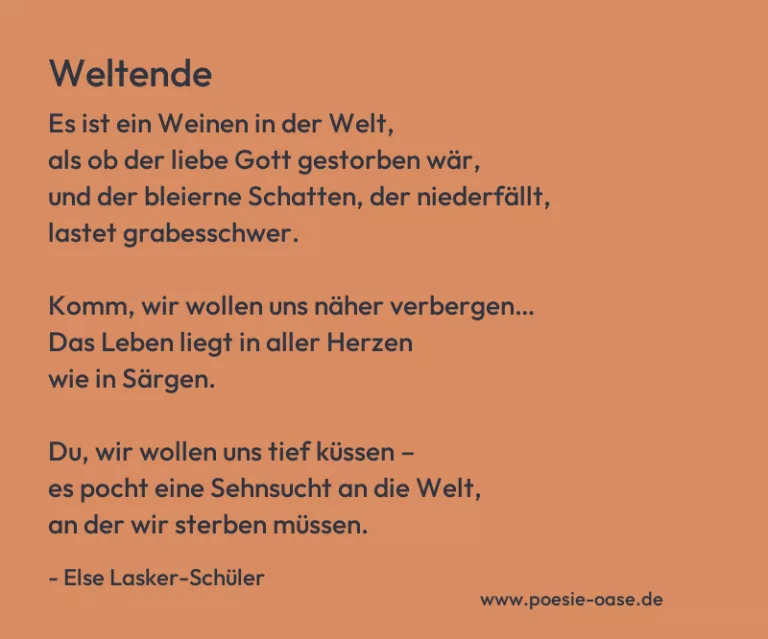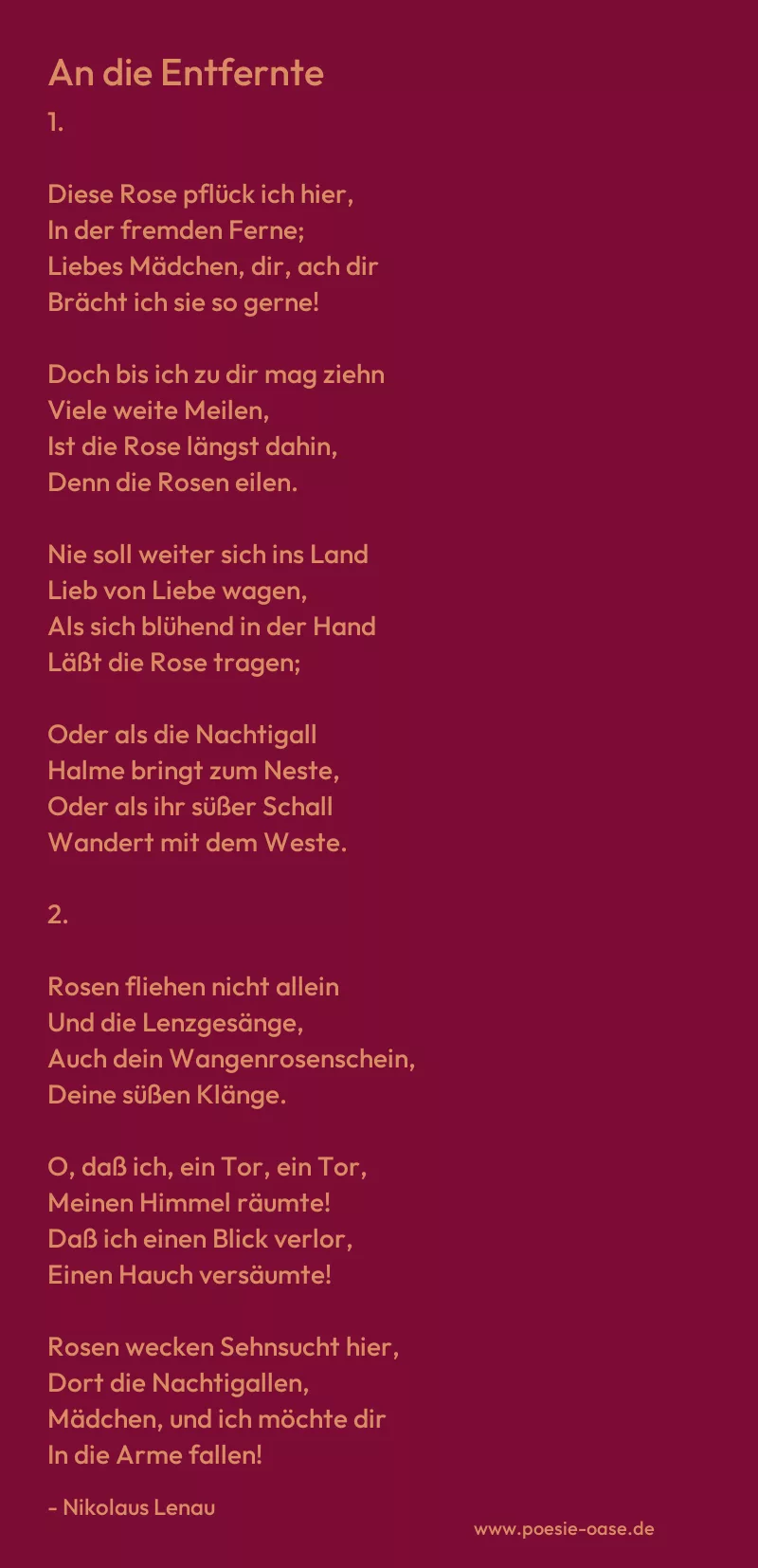An die Entfernte
1.
Diese Rose pflück ich hier,
In der fremden Ferne;
Liebes Mädchen, dir, ach dir
Brächt ich sie so gerne!
Doch bis ich zu dir mag ziehn
Viele weite Meilen,
Ist die Rose längst dahin,
Denn die Rosen eilen.
Nie soll weiter sich ins Land
Lieb von Liebe wagen,
Als sich blühend in der Hand
Läßt die Rose tragen;
Oder als die Nachtigall
Halme bringt zum Neste,
Oder als ihr süßer Schall
Wandert mit dem Weste.
2.
Rosen fliehen nicht allein
Und die Lenzgesänge,
Auch dein Wangenrosenschein,
Deine süßen Klänge.
O, daß ich, ein Tor, ein Tor,
Meinen Himmel räumte!
Daß ich einen Blick verlor,
Einen Hauch versäumte!
Rosen wecken Sehnsucht hier,
Dort die Nachtigallen,
Mädchen, und ich möchte dir
In die Arme fallen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
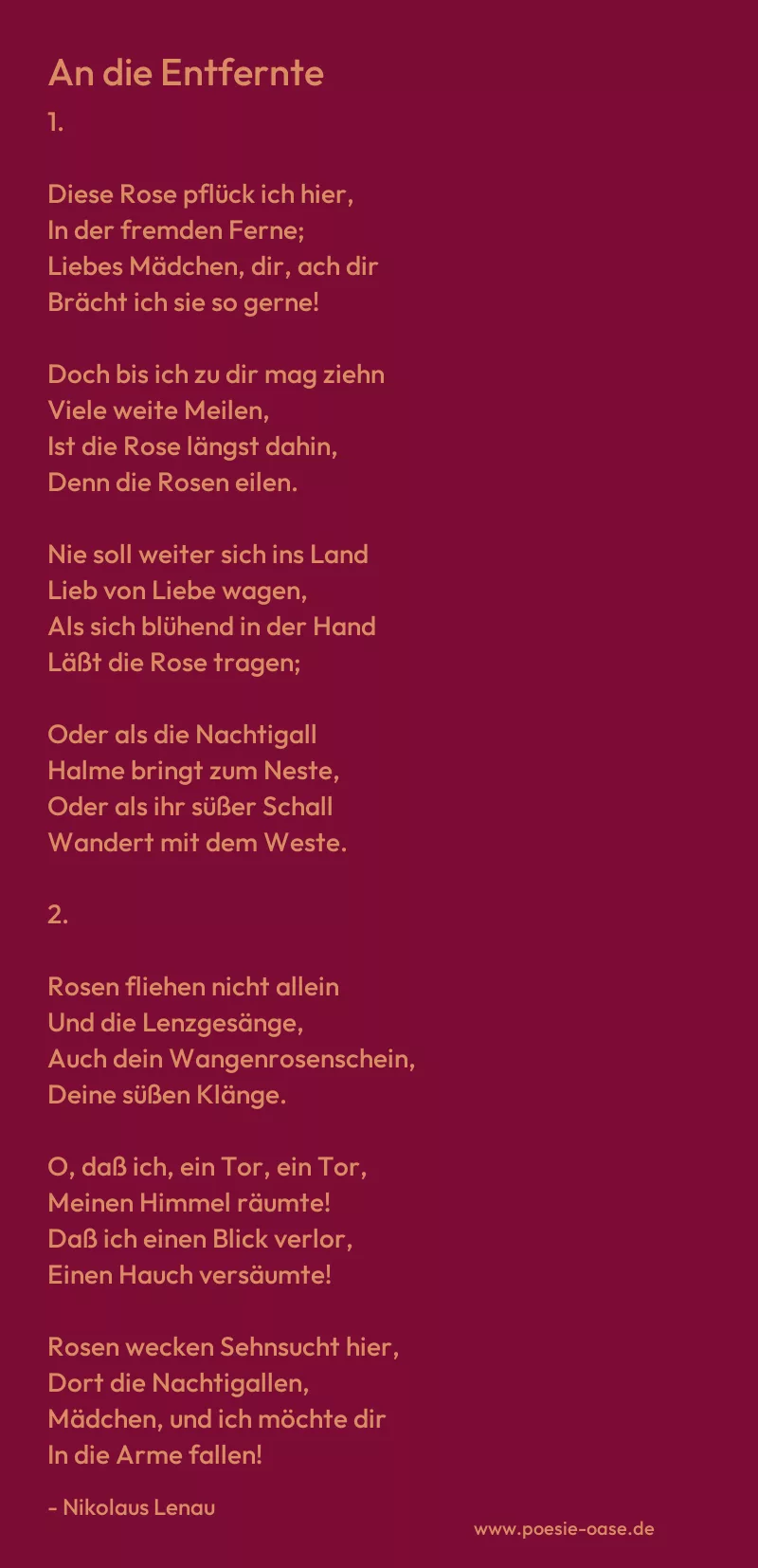
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An die Entfernte“ von Nikolaus Lenau handelt von der Sehnsucht und dem Schmerz der Trennung. Im ersten Teil des Gedichts symbolisiert die Rose das unerreichbare Ziel der Liebe. Der Sprecher pflückt die Rose „in der fremden Ferne“ und möchte sie dem geliebten Mädchen bringen, doch die „viele weite Meilen“ hindern ihn daran, rechtzeitig anzukommen, sodass die Rose „längst dahin“ ist, bevor er sie überreichen kann. Diese Zeitverschiebung und Entfernung verdeutlichen die Vergänglichkeit von Momenten der Nähe und das vergebliche Streben nach etwas Unerreichbarem.
Das Bild der Rose ist nicht nur ein Symbol der Liebe, sondern auch der Eile und Vergänglichkeit. Die Rose, die schnell verwelkt, wird hier als Metapher für die flüchtigen Momente der Liebe und der jugendlichen Schönheit verwendet. In den weiteren Versen wird diese Vergänglichkeit durch die Rosen, die „eilen“, und die Nachtigall, die „süßen Schall“ über den Wind trägt, verstärkt. Der Gedichtteil über das Land, in dem sich Liebe nicht weiter „wagen“ soll, suggeriert eine Zurückhaltung, das Überstreben nach Liebe in der Ferne oder in der Zukunft zu verhindern. Hier wird ein realistischer Blick auf die Grenzen menschlicher Wünsche und Möglichkeiten geworfen.
Im zweiten Teil des Gedichts spricht der Sprecher seine eigene Unzufriedenheit aus. Er bedauert, dass er in der Vergangenheit nicht in der Lage war, das, was ihm am meisten am Herzen liegt, richtig zu schätzen oder zu bewahren. Die „Wangenrosen“ und „süßen Klänge“ der geliebten Person werden zu Symbolen für das Verpassen von Chancen und die tiefe Sehnsucht nach einer Verbindung, die nicht mehr möglich scheint. Der Ausdruck „ein Tor, ein Tor“ weist auf die Selbstvorwürfe des Sprechers hin, der sich als töricht empfindet, einen Blick oder einen Hauch, der seine Liebe bestärkt hätte, verpasst zu haben.
Die letzte Strophe verstärkt den Wunsch des Sprechers nach Nähe und Zuneigung. Die „Rosen“ und „Nachtigallen“ wecken bei ihm eine Sehnsucht, die ihn dazu treibt, der geliebten Person „in die Arme zu fallen“. Die Naturbilder – die fliehenden Rosen und die wandernden Nachtigallen – sind mit einer inneren Bewegung des Sprechers verbunden, der nach einer Erfüllung seiner Sehnsucht strebt. Es entsteht ein starkes Bild der unerfüllten Liebe und der Hoffnung auf eine Nähe, die so weit entfernt bleibt wie die „fremde Ferne“.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.