Siehst du den Meister? Er spuckt! Nun hat er, was ihn begeistert,
Wenn er den Auswurf kopiert, tut er der Schule genug.
Greift dann gar der Beschauer mit einem Pfui! zum Schnupftuch,
Weil er für wirklichen Schmutz diesen artistischen hält:
O, dann feiert die Richtung den höchsten ihrer Triumphe,
Und der Künstler verlangt, daß man, wie Zeuxis, ihn ehrt.
Niederländische Schule
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
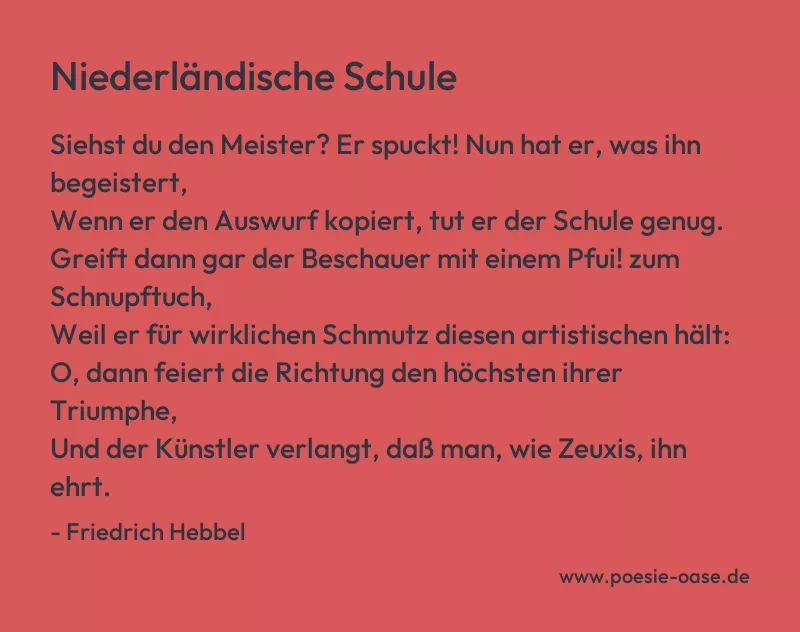
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Niederländische Schule“ von Friedrich Hebbel ist eine bissige Satire auf die Kunstpraxis und die Rezeption der niederländischen Malerei. Es kritisiert sowohl die Künstler selbst als auch das Publikum, das diese Kunst entweder produziert oder konsumiert. Hebbels Gedicht ist durchzogen von Ironie und einer subtilen, aber deutlichen Kritik an dem, was er als mangelnde künstlerische Qualität und oberflächliche Wertschätzung wahrnimmt.
Der erste Teil des Gedichts fokussiert sich auf den Künstler. Die Metapher des „Spuckens“ ist der Ausgangspunkt und deutet auf eine abwertende Weise auf die Schaffung des Kunstwerks hin. Der Künstler ist nicht inspiriert, sondern produziert etwas, das er „kopiert“ und das anscheinend wertlos ist. Der Künstler reproduziert einfach etwas, was er zuvor ausgespuckt hat, was darauf hindeutet, dass seine Arbeit keine echte künstlerische Leistung darstellt, sondern lediglich eine Wiederholung des Vorhandenen ist. Der Ausdruck „tut er der Schule genug“ verstärkt diese Kritik, indem er die Konventionen und Erwartungen der „Schule“ verspottet, was auf eine akademische Tradition hinweist, die mehr Wert auf Technik als auf Kreativität legt.
Der zweite Teil des Gedichts wendet sich dem Betrachter zu. Die Reaktion des „Beschauers“ mit dem „Pfui!“ und dem Schnupftuch deutet auf eine negative Bewertung des Kunstwerks hin. Der Betrachter verwechselt das, was der Künstler geschaffen hat, mit „wirklichen Schmutz“. Doch ironischerweise feiert die „Richtung“ gerade diesen „Schmutz“ als „höchsten ihrer Triumphe“. Die Ironie liegt darin, dass die Kunstrichtung, die Hebbel kritisiert, genau dann ihren größten Erfolg feiert, wenn das Publikum die Kunst als abstoßend empfindet.
Die abschließende Zeile mit der Referenz zu Zeuxis, einem antiken griechischen Maler, der angeblich für seine täuschend realistische Darstellung von Früchten berühmt war, vertieft die Ironie. Der Künstler verlangt nun, „daß man, wie Zeuxis, ihn ehrt.“ Dies unterstreicht die Verachtung des Künstlers für wahre Schönheit und Kunstfertigkeit, da er sich mit einem Maler vergleicht, dessen Kunst vor allem durch ihre Illusionstechnik beeindruckte. Hebbel kritisiert hier die oberflächliche Bewertung der Kunst und das Fehlen eines tieferen Verständnisses für künstlerische Werte. Das Gedicht dient somit als eine beißende Kritik an der Kunstwelt und den darin enthaltenen Scheinheiligkeiten.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
