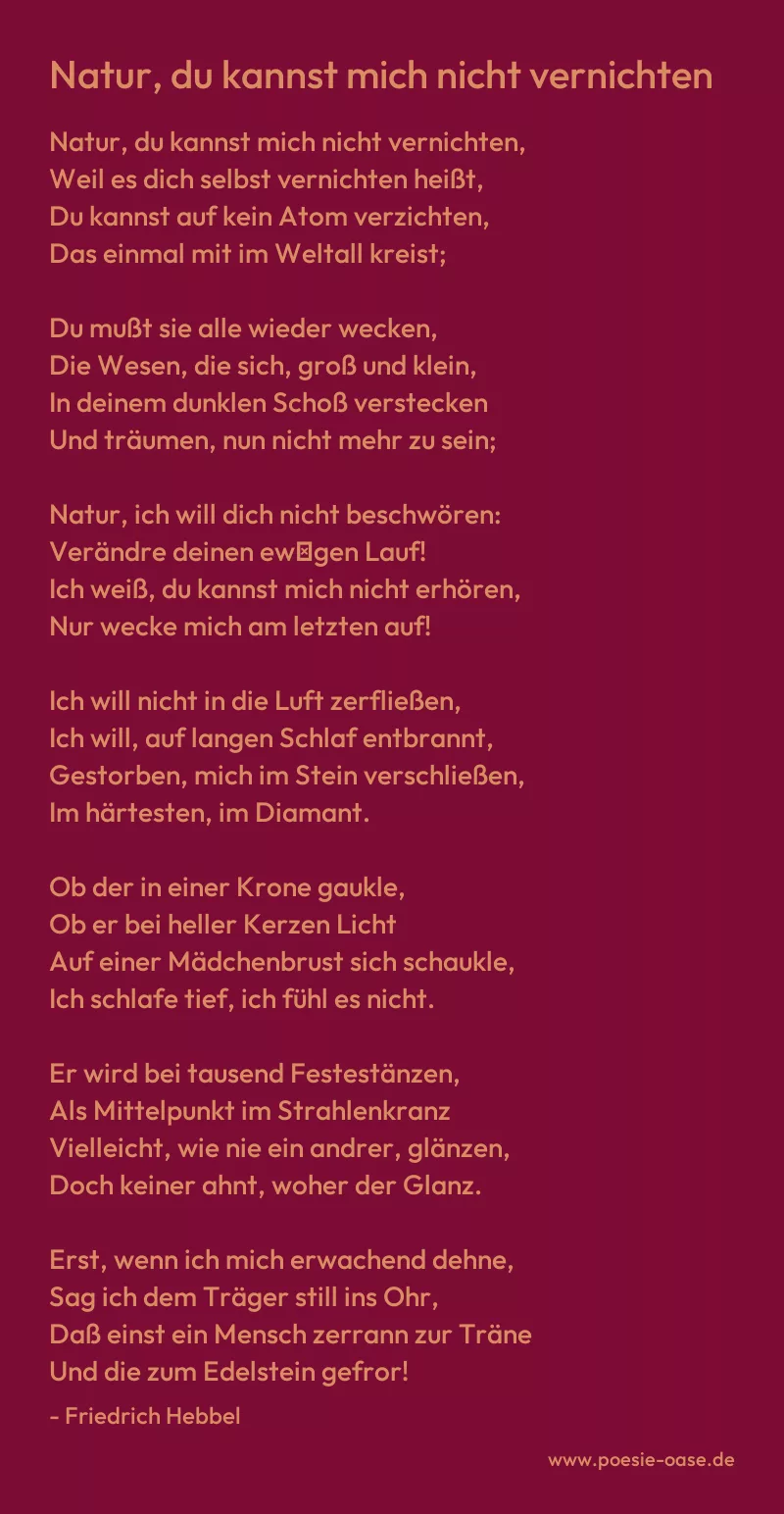Natur, du kannst mich nicht vernichten,
Weil es dich selbst vernichten heißt,
Du kannst auf kein Atom verzichten,
Das einmal mit im Weltall kreist;
Du mußt sie alle wieder wecken,
Die Wesen, die sich, groß und klein,
In deinem dunklen Schoß verstecken
Und träumen, nun nicht mehr zu sein;
Natur, ich will dich nicht beschwören:
Verändre deinen ew′gen Lauf!
Ich weiß, du kannst mich nicht erhören,
Nur wecke mich am letzten auf!
Ich will nicht in die Luft zerfließen,
Ich will, auf langen Schlaf entbrannt,
Gestorben, mich im Stein verschließen,
Im härtesten, im Diamant.
Ob der in einer Krone gaukle,
Ob er bei heller Kerzen Licht
Auf einer Mädchenbrust sich schaukle,
Ich schlafe tief, ich fühl es nicht.
Er wird bei tausend Festestänzen,
Als Mittelpunkt im Strahlenkranz
Vielleicht, wie nie ein andrer, glänzen,
Doch keiner ahnt, woher der Glanz.
Erst, wenn ich mich erwachend dehne,
Sag ich dem Träger still ins Ohr,
Daß einst ein Mensch zerrann zur Träne
Und die zum Edelstein gefror!