Wie vor Varus, den Römer, so trat im geknechteten Deutschland
Vor Napoleon auch mahnend die Nemesis hin.
Hätt′ er den Jüngling verstanden, der, ohne zu zittern, das Leben
Vor die Füße im warf, als er′s ihm wieder geschenkt:
Nimmer hätt′ es der Völker bedurft, ihm die Lehre zu geben,
Daß der germanische Geist immer den sittlichen rächt.
Napoleon und Staps
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
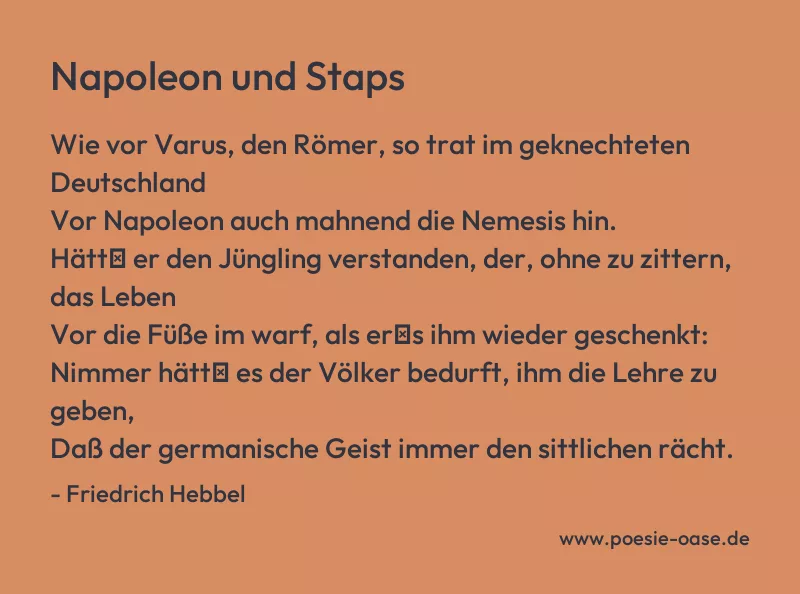
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Napoleon und Staps“ von Friedrich Hebbel ist eine Reflexion über Macht, Moral und das tragische Scheitern Napoleons. Es präsentiert eine Szene, in der der Attentäter Staps, ein junger Deutscher, vor Napoleon tritt und ein Attentat auf ihn plant, welches jedoch scheitert. Das Gedicht nutzt diese historische Begebenheit, um eine tiefere moralische Aussage zu treffen.
Die zentrale Metapher des Gedichts ist die Nemesis, die Göttin der Vergeltung im antiken Griechenland. Sie steht als mahnende Figur im Gedicht und weist auf die moralische Ordnung hin, die Napoleon zu missachten droht. Die Erwähnung von Varus, einem römischen Feldherrn, dessen Niederlage in der Schlacht im Teutoburger Wald als Anspielung dient, verdeutlicht, dass die Geschichte sich wiederholt und dass Hochmut und Tyrannei unweigerlich zu Fall führen. Staps, der junge Attentäter, wird als eine Art „Nemesis im Kleinen“ dargestellt, ein Vertreter des germanischen Geistes, der sich gegen die Fremdherrschaft Napoleons auflehnt.
Hebbel betont in seinem Gedicht die moralische Dimension des Konflikts. Staps, der sein Leben für seine Überzeugung riskiert, wird als Beispiel für den germanischen Geist dargestellt, der sich nicht von Macht oder Gewalt einschüchtern lässt. Die Zeile „Hätt‘ er den Jüngling verstanden, der, ohne zu zittern, das Leben / Vor die Füße warf, als er’s ihm wieder geschenkt:“ deutet an, dass Napoleon eine Chance hatte, die tiefere Bedeutung des Widerstands zu verstehen. Wenn Napoleon die Hingabe und den Idealismus des jungen Staps hätte würdigen können, so die implizite Botschaft, hätte er das Schicksal des späteren Krieges möglicherweise wenden können.
Das Gedicht gipfelt in der Erkenntnis, dass der „germanische Geist“ immer die „sittliche“ Ordnung rächen wird. Diese Aussage ist von großer Bedeutung, da sie die Überzeugung des Autors widerspiegelt, dass moralische Prinzipien letztendlich über militärische und politische Macht triumphieren. Das Scheitern Napoleons wird somit nicht nur als militärische Niederlage interpretiert, sondern als ein Versagen in moralischer Hinsicht. Das Gedicht ist eine Mahnung an Herrscher, die Bedeutung von Moral und sittlicher Ordnung nicht zu unterschätzen, denn diese sind langfristig mächtiger als militärische Stärke.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
