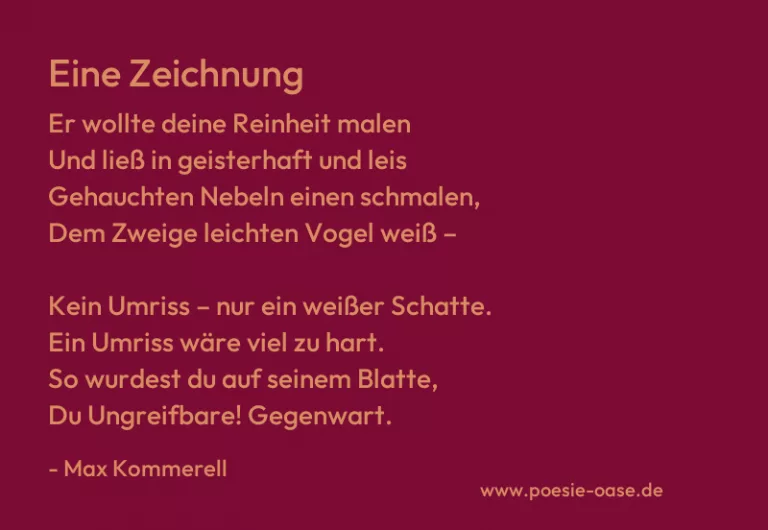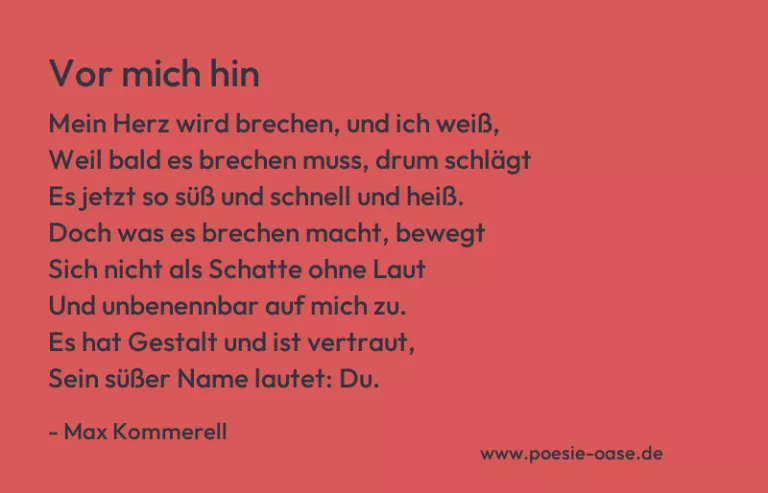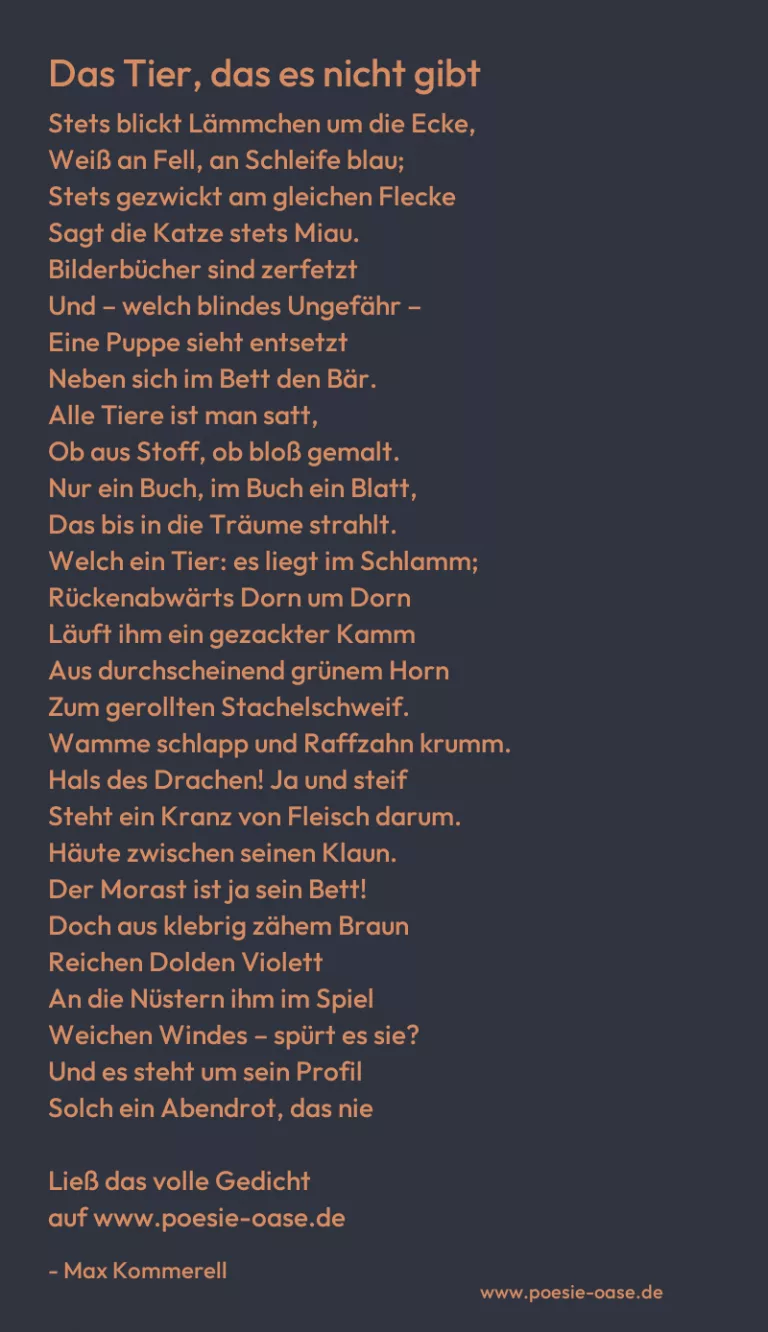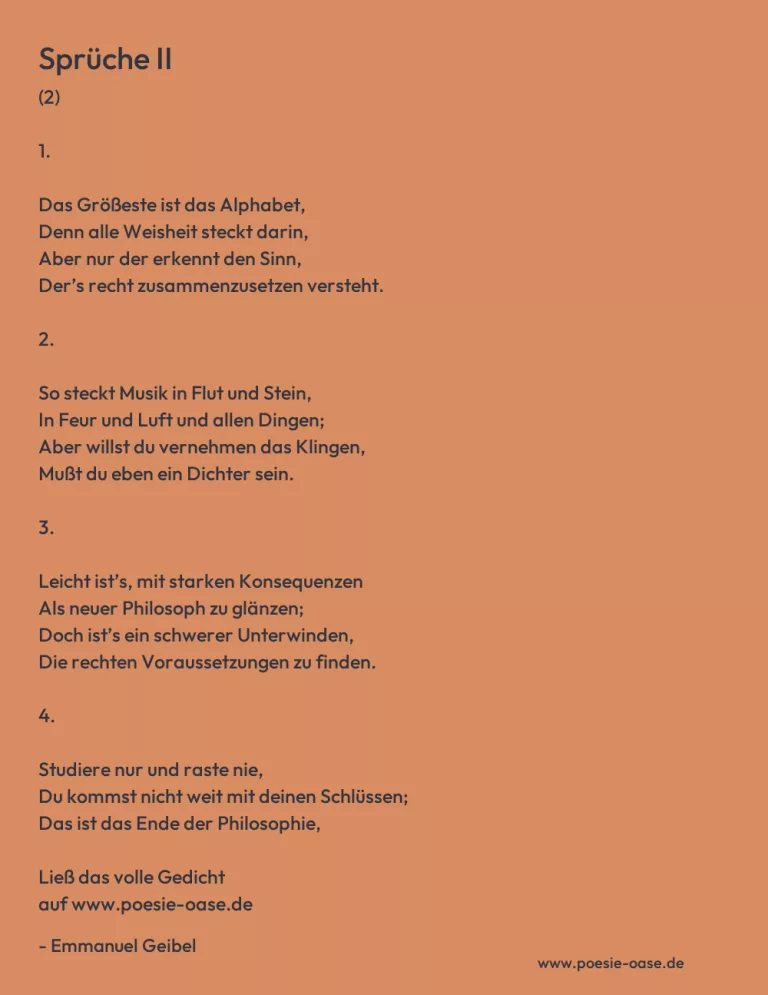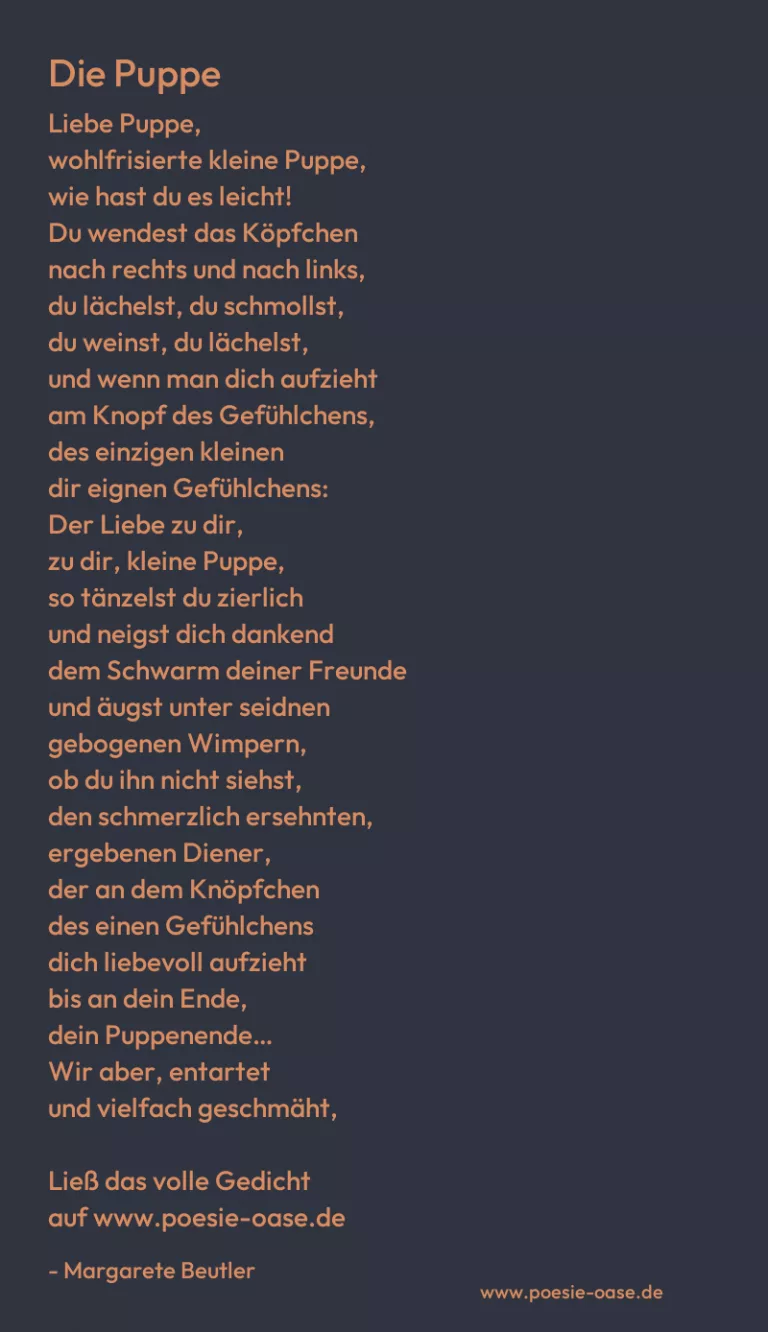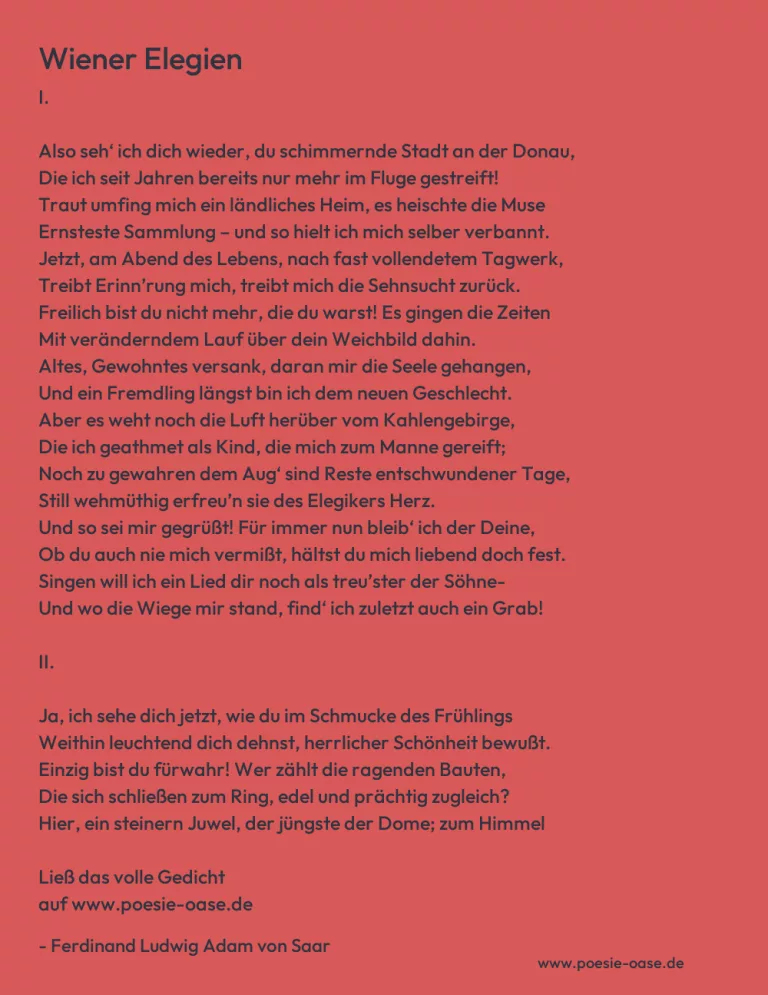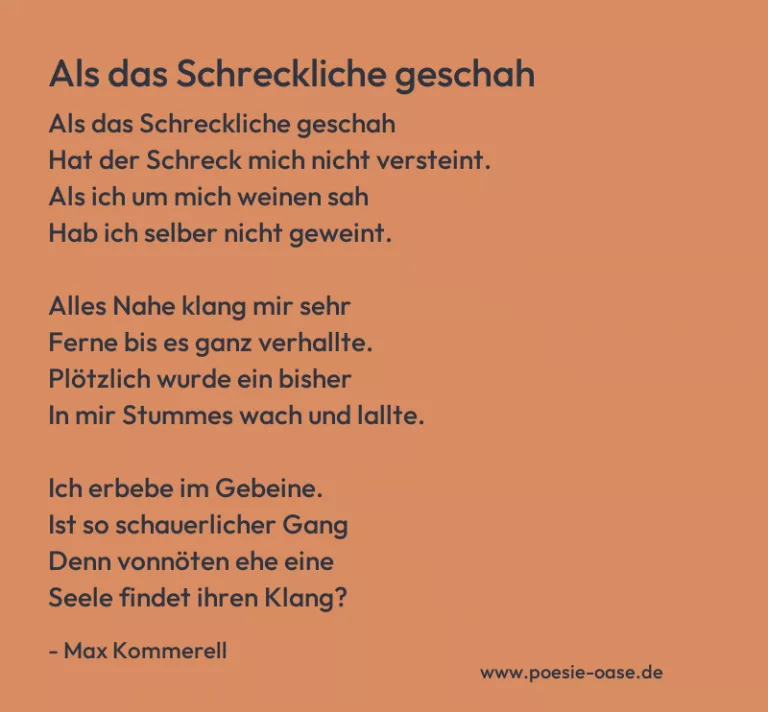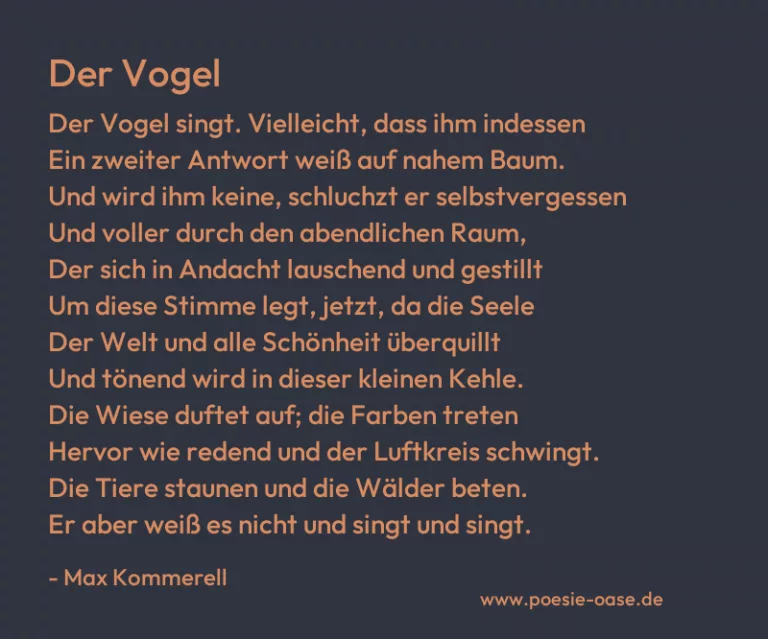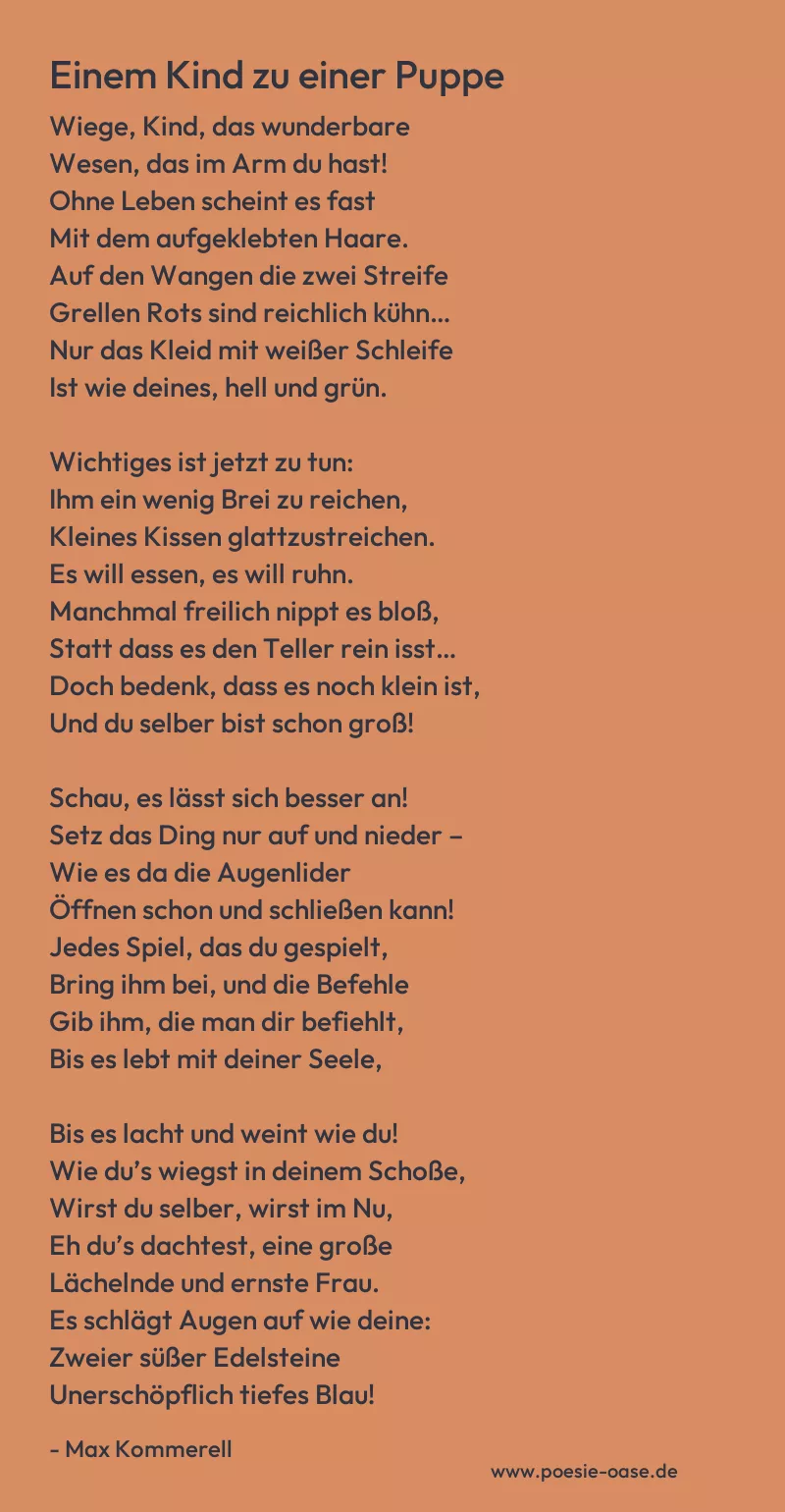Einem Kind zu einer Puppe
Wiege, Kind, das wunderbare
Wesen, das im Arm du hast!
Ohne Leben scheint es fast
Mit dem aufgeklebten Haare.
Auf den Wangen die zwei Streife
Grellen Rots sind reichlich kühn…
Nur das Kleid mit weißer Schleife
Ist wie deines, hell und grün.
Wichtiges ist jetzt zu tun:
Ihm ein wenig Brei zu reichen,
Kleines Kissen glattzustreichen.
Es will essen, es will ruhn.
Manchmal freilich nippt es bloß,
Statt dass es den Teller rein isst…
Doch bedenk, dass es noch klein ist,
Und du selber bist schon groß!
Schau, es lässt sich besser an!
Setz das Ding nur auf und nieder –
Wie es da die Augenlider
Öffnen schon und schließen kann!
Jedes Spiel, das du gespielt,
Bring ihm bei, und die Befehle
Gib ihm, die man dir befiehlt,
Bis es lebt mit deiner Seele,
Bis es lacht und weint wie du!
Wie du’s wiegst in deinem Schoße,
Wirst du selber, wirst im Nu,
Eh du’s dachtest, eine große
Lächelnde und ernste Frau.
Es schlägt Augen auf wie deine:
Zweier süßer Edelsteine
Unerschöpflich tiefes Blau!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
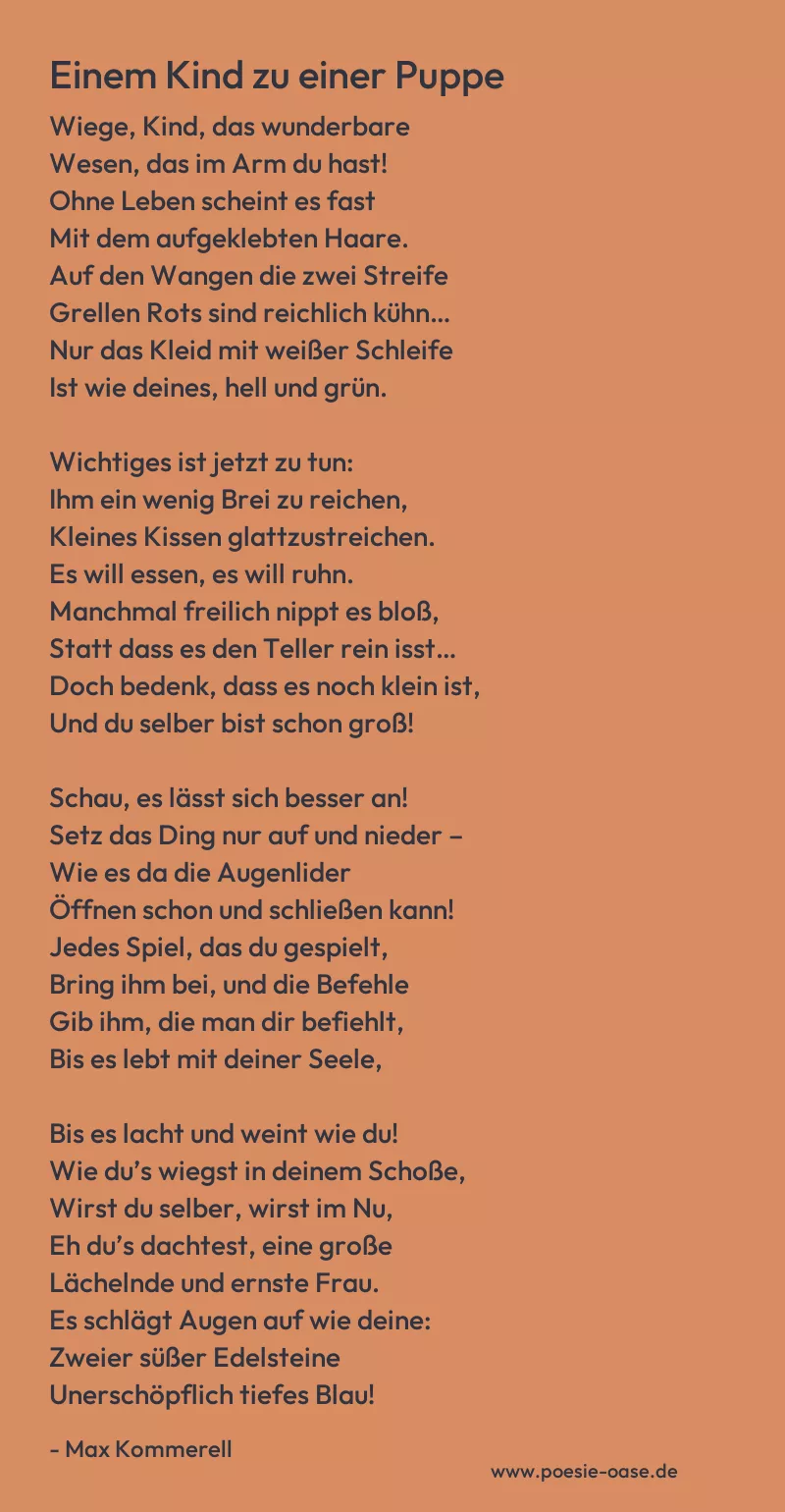
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Einem Kind zu einer Puppe“ von Max Kommerell beschäftigt sich mit der kindlichen Vorstellungskraft, der Erziehung und der Entwicklung des Selbstbewusstseins. In der ersten Strophe wird das Kind aufgefordert, seine Puppe zu wiegen und sich um sie zu kümmern. Die Puppe wird dabei als fast lebloses Wesen beschrieben – „ohne Leben scheint es fast“ –, was ihre künstliche Natur und die kindliche Projektion von Leben auf sie betont. Das Kind sieht in der Puppe ein „wunderbares Wesen“, das durch einfache Handlungen wie Füttern und Zudecken belebt wird, wobei die „weiße Schleife“ und das „hell und grün“ Kleid eine Ähnlichkeit zur kindlichen Kleidung widerspiegeln, was die Identifikation und Verbindung des Kindes zur Puppe verstärkt.
Die zweite Strophe zeigt die kindliche Fürsorge und das Spiel mit Verantwortung. Das Kind „reicht“ der Puppe Brei, streicht ihr Kissen glatt und ist damit beschäftigt, die Puppe wie ein echtes Kind zu behandeln. Die Puppe wird hier mit einem echten Kind verglichen, indem ihre „Verhaltensweisen“ als kindlich (wie das Nippen statt richtigem Essen) beschrieben werden. Es wird jedoch auch betont, dass die Puppe noch nicht „groß“ ist und daher nicht dieselben Erwartungen erfüllen kann. Die Differenzierung zwischen dem Kind und der Puppe wird durch den Hinweis auf das „klein“ sein und das „groß“ werden des Kindes verdeutlicht, was eine Reflexion über das Wachstum und die Verantwortung als Bestandteil des Erwachsenwerdens ist.
Die dritte Strophe vertieft das Spiel zwischen dem Kind und seiner Puppe, wobei die Handlung mit der Vorstellung von Leben und Tod, von Spiel und Wirklichkeit verwoben ist. Das Kind setzt die Puppe „auf und nieder“ und beobachtet, wie sie „die Augenlider öffnet und schließen kann“. Die Vorstellung, dass die Puppe durch das Spielen und das Erlernen von Befehlen „lebt“, spiegelt das kindliche Bedürfnis wider, Kontrolle über die eigene Welt auszuüben und der Puppe eine eigene „Seele“ zu verleihen. Der Übergang von „Lebensweisheiten“ (die das Kind selbst erlernt hat) hin zu einem lebendigen Wesen symbolisiert die kindliche Vorstellungskraft, die der Puppe Leben einhaucht, und den Wunsch nach einer tiefen Verbindung zwischen dem Kind und der Puppe.
Die letzte Strophe zeigt, wie die kindliche Vorstellung von der Puppe sich weiter entfaltet, und die Puppe „lebt mit deiner Seele“. Das Kind wächst in seiner Fürsorge und erlernt durch das Spiel und die Pflege eine eigene Form des Erwachsenwerdens. Das Bild der „lächelnden und ernsten Frau“ ist eine Metapher für den Übergang von der kindlichen Unschuld zur Reife und Verantwortung. Der Moment, in dem die Puppe „Augen auf“ schlägt, wird als ein aktiver Prozess des Erwachsenwerdens und der Identitätsfindung verstanden. In diesem Moment der „Edelsteine“, die das „tiefe Blau“ der Augen widerspiegeln, wird eine Idee von unerschöpflichem Wissen und tiefer Einsicht angedeutet, die der kindlichen Welt erwachsen und reif gegenübersteht.
Kommerell verwendet in diesem Gedicht die Puppe als Symbol für das Kind selbst, für die Entwicklung, die Fürsorge und die Unterscheidung zwischen Spiel und Realität. Das Gedicht vermittelt den Übergang von der kindlichen Welt des Spiels zur realen, erwachsenen Welt und zeigt auf, wie das Kind durch das Spielen mit der Puppe sowohl seine eigenen Bedürfnisse als auch das Erwachsenwerden versteht und in die Verantwortung hineinwächst.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.