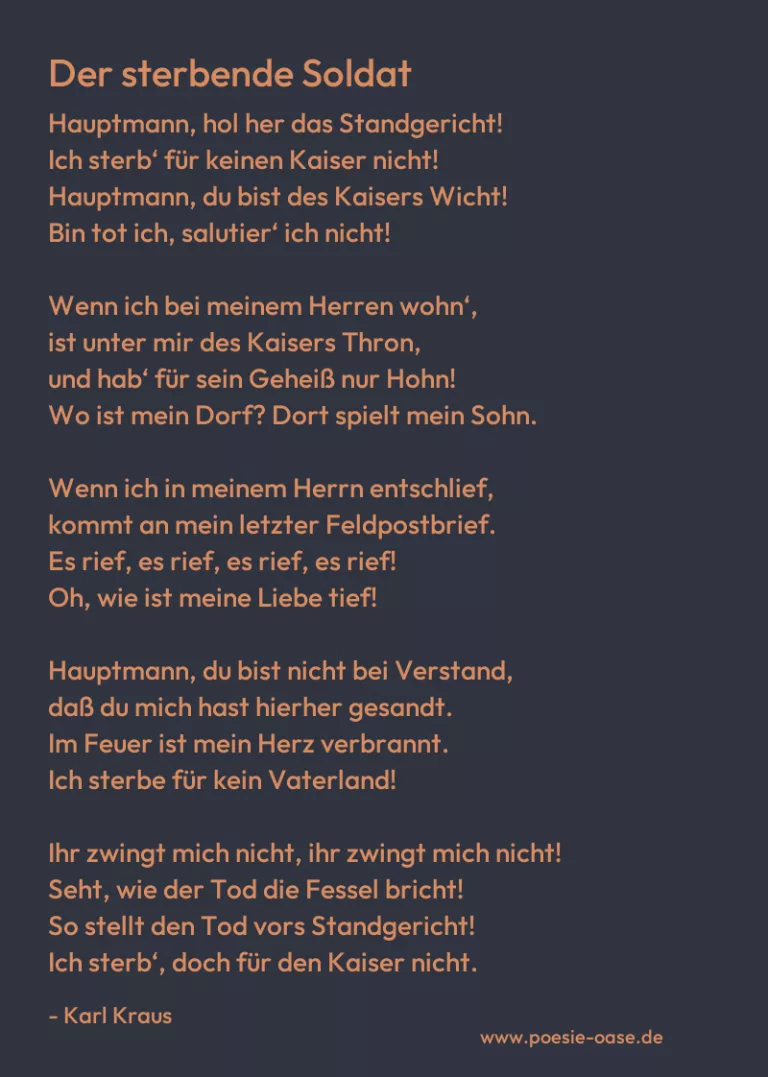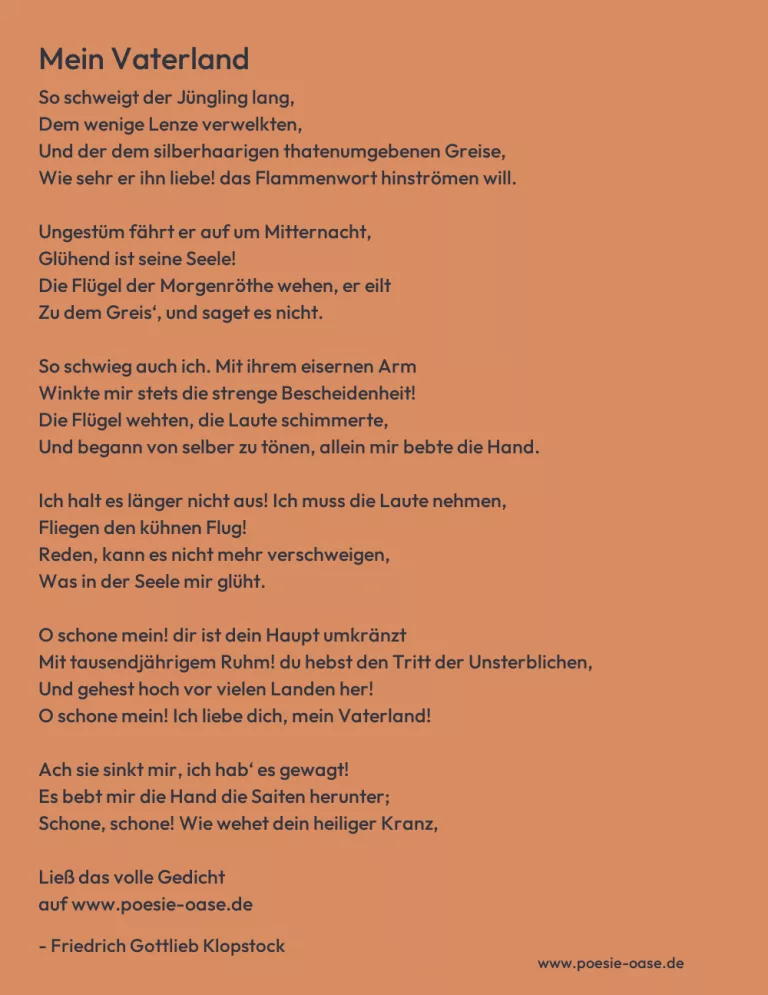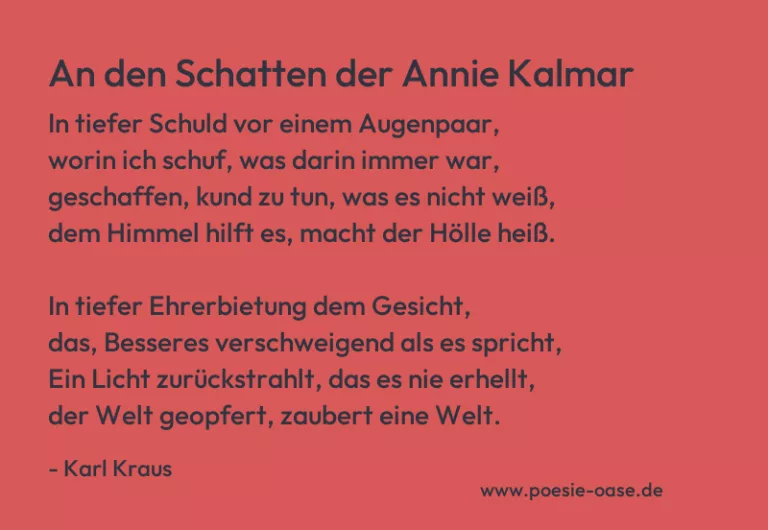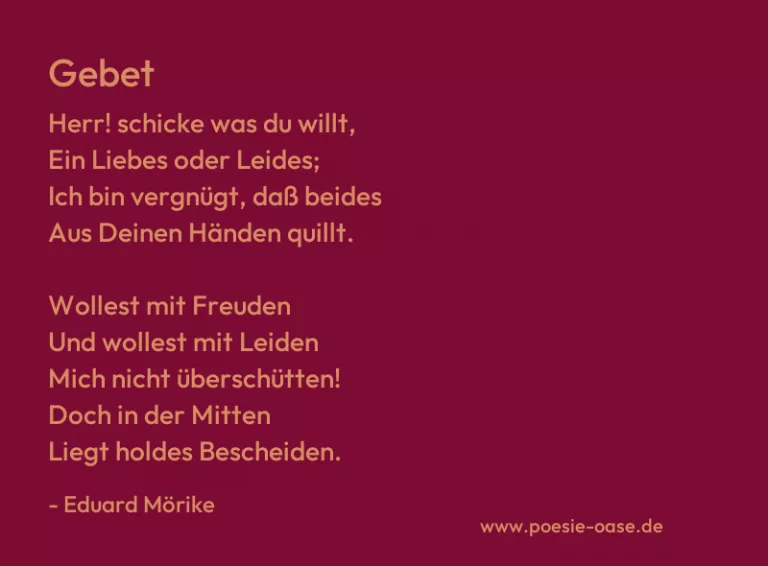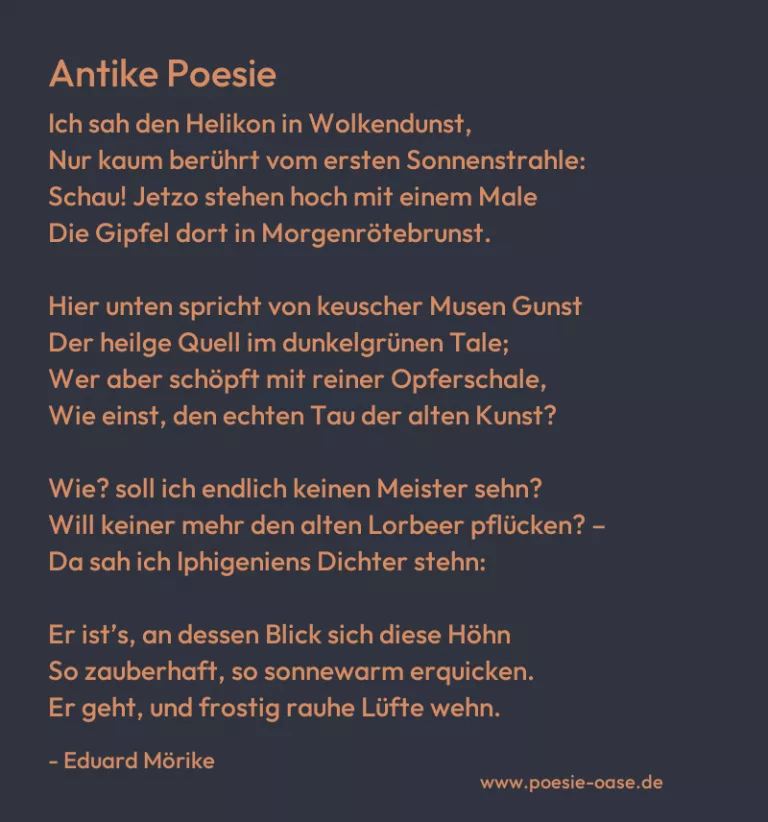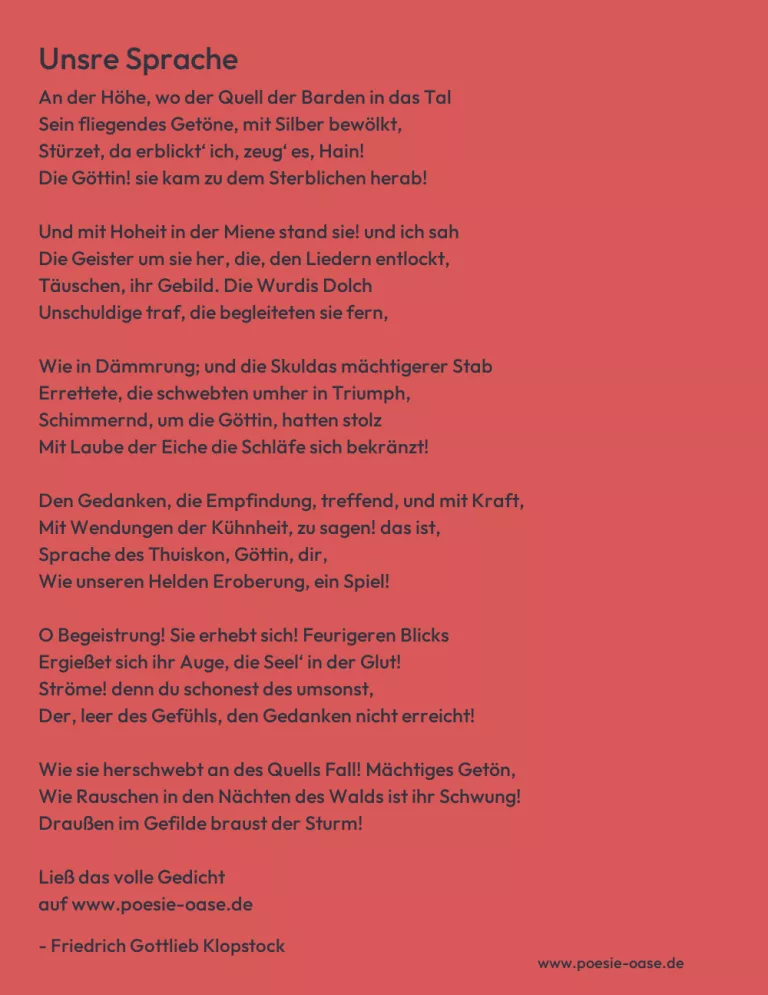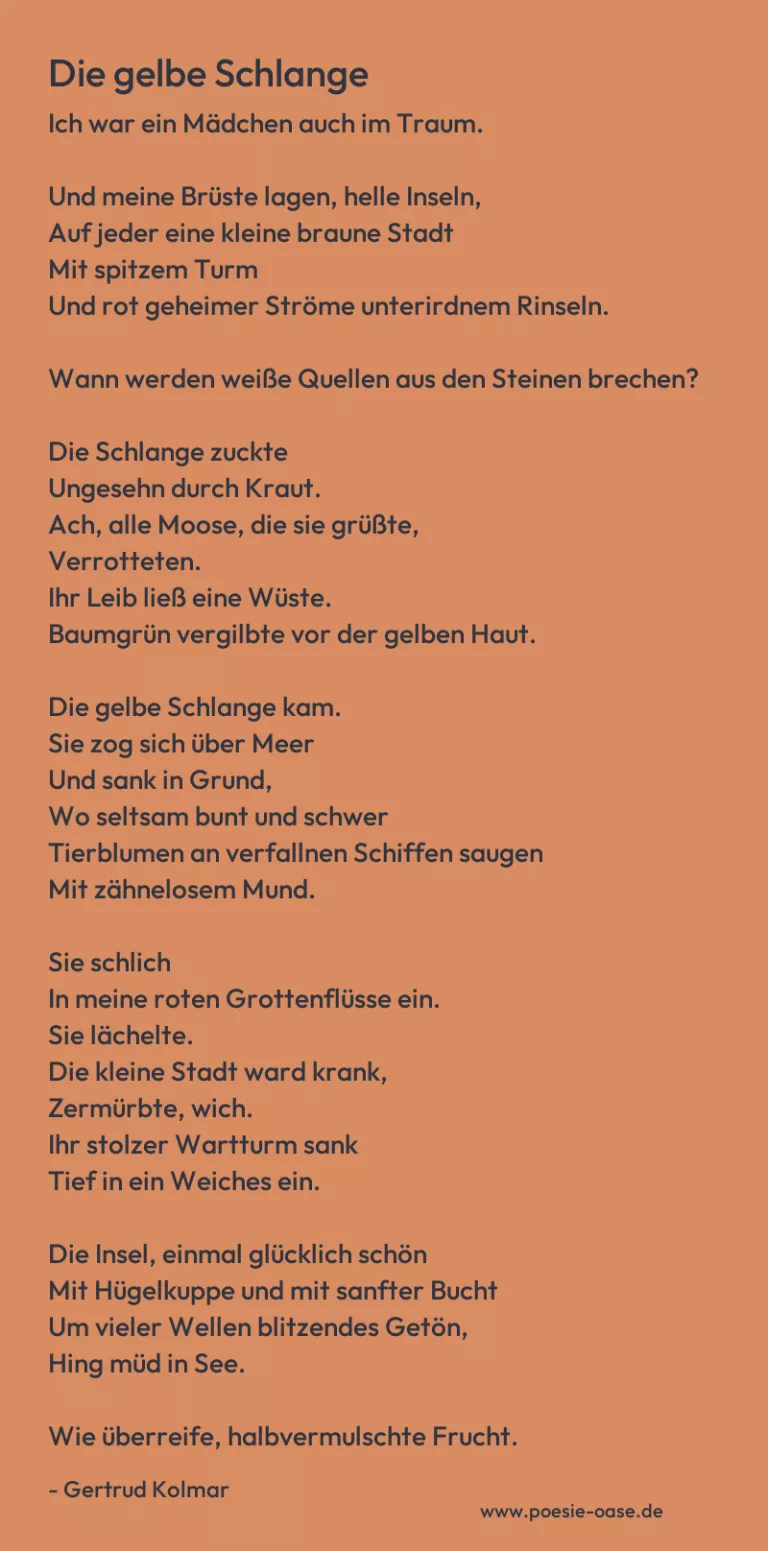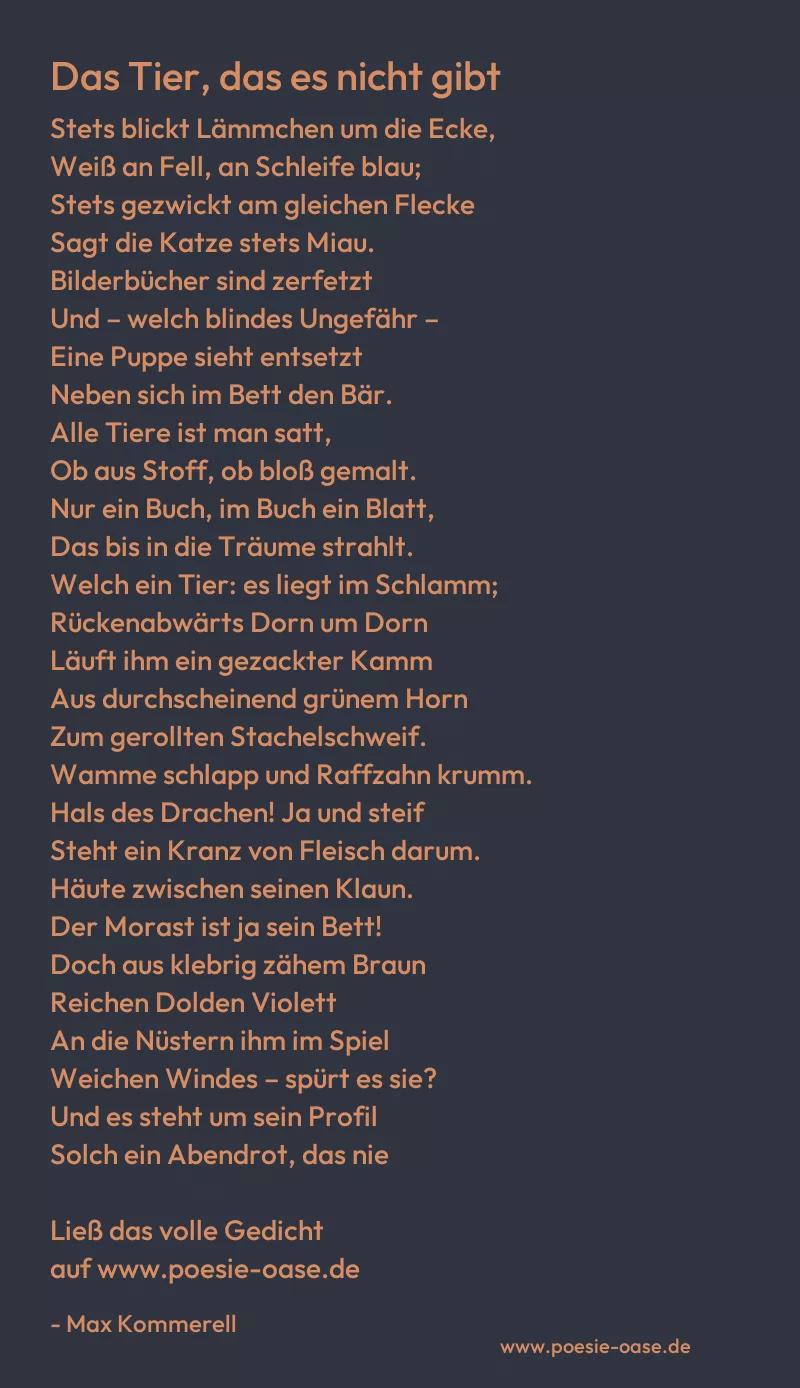Das Tier, das es nicht gibt
Stets blickt Lämmchen um die Ecke,
Weiß an Fell, an Schleife blau;
Stets gezwickt am gleichen Flecke
Sagt die Katze stets Miau.
Bilderbücher sind zerfetzt
Und – welch blindes Ungefähr –
Eine Puppe sieht entsetzt
Neben sich im Bett den Bär.
Alle Tiere ist man satt,
Ob aus Stoff, ob bloß gemalt.
Nur ein Buch, im Buch ein Blatt,
Das bis in die Träume strahlt.
Welch ein Tier: es liegt im Schlamm;
Rückenabwärts Dorn um Dorn
Läuft ihm ein gezackter Kamm
Aus durchscheinend grünem Horn
Zum gerollten Stachelschweif.
Wamme schlapp und Raffzahn krumm.
Hals des Drachen! Ja und steif
Steht ein Kranz von Fleisch darum.
Häute zwischen seinen Klaun.
Der Morast ist ja sein Bett!
Doch aus klebrig zähem Braun
Reichen Dolden Violett
An die Nüstern ihm im Spiel
Weichen Windes – spürt es sie?
Und es steht um sein Profil
Solch ein Abendrot, das nie
Draußen ist, und wie es nur
Aus der Farbenschachtel quoll,
Aber nicht aus der Natur.
Flehend, beinah vorwurfsvoll
Sieht es zu dem Mann empor,
Der ein Wams aus Fell hat. Mama
Sagte: „ein Conquistador“ –
Vasgo heiße er di Gama…
Auf dies Tier, das es nicht gibt,
Starrt das Kind tagein tagaus,
Furchtsam, aber doch verliebt.
Tritt es morgens aus dem Haus,
Sind ihm Katze, Hund und Pferd,
Äffchen, welches den Rekrut
Tröstet über seine Wunde,
Eselchen am Milch-Gefährt,
Selbst die Schwalbe so, als sei
Es in jedem drin – es tut
Tief in ihren Augen Funde,
Spricht mit Vielen Vielerlei.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
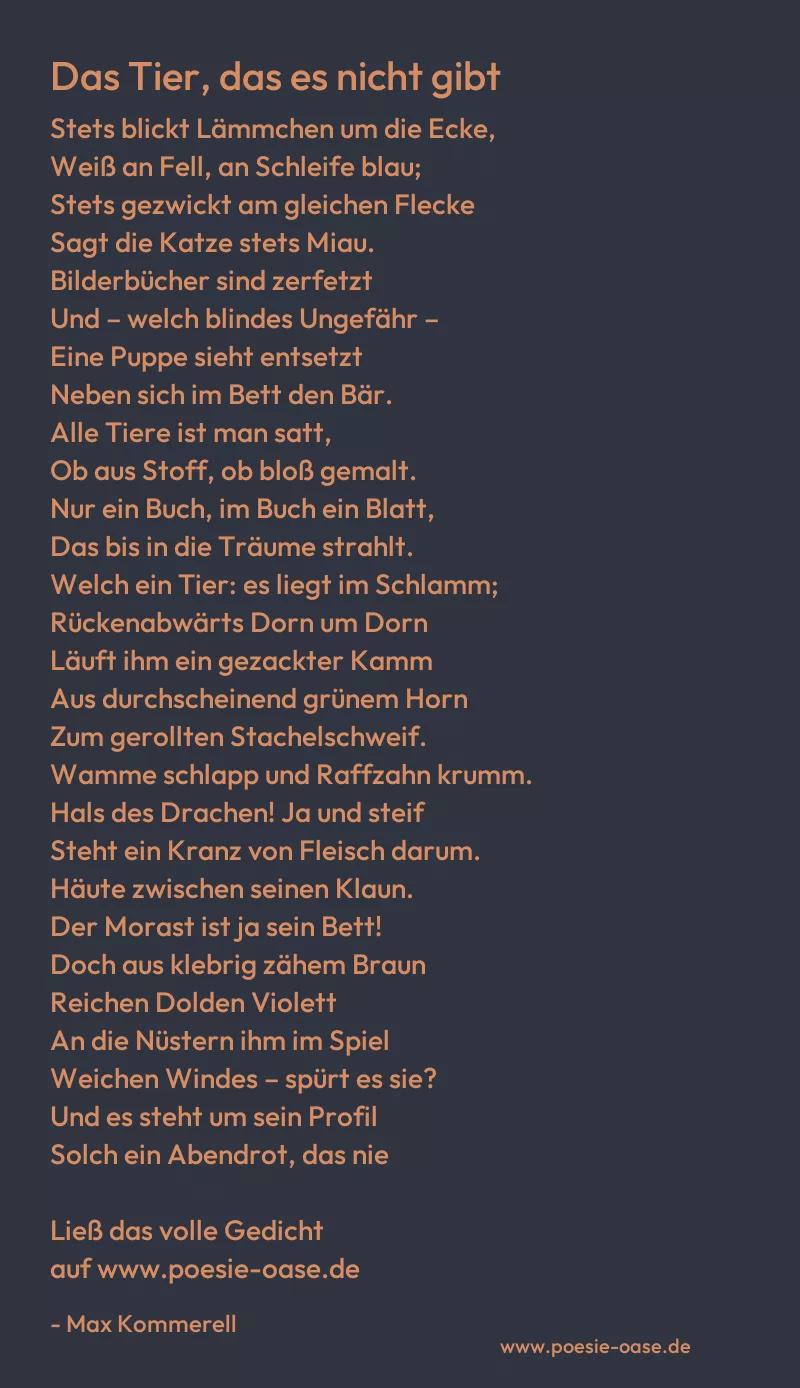
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Tier, das es nicht gibt“ von Max Kommerell handelt von der kindlichen Fantasie, die sich über die Begrenztheit der realen Welt hinwegsetzt und in einem imaginierten Wesen Ausdruck findet. Im Zentrum steht ein fantastisches Tier, das „es nicht gibt“ – eine Schöpfung zwischen Albtraum und Wunder, zwischen Angst und Liebe. Kommerell entfaltet damit eine poetische Reflexion über die Kraft der Einbildung und die Sehnsucht nach dem Unfassbaren, die insbesondere in der Kindheit lebendig ist.
Der erste Teil des Gedichts beschreibt die banalen, vorhersehbaren Tierbilder der Kindheit: das „Lämmchen mit blauer Schleife“, die „Katze, die Miau sagt“, zerrissene Bilderbücher und erschreckte Puppen. Diese Wiederholungen und die stereotype Darstellung zeigen eine Welt, die ihre Magie verloren hat – alles ist bekannt, durchgespielt, abgegriffen. Das Kind hat genug von diesen gewöhnlichen Tieren, die aus Stoff bestehen oder bloß gemalt sind. Die echte Faszination geht von etwas völlig Anderem aus: einem Tier, das in einem Buch beschrieben ist – einem, das nicht existiert, aber dennoch in die Träume hineinleuchtet.
Dieses fantastische Tier wird mit großer Detailfreude beschrieben: ein Drachenähnliches Wesen mit „gezacktem Kamm“, „gerolltem Stachelschweif“, „Häuten zwischen den Klaun“, das im Morast liegt, aber gleichzeitig in einer unwirklichen Farbenwelt steht – umgeben von einem „Abendrot, das nie / Draußen ist“. Die Beschreibung spielt mit Kontrasten: Schlamm und Schönheit, Hässlichkeit und Erhabenheit, Bedrohung und Zärtlichkeit. Es ist ein Geschöpf jenseits der Natur, entstanden aus Farbe, Vorstellungskraft und kindlicher Sehnsucht.
Besonders berührend ist der Moment, in dem das Tier „flehend, beinah vorwurfsvoll“ zu dem „Conquistador“ emporblickt – einer historischen Figur aus der Welt der Eroberung, hier im Kinderbuchformat. Diese Szene lässt sich als Spiegel des kindlichen Gefühls deuten, unverstanden zu bleiben oder dass das Imaginierte keine Heimstatt in der Welt der Erwachsenen findet. Das Tier wird zur Projektionsfläche für das innere Erleben des Kindes: Es ist furchteinflößend und schön zugleich – etwas, das man liebt, obwohl (oder weil) es sich nicht greifen lässt.
Der Schluss des Gedichts zeigt, wie dieses erdachte Wesen die Wahrnehmung des Kindes verändert. Selbst gewöhnliche Tiere – Katze, Hund, Pferd – tragen nun ein Stück dieser Andersartigkeit in sich. Die Fantasie hat die Welt verzaubert, alles wird tiefer, sprechender, bedeutungsvoller. Kommerell gelingt hier eine einfühlsame Darstellung der kindlichen Fähigkeit zur Projektion und zur poetischen Weltaneignung. Das nicht existierende Tier wird so zum Symbol für die schöpferische Kraft des kindlichen Blicks – für das Unsagbare, das dennoch wirkt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.