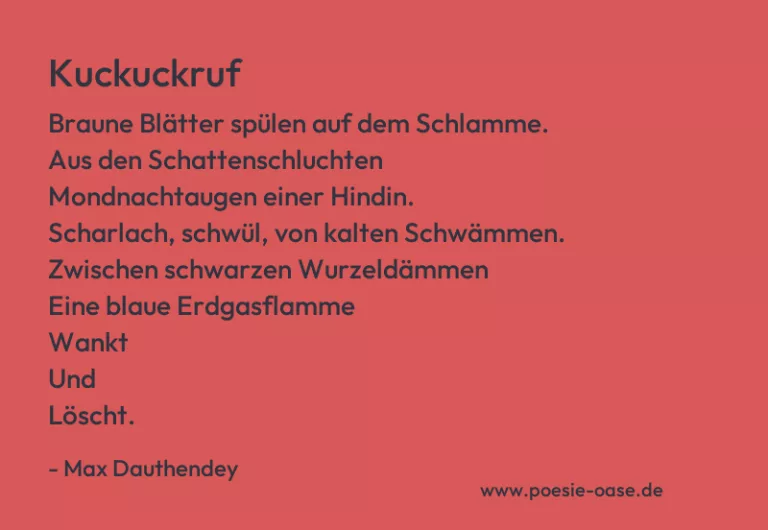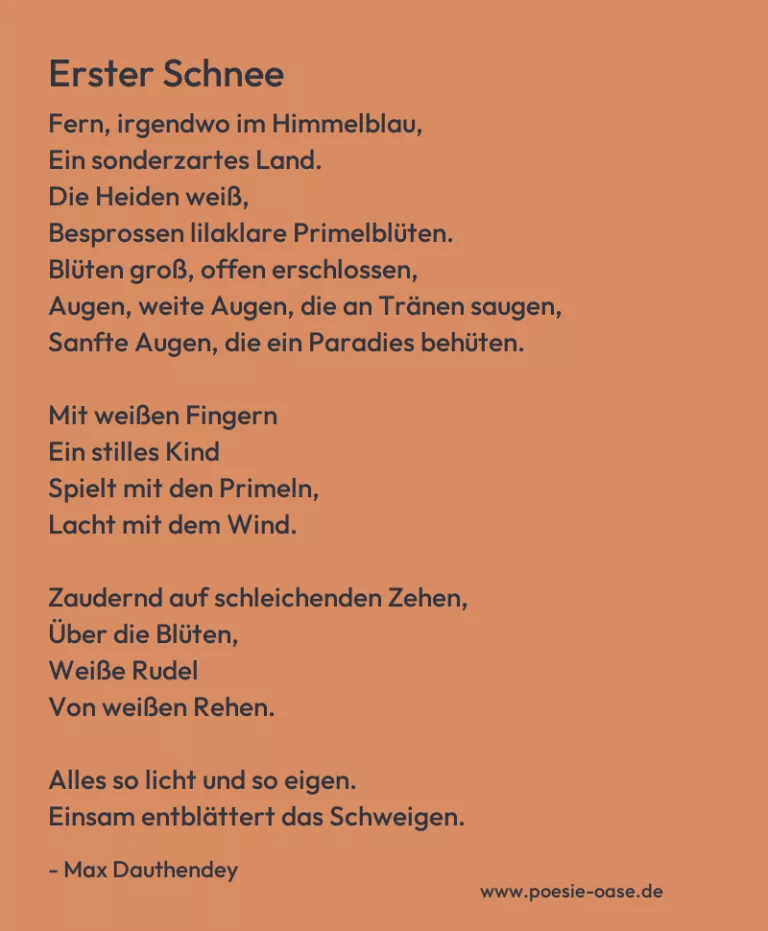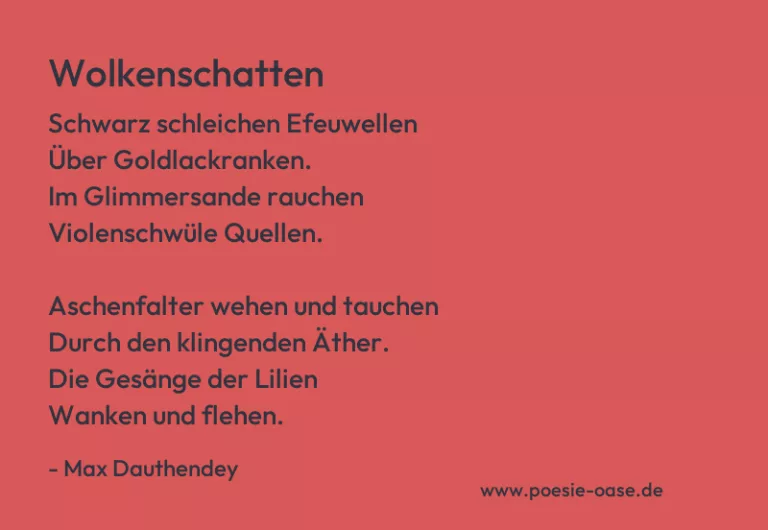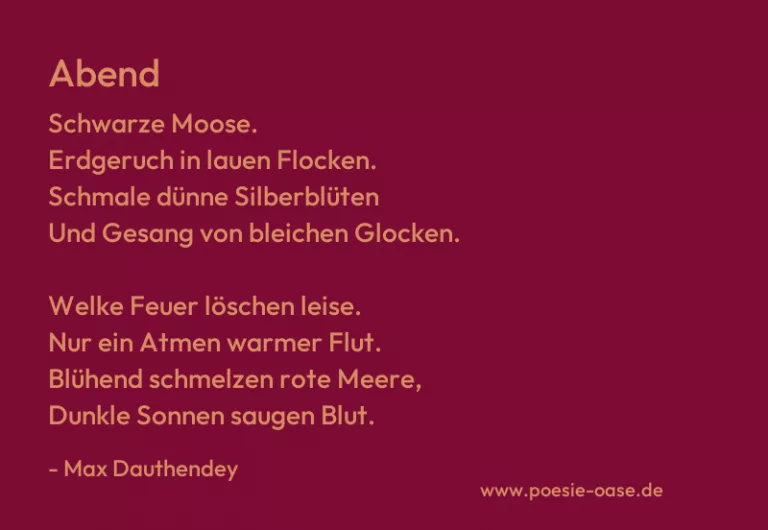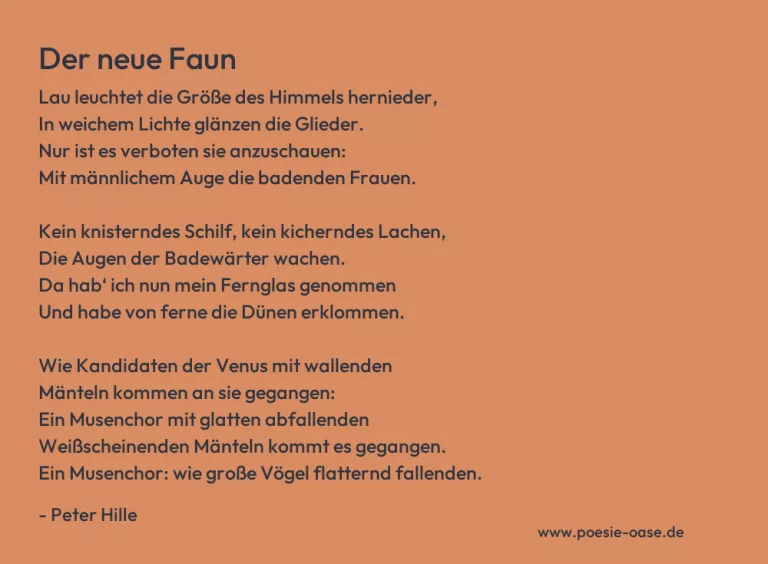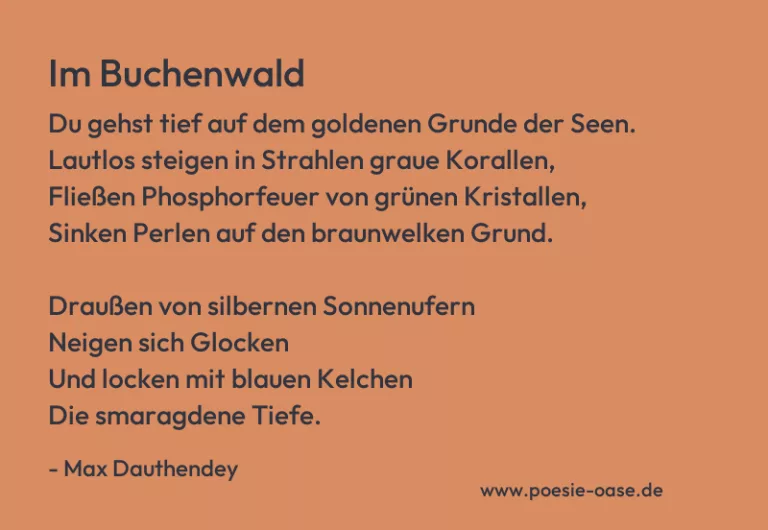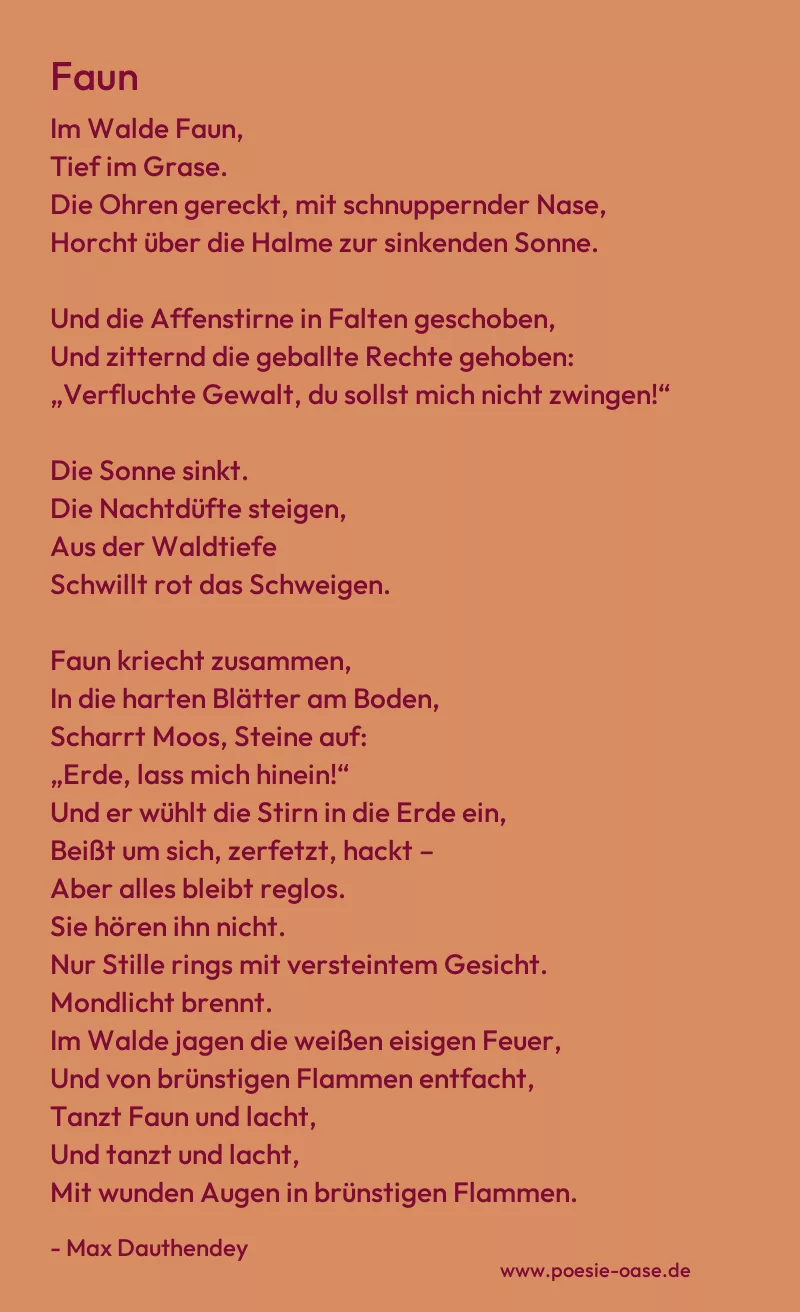Faun
Im Walde Faun,
Tief im Grase.
Die Ohren gereckt, mit schnuppernder Nase,
Horcht über die Halme zur sinkenden Sonne.
Und die Affenstirne in Falten geschoben,
Und zitternd die geballte Rechte gehoben:
„Verfluchte Gewalt, du sollst mich nicht zwingen!“
Die Sonne sinkt.
Die Nachtdüfte steigen,
Aus der Waldtiefe
Schwillt rot das Schweigen.
Faun kriecht zusammen,
In die harten Blätter am Boden,
Scharrt Moos, Steine auf:
„Erde, lass mich hinein!“
Und er wühlt die Stirn in die Erde ein,
Beißt um sich, zerfetzt, hackt –
Aber alles bleibt reglos.
Sie hören ihn nicht.
Nur Stille rings mit versteintem Gesicht.
Mondlicht brennt.
Im Walde jagen die weißen eisigen Feuer,
Und von brünstigen Flammen entfacht,
Tanzt Faun und lacht,
Und tanzt und lacht,
Mit wunden Augen in brünstigen Flammen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
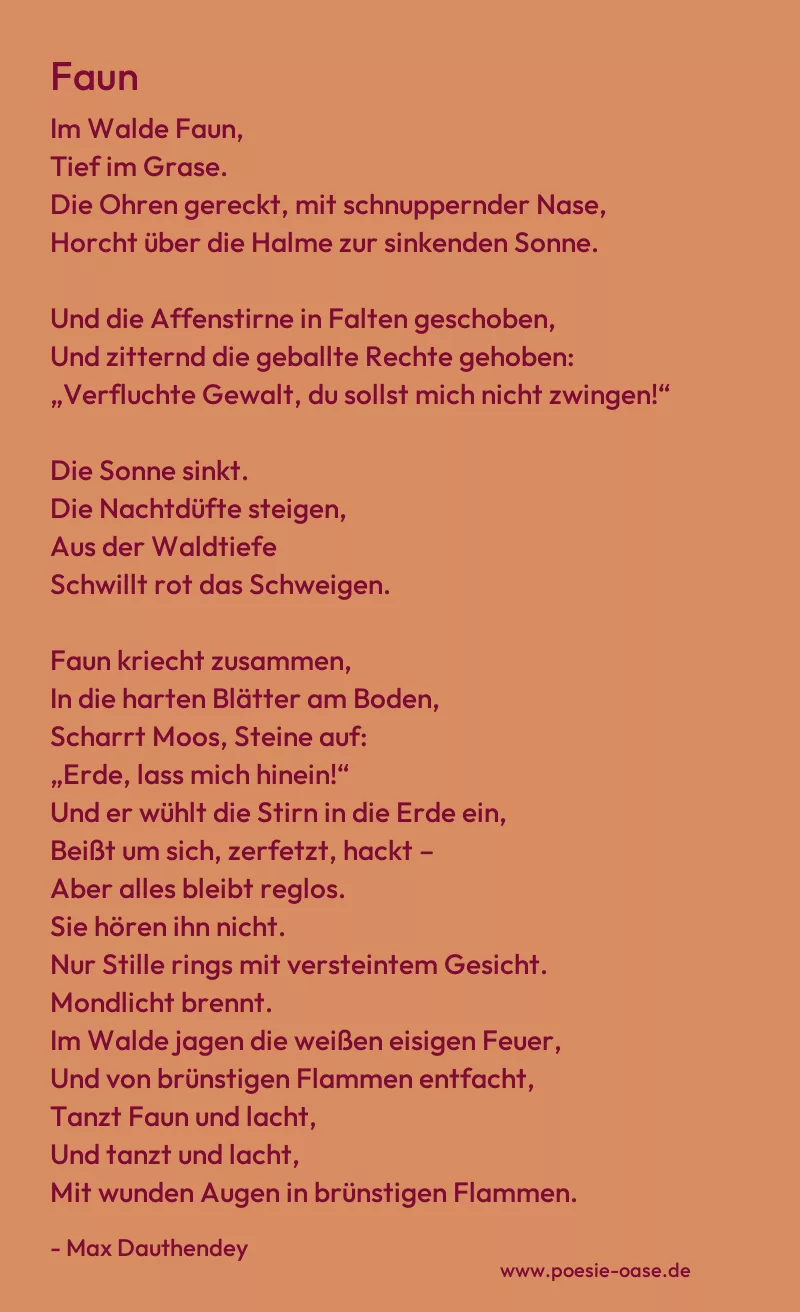
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Faun“ von Max Dauthendey stellt eine kraftvolle Darstellung eines mythischen Wesens dar, das mit der Natur und seinen eigenen inneren Konflikten ringt. Zu Beginn wird der Faun in den tiefen, grünen Wald eingebettet beschrieben, wo er mit „gereckten Ohren“ und „schnuppernder Nase“ aufmerksam auf die Welt um sich herum lauscht. Diese Tiereigenschaften, verbunden mit seiner menschenähnlichen Fähigkeit zur Bewusstseinswahrnehmung, zeigen den Faun als ein Wesen, das zwischen zwei Welten existiert – der tierischen und der menschlichen. Er horcht auf die „sinkende Sonne“, was den Übergang von Tag zu Nacht markiert und den Moment von Veränderung und Spannung einfängt.
Die nächste Szene beschreibt den Faun, der „die Affenstirne in Falten geschoben“ hat und „zitternd die geballte Rechte gehoben“ – ein Bild für Wut und Widerstand. Die „verfluchte Gewalt“ ist eine metaphorische Darstellung von Kräften, die ihn zu zwingen versuchen, sich einer Ordnung zu beugen, die er ablehnt. Der Faun widersetzt sich der Fremdbestimmung und will nicht „gezwungen“ werden, was seine Unabhängigkeit und wilde Natur unterstreicht. Die Sonne, die zu sinken beginnt, lässt die düstere Wendung des Gedichts erahnen, in der der Faun mit der Dunkelheit und den damit verbundenen inneren Kämpfen konfrontiert wird.
Als die Nacht hereinbricht und „Nachtdüfte steigen“, wird die Spannung greifbar, und der Faun zieht sich „zusammen“ in die Erde zurück. Er gräbt, scharrt „Moos, Steine auf“ und ruft die Erde an, ihn zu „verschlingen“. Diese verzweifelte Bitte nach Eingraben in die Erde und das „Wühlen der Stirn in die Erde“ symbolisieren den inneren Kampf des Fauns, der sich gegen die Welt auflehnt und in die Dunkelheit der Natur fliehen möchte. Doch alles bleibt „reglos“, und die Welt hört ihn nicht – ein Bild für die Isolation und die Ohnmacht des Fauns, der mit seiner Existenz und seinen inneren Konflikten allein ist.
Der abschließende Teil des Gedichts bringt eine drastische Wendung, als der Mondschein „brannt“, und die „weißen eisigen Feuer“ im Wald jagen. Inmitten dieser extremen, fast surreale Naturgewalten tanzt der Faun „mit wunden Augen in brünstigen Flammen“. Hier zeigt sich der Faun in seiner verzweifelten Ekstase – er hat die Grenzen der Realität überschritten und sich in eine ekstatische, selbstzerstörerische Freude gestürzt. Die Flammen, die für Leidenschaft und Zerstörung stehen, symbolisieren die innere Zerrissenheit des Fauns, der zwischen Schmerz und Lust, zwischen Zerstörung und Erlösung hin- und hergerissen ist.
Dauthendey schafft in diesem Gedicht ein intensives Bild von innerem und äußerem Konflikt, das den Faun als ein Wesen zeigt, das mit den Kräften der Natur und seinen eigenen, wilden Instinkten ringt. Das Gedicht thematisiert die Beziehung zwischen Freiheit und Zerstörung, die immer wieder in einem wilden Tanz von Schmerz und Ekstase mündet, was die untrennbare Verbindung von Leben und Tod im mythologischen Sinne widerspiegelt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.