Ich hör‘ den Regen dreschen
Und übers Pflaster fegen.
Der Regen scheint besessen
Und will die Welt auffressen.
Ich muss mich näher legen
Ins Bett zu meiner Frauen.
Wird sich ihr Äuglein regen,
Kann ich ins Blaue schauen.
Ich hör‘ den Regen dreschen
Und übers Pflaster fegen.
Der Regen scheint besessen
Und will die Welt auffressen.
Ich muss mich näher legen
Ins Bett zu meiner Frauen.
Wird sich ihr Äuglein regen,
Kann ich ins Blaue schauen.
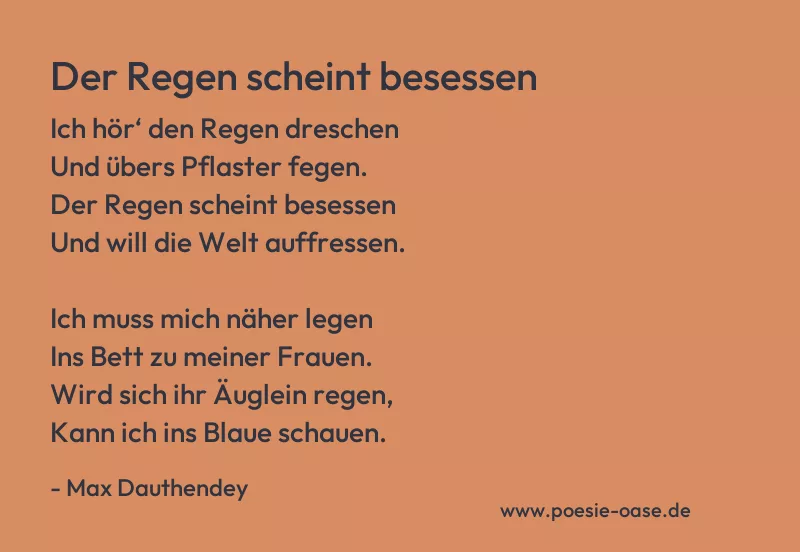
Das Gedicht „Der Regen scheint besessen“ von Max Dauthendey kontrastiert eindrucksvoll das Toben der äußeren Natur mit der Geborgenheit einer intimen Zweisamkeit. In der ersten Strophe wird der Regen als wild und fast unheilvoll beschrieben: Er „drescht“ und „fegt“ über das Pflaster, wirkt wie eine zerstörerische Kraft, „besessen“ davon, „die Welt auf[zu]fressen“. Diese lebhafte, fast bedrohliche Darstellung des Unwetters verleiht dem Naturbild eine düstere, unkontrollierbare Energie.
Doch statt sich vom Regen einschüchtern zu lassen, reagiert das lyrische Ich mit einer zärtlichen Wende: Es zieht sich zu seiner Partnerin ins Bett zurück, in die Wärme und Sicherheit der Nähe. Die zweite Strophe bringt eine heitere, fast verspielte Gegenbewegung zur Unruhe draußen. Das „Äuglein“ der Geliebten steht dabei für einen zarten, liebevollen Blick, der dem Ich den Blick „ins Blaue“ erlaubt – also in die Hoffnung, die Ruhe oder gar ins Transzendente.
Dauthendey gelingt hier mit wenigen Zeilen ein atmosphärischer Stimmungsumschwung: vom Sturm zur Stille, von der Unruhe zur Geborgenheit. Der Regen draußen wird zum Verstärker für die Intimität drinnen – je wilder das Außen, desto kostbarer erscheint das Innen.
In seiner Kürze entfaltet das Gedicht eine schöne Spannung zwischen Naturgewalt und zwischenmenschlicher Nähe. Es zeigt, wie Poesie selbst im Lärm des Regens einen Moment der Liebe, des Trosts und der inneren Weite finden kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.