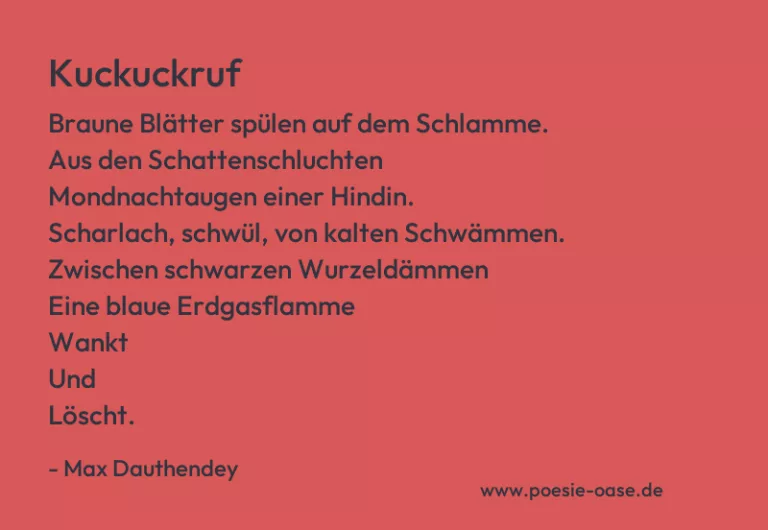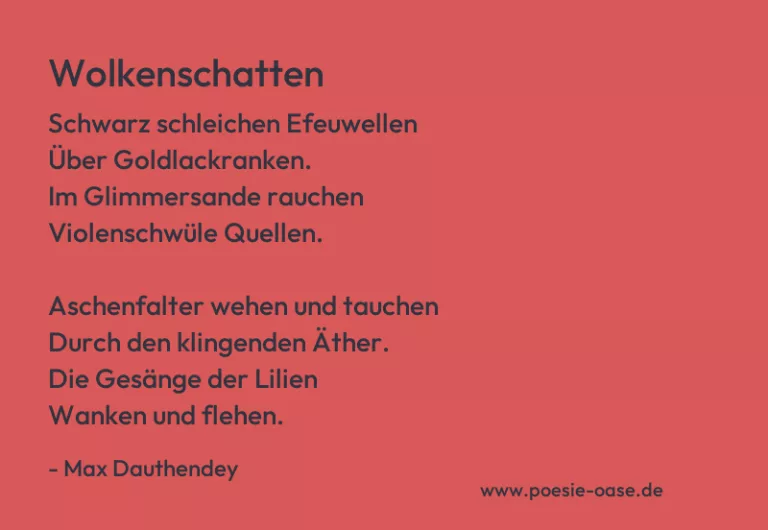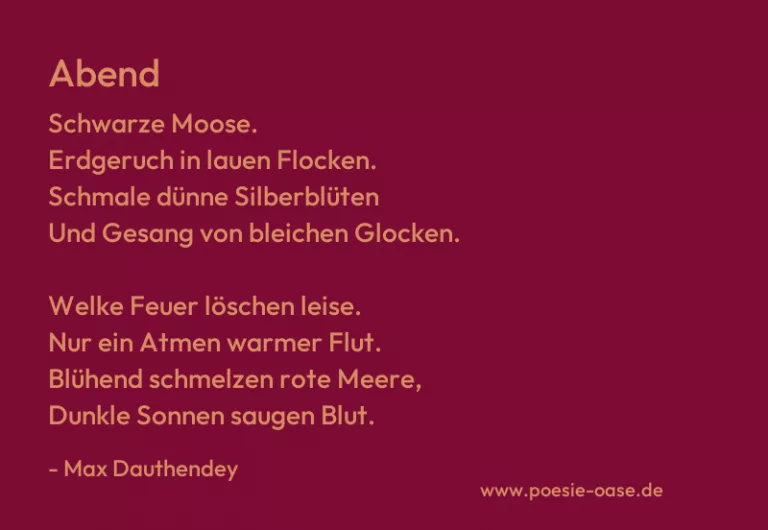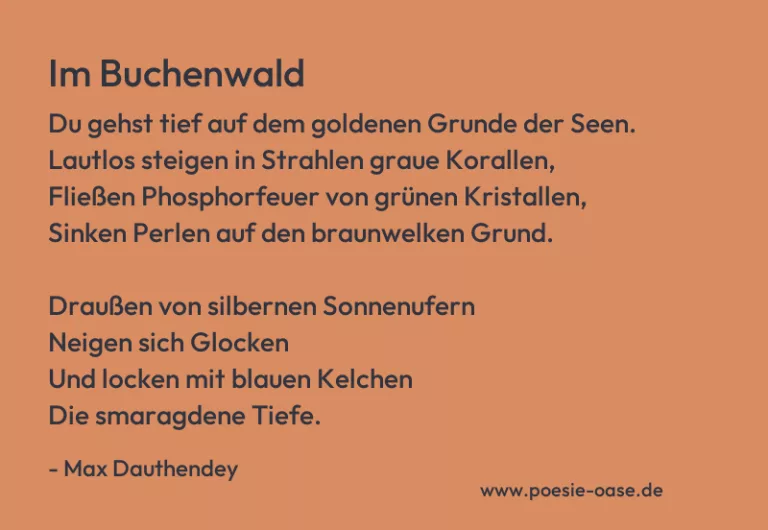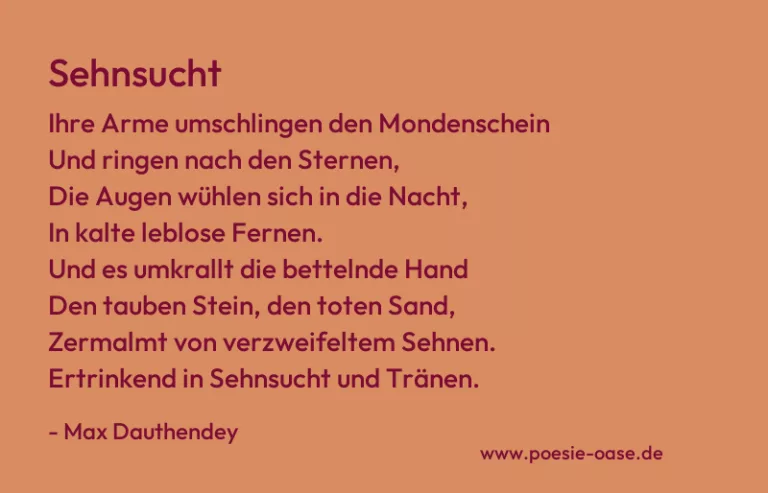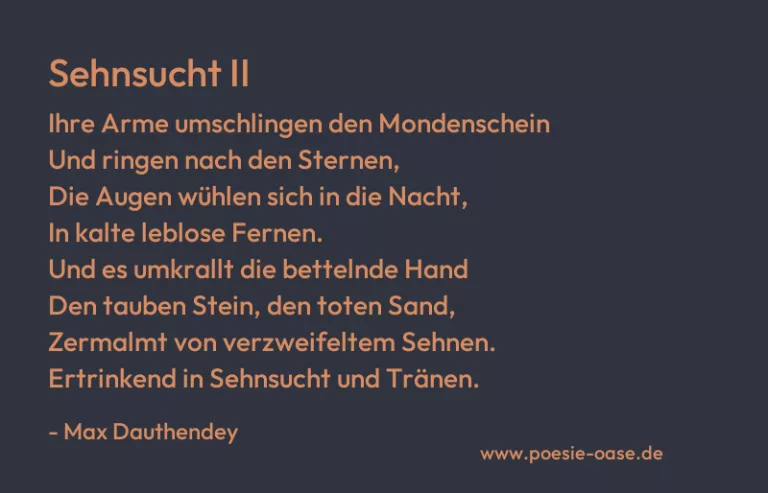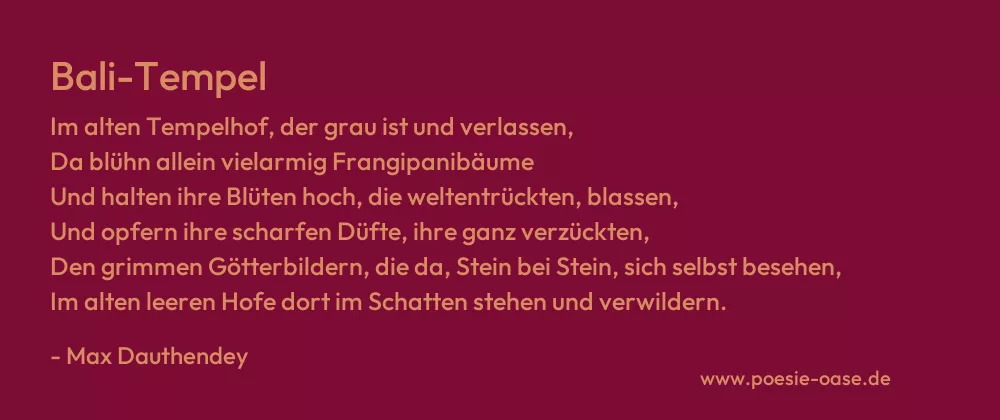Bali-Tempel
Im alten Tempelhof, der grau ist und verlassen,
Da blühn allein vielarmig Frangipanibäume
Und halten ihre Blüten hoch, die weltentrückten, blassen,
Und opfern ihre scharfen Düfte, ihre ganz verzückten,
Den grimmen Götterbildern, die da, Stein bei Stein, sich selbst besehen,
Im alten leeren Hofe dort im Schatten stehen und verwildern.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
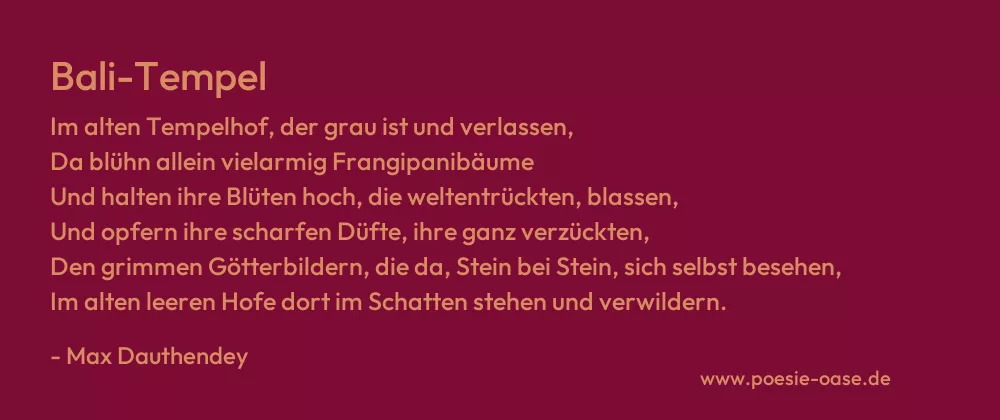
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Bali-Tempel“ von Max Dauthendey beschreibt eine geheimnisvolle, verlassene Tempelanlage, in der Natur und Spiritualität miteinander verschmelzen. Der Ort wirkt wie aus der Zeit gefallen – „grau“ und „verlassen“ –, und doch lebt er in der Stille durch die Frangipanibäume, die ihre Blüten und Düfte darbringen wie Opfergaben an vergessene Götter.
Die Bäume mit ihren „vielarmigen“ Gestalten erscheinen fast selbst wie mythologische Wesen oder Teil eines Rituals. Ihre „weltentrückten“ Blüten betonen eine spirituelle Entrücktheit, ein Abgehobensein vom Irdischen. Die Düfte, als Ausdruck des Lebendigen, werden den „grimmen Götterbildern“ dargebracht – stummen Zeugen vergangener Gläubigkeit, die nun verwildern und in ihrer Starre fast unheimlich wirken.
Sprachlich nutzt Dauthendey starke Sinneseindrücke, besonders Geruch („scharfe Düfte“) und visuelle Details („blassen“, „vielarmig“), um Atmosphäre zu schaffen. Die Alliteration („sich selbst besehen“) sowie der Kontrast zwischen Bewegung (blühende Bäume) und Starre (Steinfiguren) verstärken den Eindruck eines Ortes, an dem Zeit und Leben stillstehen, während zugleich etwas Unsichtbares weiterwirkt – wie ein leiser, verblassender Kult.
Das Gedicht thematisiert damit die Vergänglichkeit menschlicher Spiritualität und den gleichzeitigen Fortbestand einer tieferen, vielleicht natürlichen Form des Gedenkens. Die Natur ersetzt das Ritual, das Opfer geschieht wortlos, aber intensiv. Der Tempel mag verlassen sein, aber er ist nicht tot – er lebt auf eine stille, mystische Weise weiter.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.