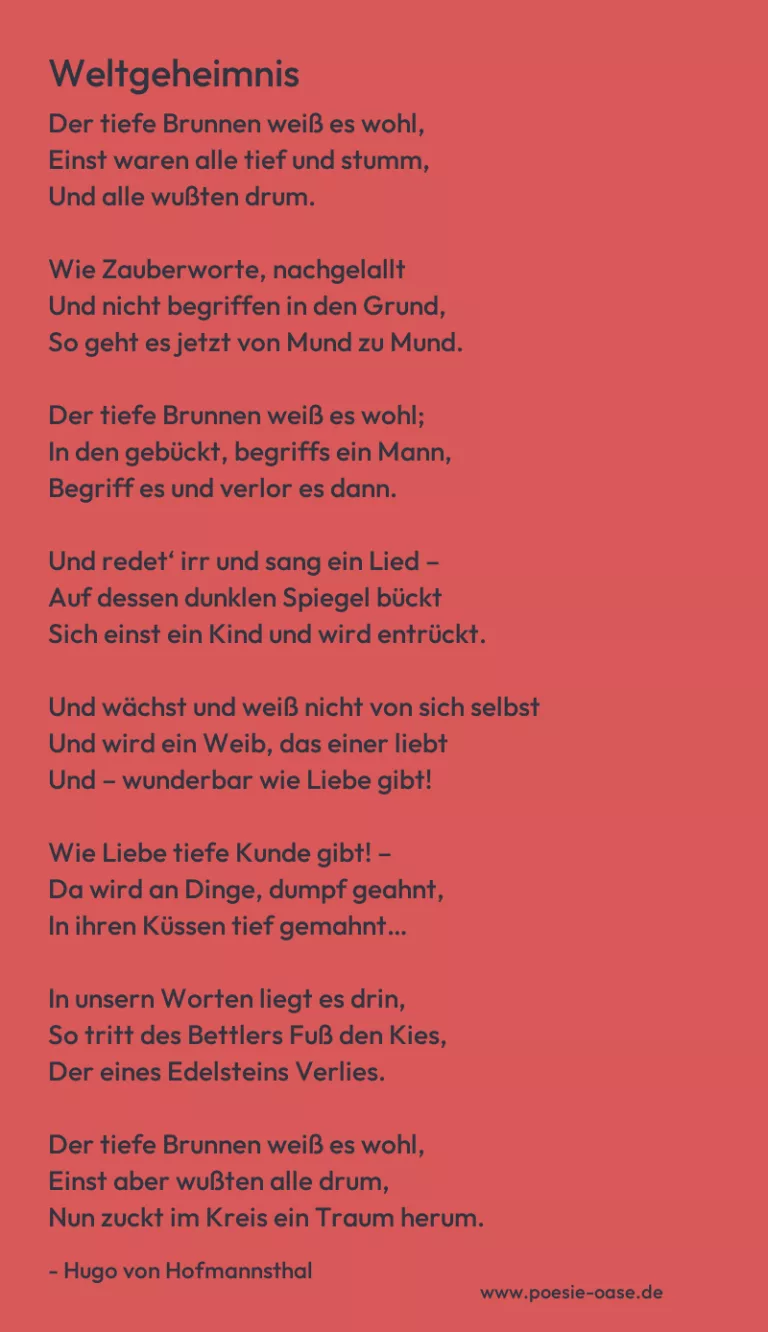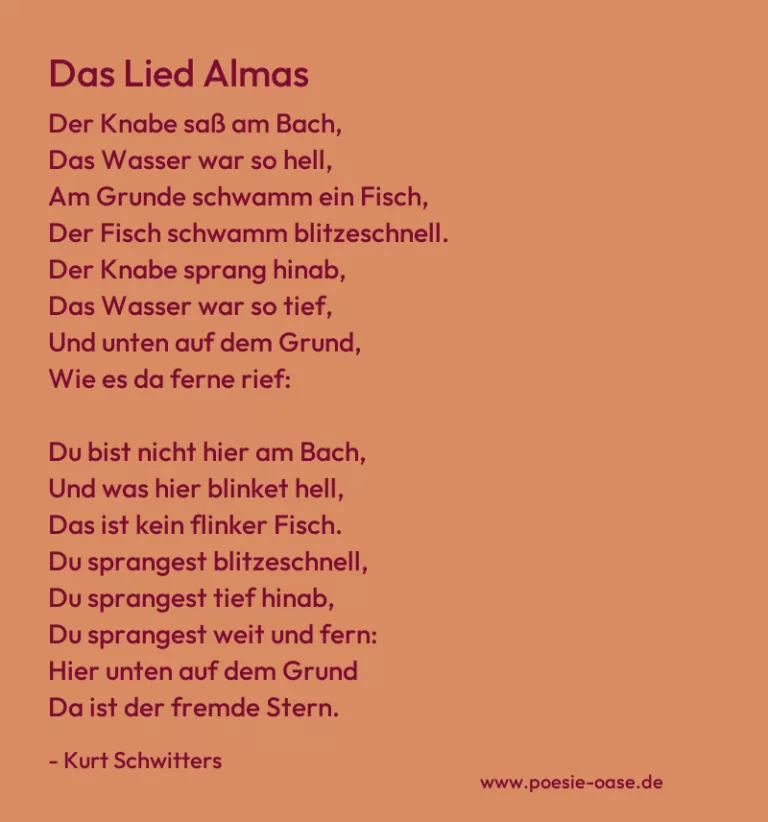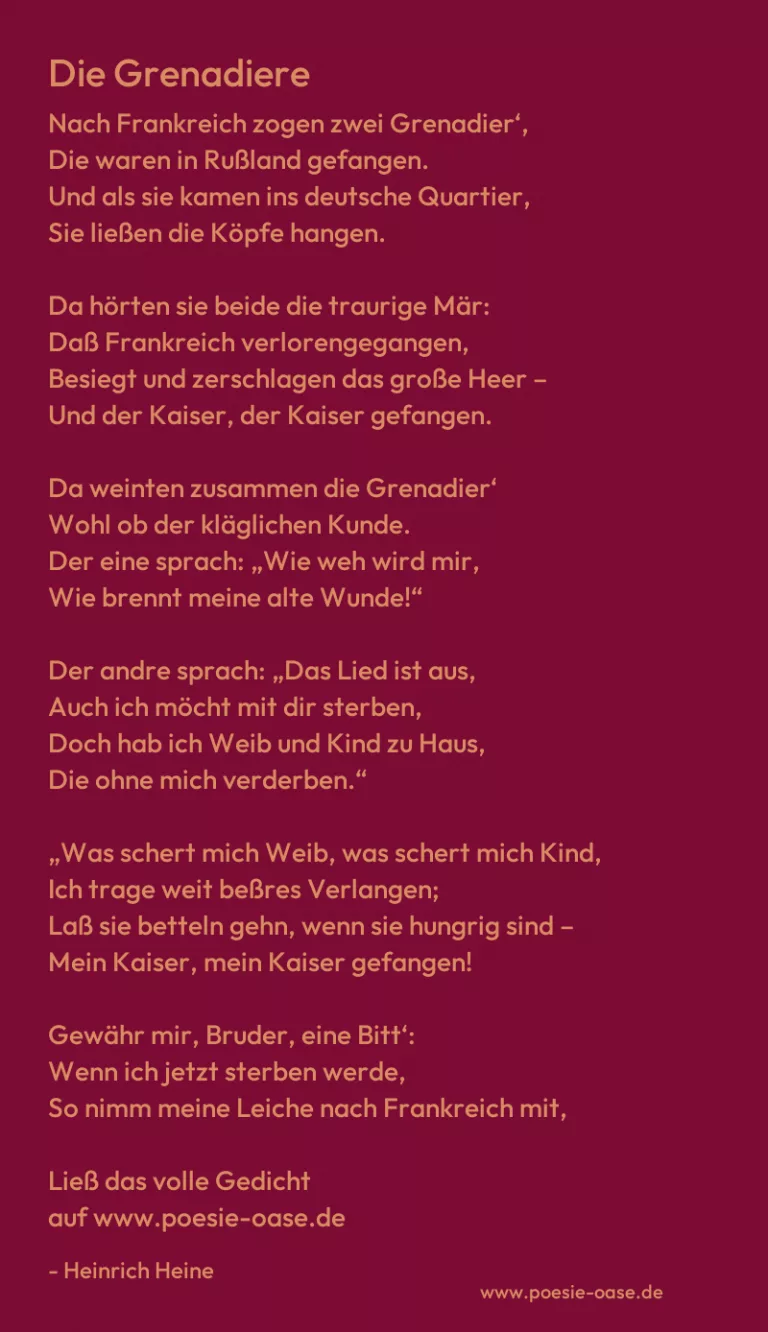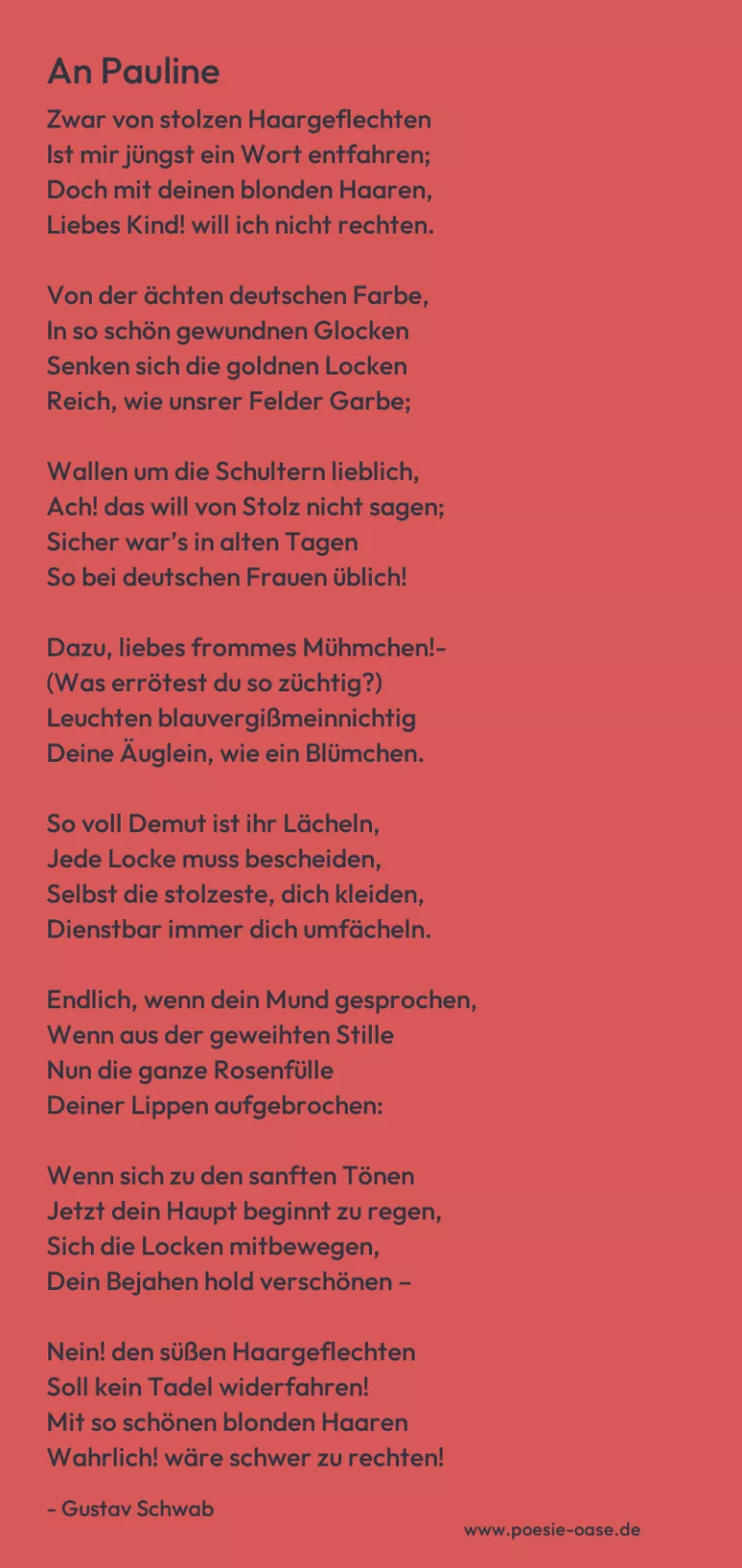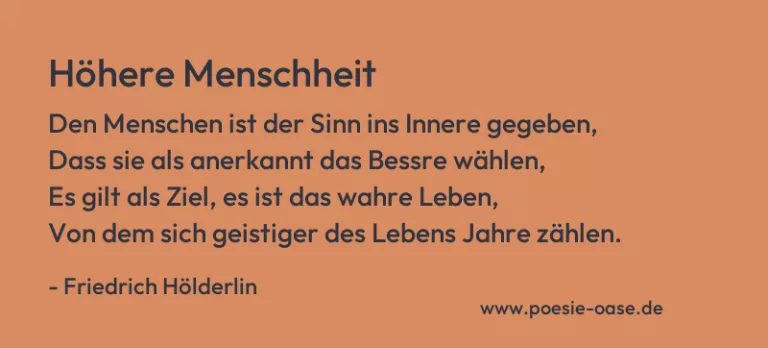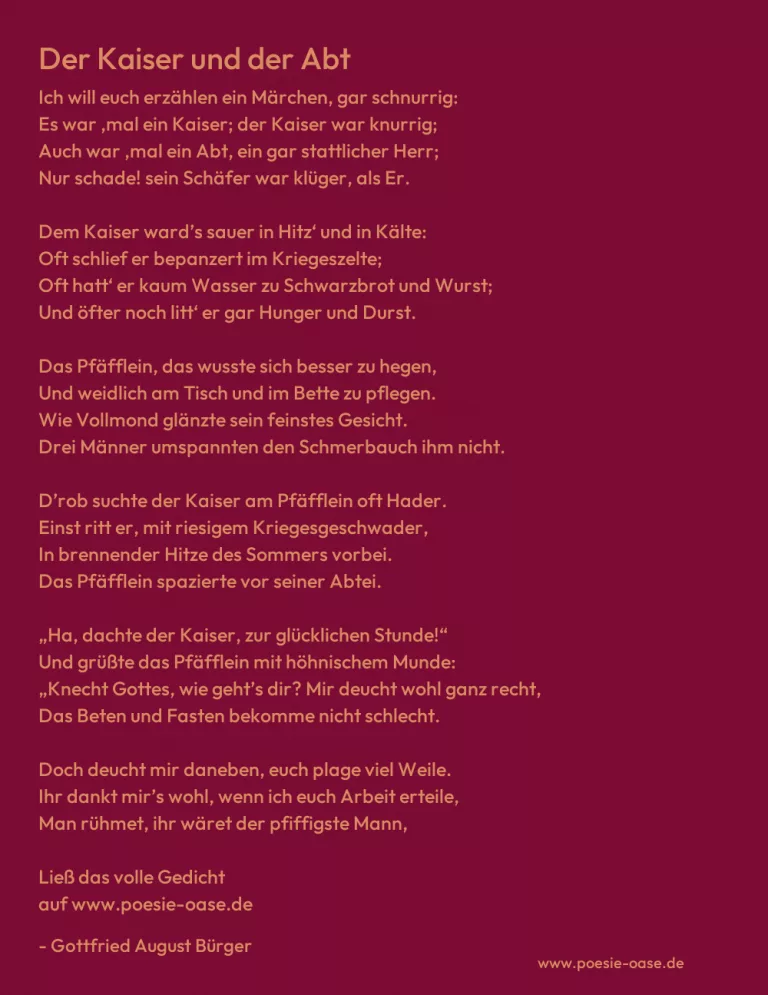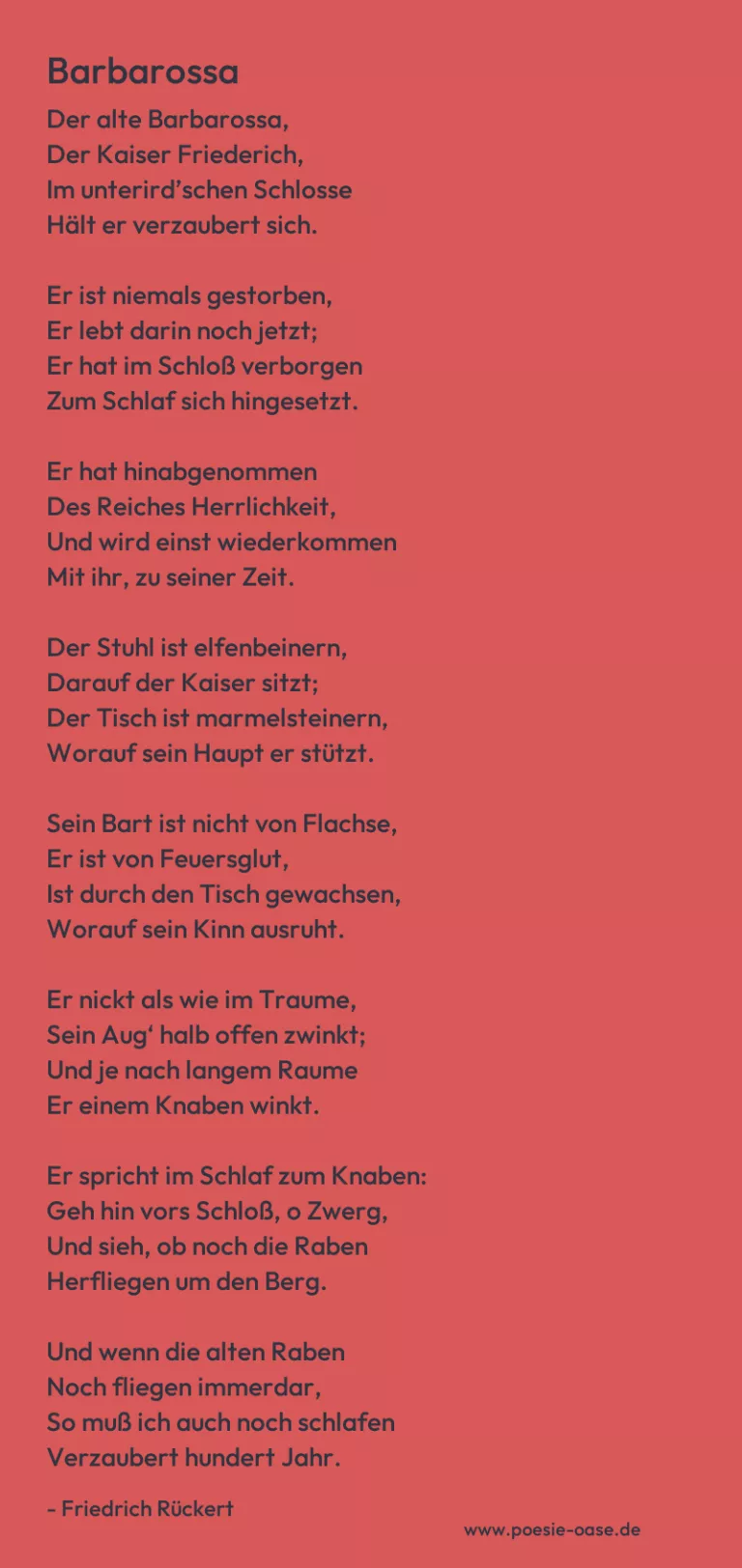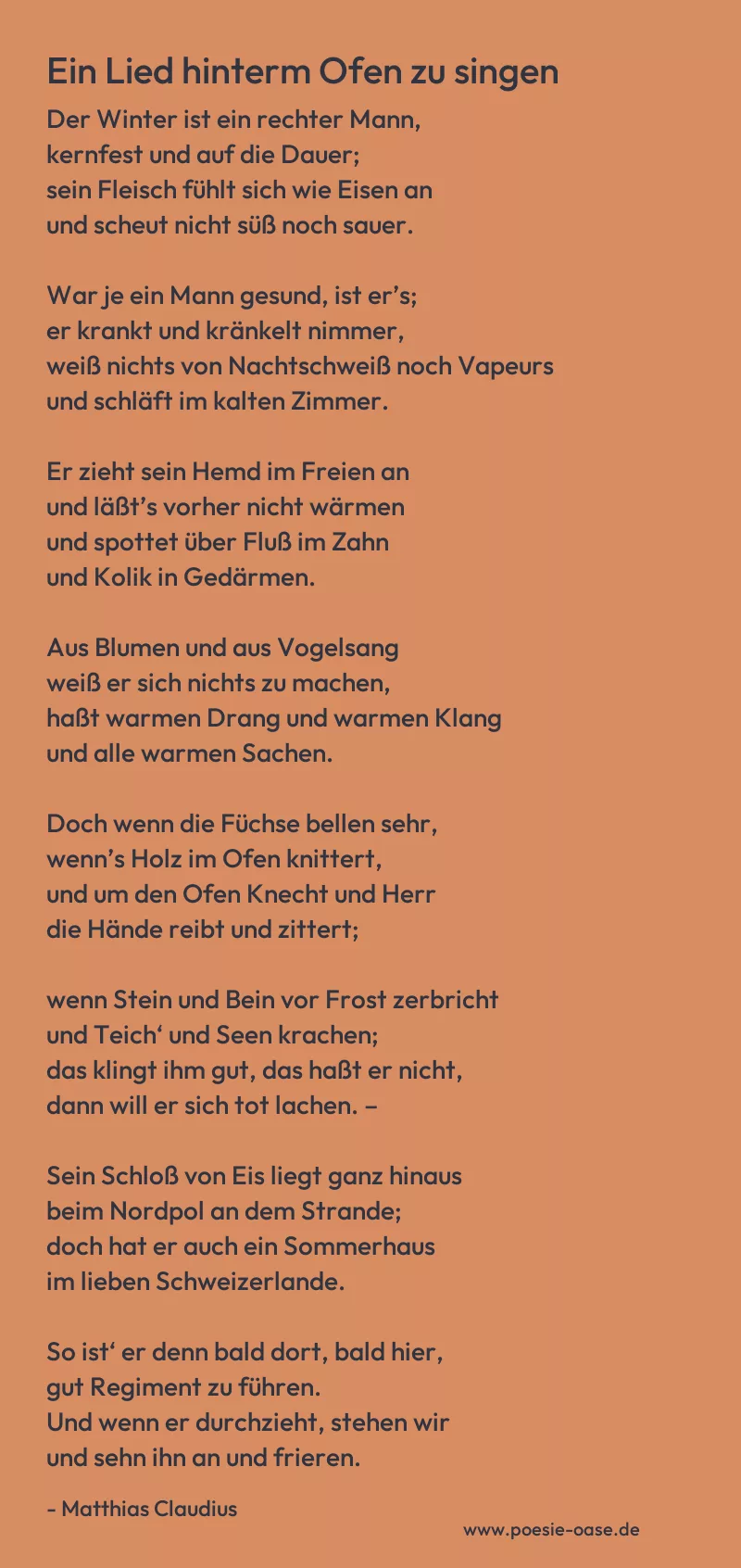Der Winter ist ein rechter Mann,
kernfest und auf die Dauer;
sein Fleisch fühlt sich wie Eisen an
und scheut nicht süß noch sauer.
War je ein Mann gesund, ist er’s;
er krankt und kränkelt nimmer,
weiß nichts von Nachtschweiß noch Vapeurs
und schläft im kalten Zimmer.
Er zieht sein Hemd im Freien an
und läßt’s vorher nicht wärmen
und spottet über Fluß im Zahn
und Kolik in Gedärmen.
Aus Blumen und aus Vogelsang
weiß er sich nichts zu machen,
haßt warmen Drang und warmen Klang
und alle warmen Sachen.
Doch wenn die Füchse bellen sehr,
wenn’s Holz im Ofen knittert,
und um den Ofen Knecht und Herr
die Hände reibt und zittert;
wenn Stein und Bein vor Frost zerbricht
und Teich‘ und Seen krachen;
das klingt ihm gut, das haßt er nicht,
dann will er sich tot lachen. –
Sein Schloß von Eis liegt ganz hinaus
beim Nordpol an dem Strande;
doch hat er auch ein Sommerhaus
im lieben Schweizerlande.
So ist‘ er denn bald dort, bald hier,
gut Regiment zu führen.
Und wenn er durchzieht, stehen wir
und sehn ihn an und frieren.