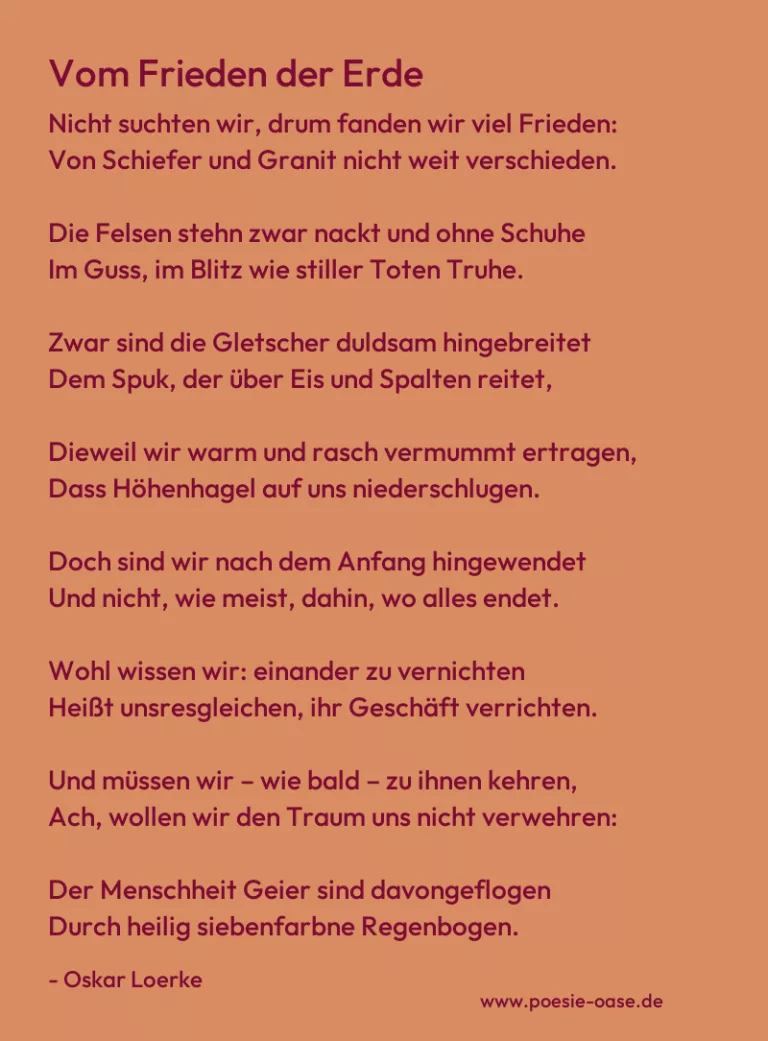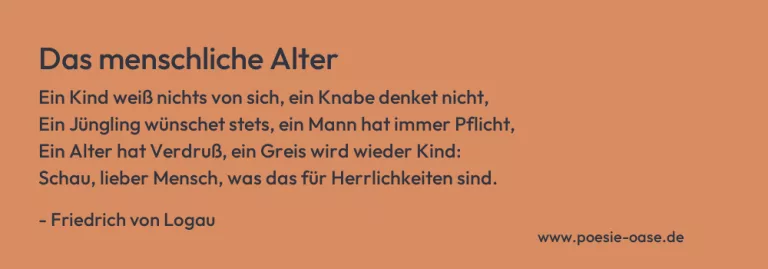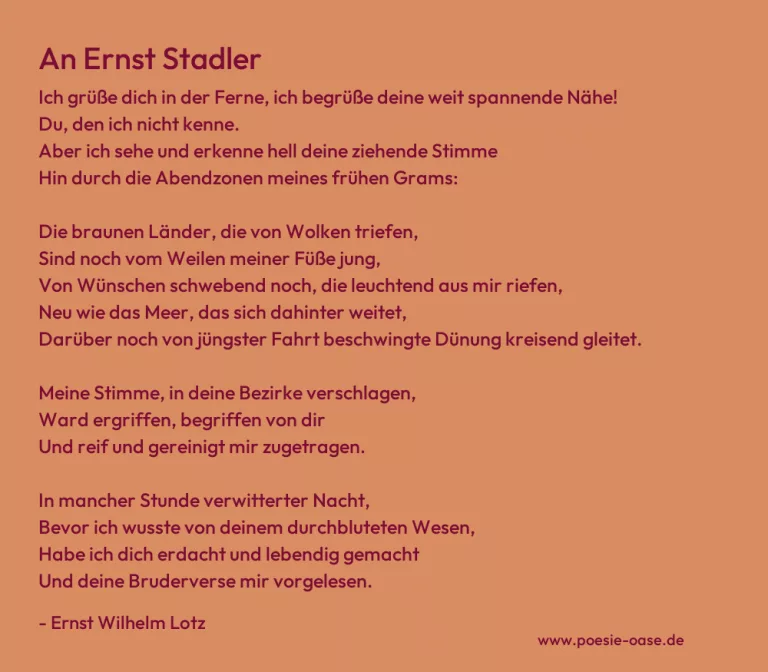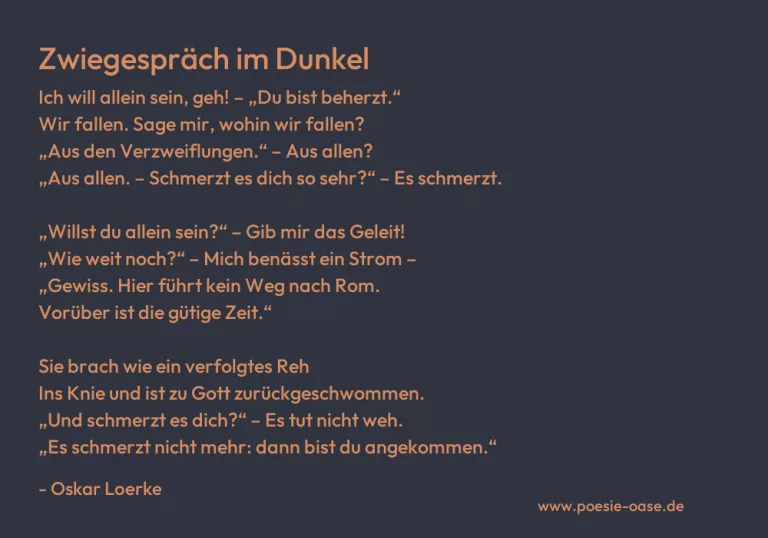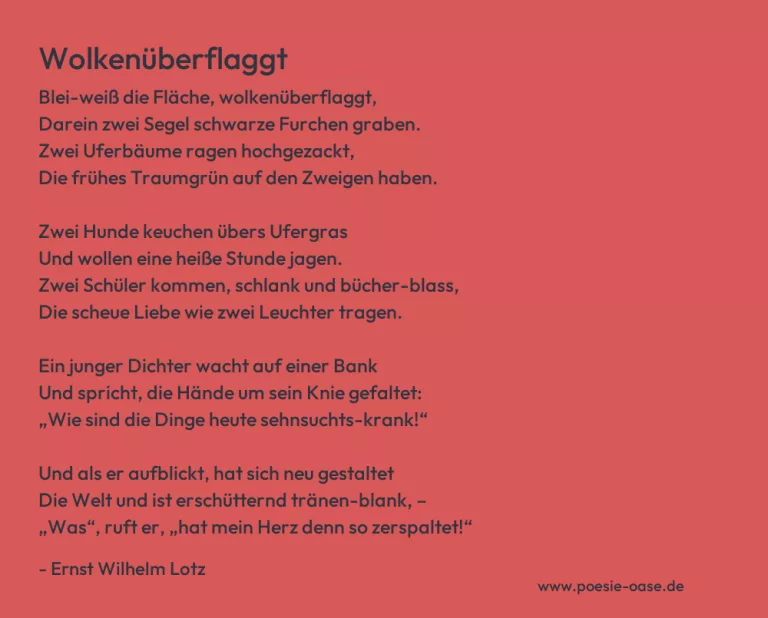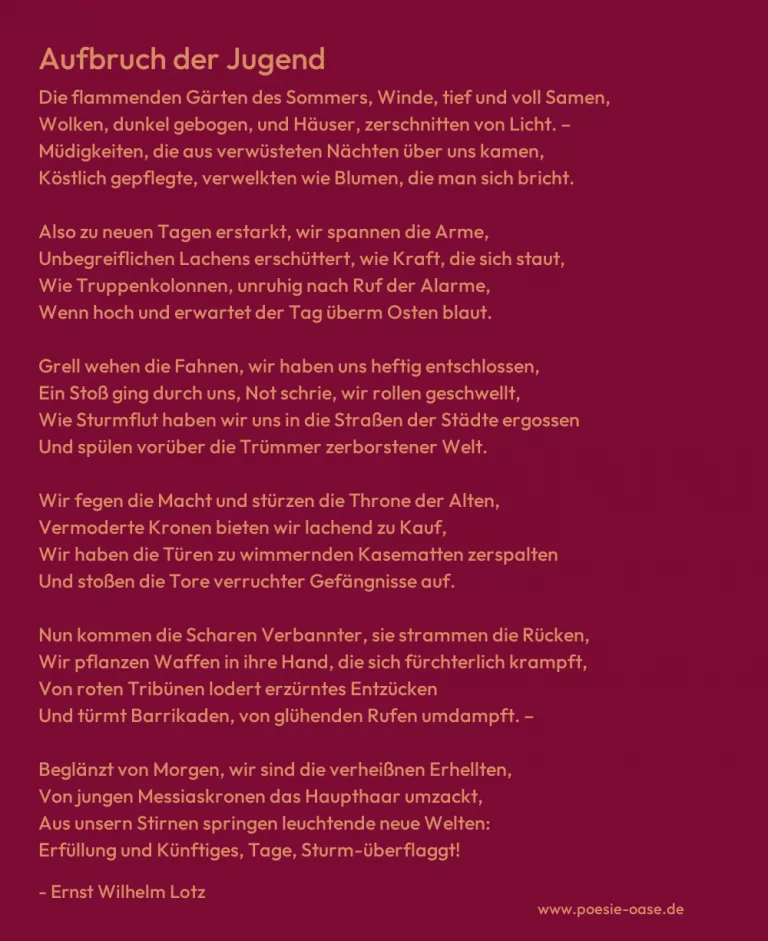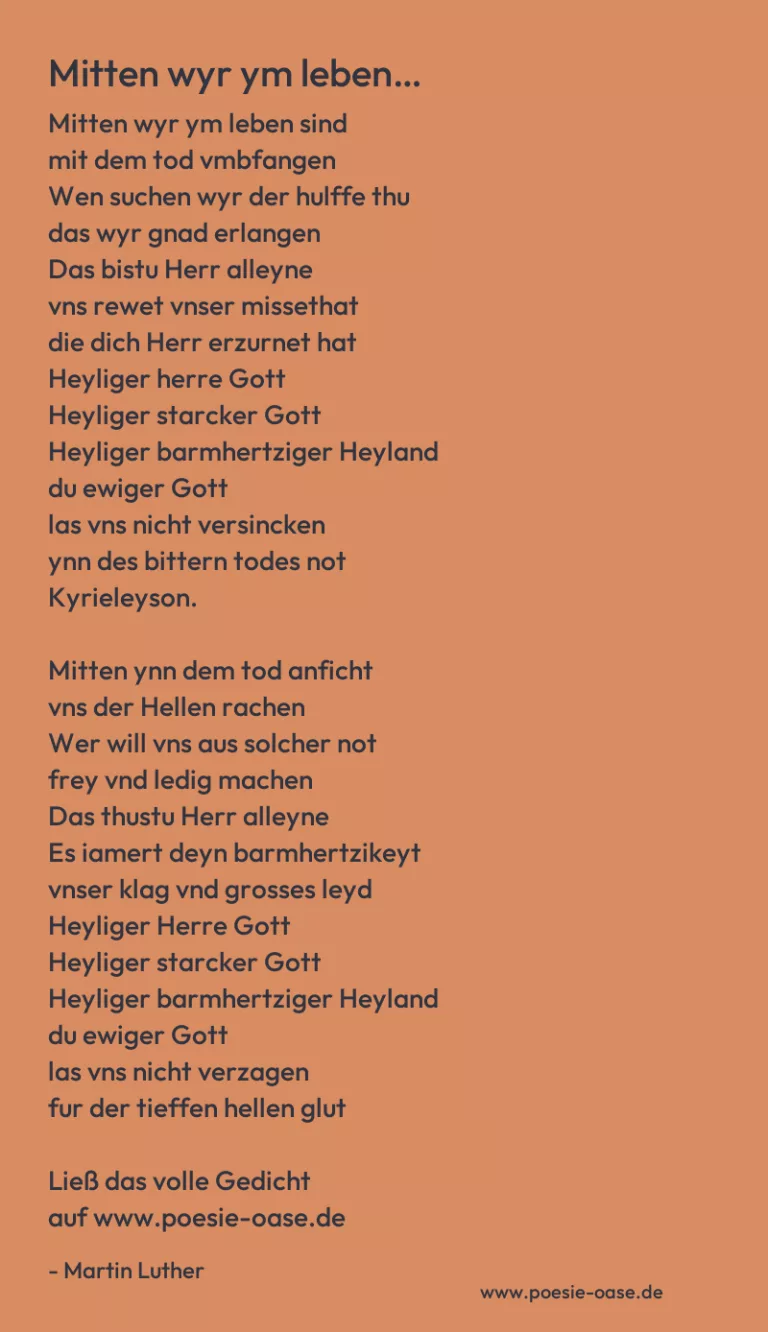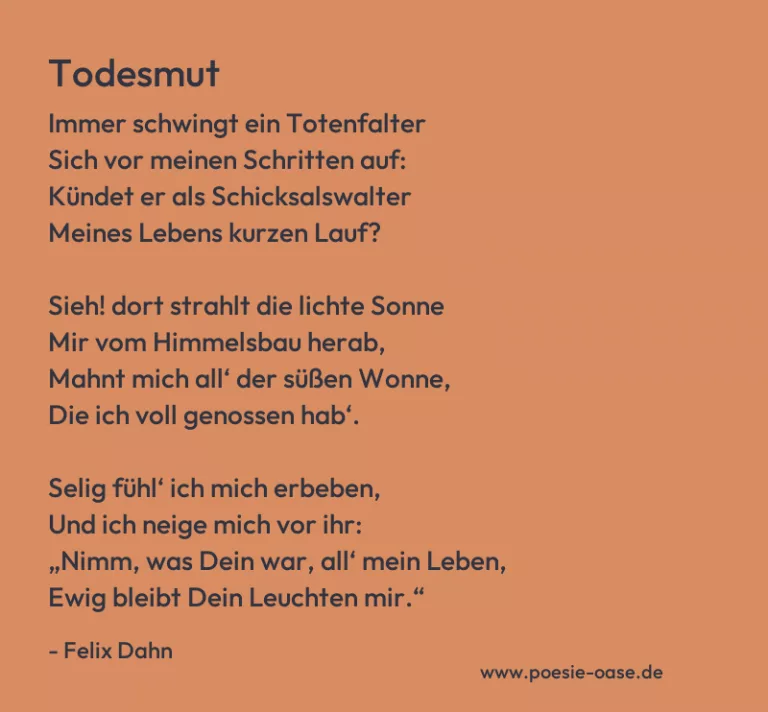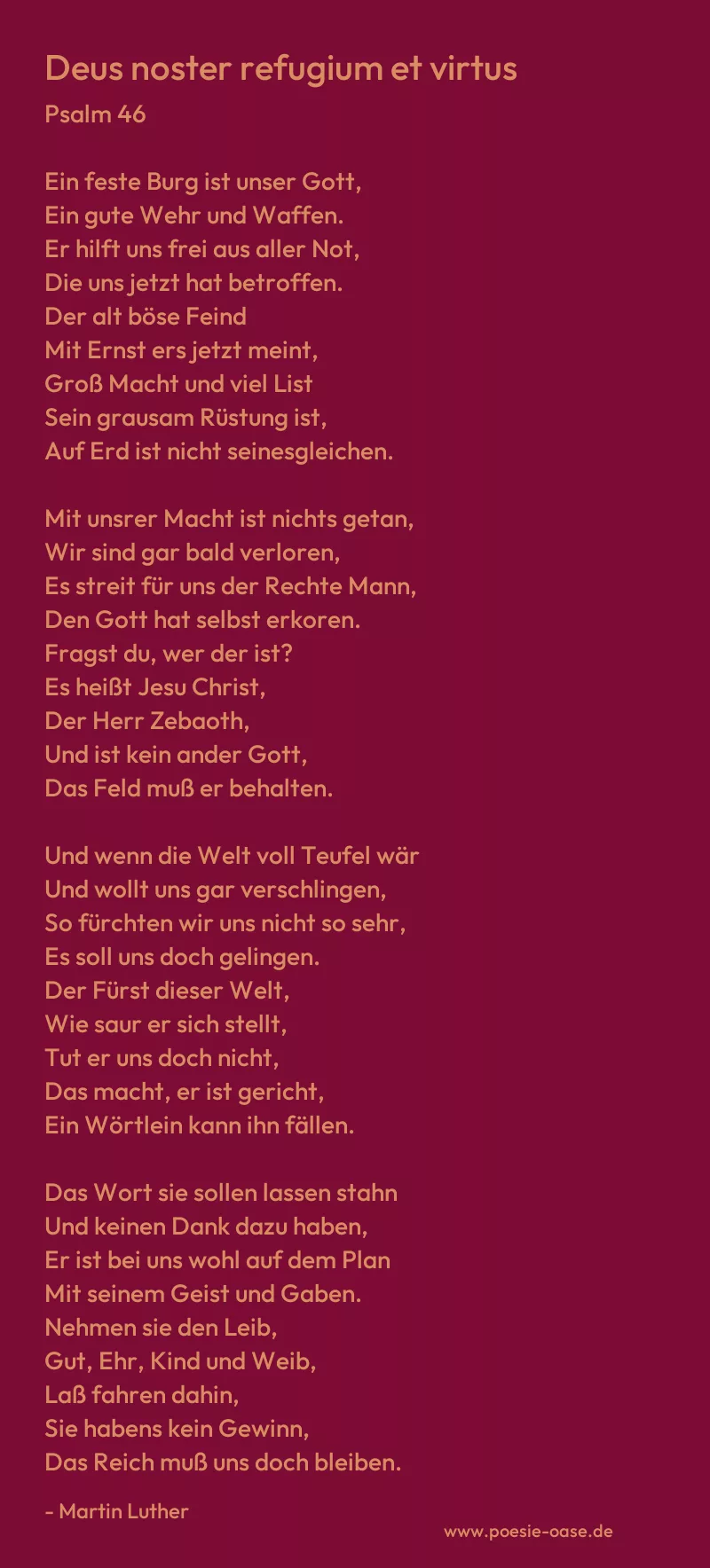Deus noster refugium et virtus
Psalm 46
Ein feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind
Mit Ernst ers jetzt meint,
Groß Macht und viel List
Sein grausam Rüstung ist,
Auf Erd ist nicht seinesgleichen.
Mit unsrer Macht ist nichts getan,
Wir sind gar bald verloren,
Es streit für uns der Rechte Mann,
Den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Es heißt Jesu Christ,
Der Herr Zebaoth,
Und ist kein ander Gott,
Das Feld muß er behalten.
Und wenn die Welt voll Teufel wär
Und wollt uns gar verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
Wie saur er sich stellt,
Tut er uns doch nicht,
Das macht, er ist gericht,
Ein Wörtlein kann ihn fällen.
Das Wort sie sollen lassen stahn
Und keinen Dank dazu haben,
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
Laß fahren dahin,
Sie habens kein Gewinn,
Das Reich muß uns doch bleiben.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
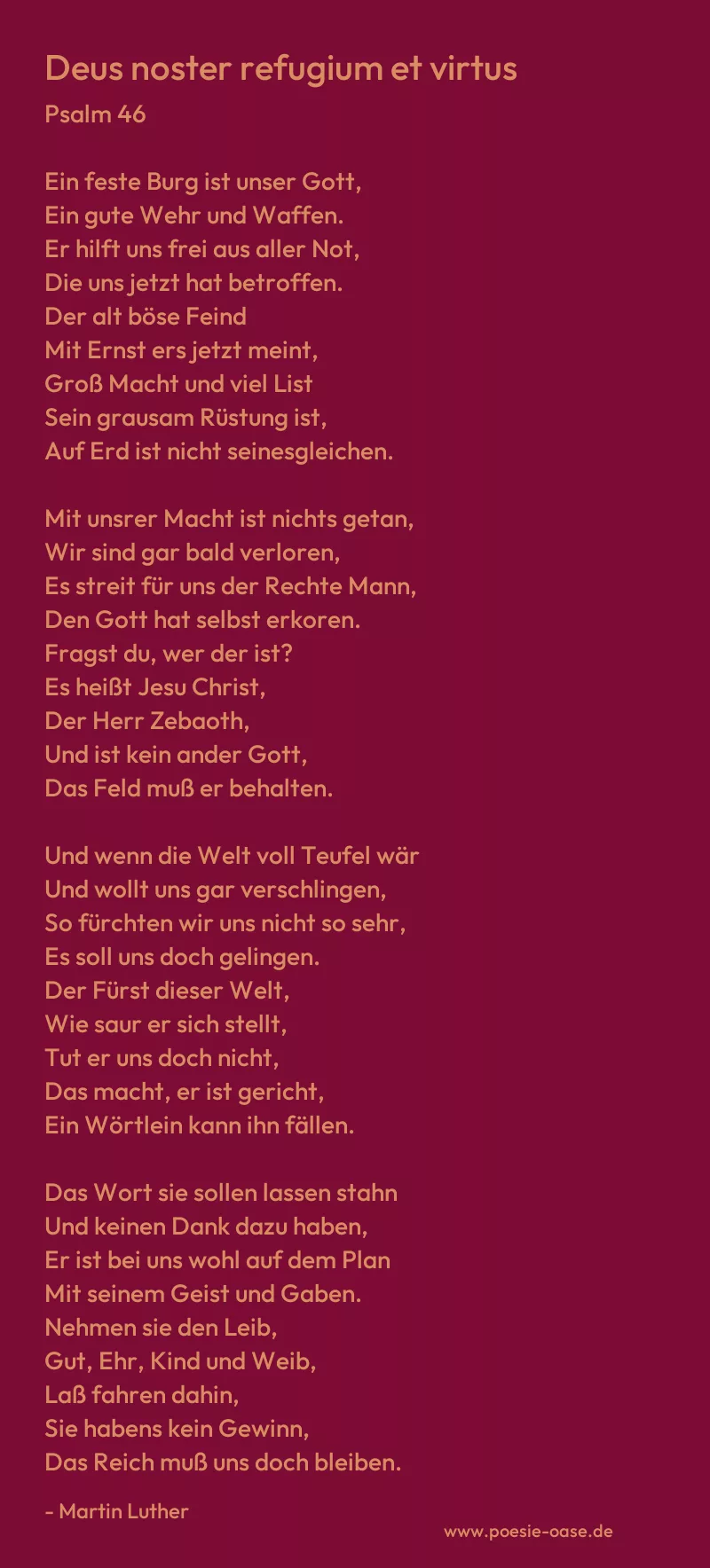
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Deus noster refugium et virtus“ von Martin Luther ist eine freie Übertragung von Psalm 46 und zugleich eines der bekanntesten reformatorischen Lieder: „Ein feste Burg ist unser Gott“. Es kombiniert poetische Ausdruckskraft mit theologischer Tiefe und wurde zu einem zentralen Bekenntnislied der Reformation. Der Text preist Gottes Schutz und Stärke in einer Welt voller Bedrohung und Versuchung und verleiht dem Vertrauen auf göttliche Hilfe eine kämpferische, standhafte Haltung.
Schon die erste Strophe stellt Gott als feste Burg dar – ein Symbol für Schutz, Wehrhaftigkeit und Sicherheit. In einer Welt, die von Gefahr und Unheil geprägt ist („die uns jetzt hat betroffen“), erscheint Gott als zuverlässiger Zufluchtsort. Der „alt böse Feind“, mit „groß Macht und viel List“ ausgestattet, steht für den Teufel und alles Widergöttliche. Ihm ist auf Erden nichts Gleiches, was die Machtlosigkeit des Menschen betont – eine typische lutherische Einsicht in die eigene Abhängigkeit von göttlicher Hilfe.
In der zweiten Strophe wird deutlich, dass menschliche Stärke nicht ausreicht: „Mit unsrer Macht ist nichts getan“. Der entscheidende Beistand kommt von Christus, dem „rechten Mann“, den Gott selbst gesandt hat. Die Bezeichnung „Herr Zebaoth“ verweist auf Christus als Anführer der himmlischen Heerscharen – ein Ausdruck von göttlicher Autorität und Siegesgewissheit.
Die dritte Strophe steigert sich in ihrer bildhaften Dramatik. Selbst wenn „die Welt voll Teufel wär“, kann der Gläubige getrost bleiben. Der Feind mag wüten, doch er ist bereits gerichtet, das heißt: im göttlichen Gerichtsspruch für besiegt erklärt. Das „Wörtlein“, das ihn fällen kann, ist Sinnbild für die Kraft des göttlichen Wortes – ein zentraler reformatorischer Gedanke, dass das Wort Gottes stärker ist als jede irdische oder dämonische Macht.
Die letzte Strophe führt diese Gedanken zu einem radikalen Schluss: Selbst wenn alles Irdische verloren geht – Leib, Besitz, Familie –, ist das kein bleibender Schaden. Denn das „Reich“, also das Gottesreich, bleibt unangetastet. Es ist eine Hymne auf geistige Unabhängigkeit, auf Glaubensfestigkeit und die Priorität des Ewigen über das Vergängliche.
Luthers Gedicht ist somit nicht nur Trostlied, sondern ein kämpferisches Glaubensbekenntnis. Es vereint die existenzielle Erfahrung von Bedrohung mit dem unerschütterlichen Vertrauen auf Gott – in klarer, kraftvoller Sprache, die Theologie und Dichtung in einzigartiger Weise verbindet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.