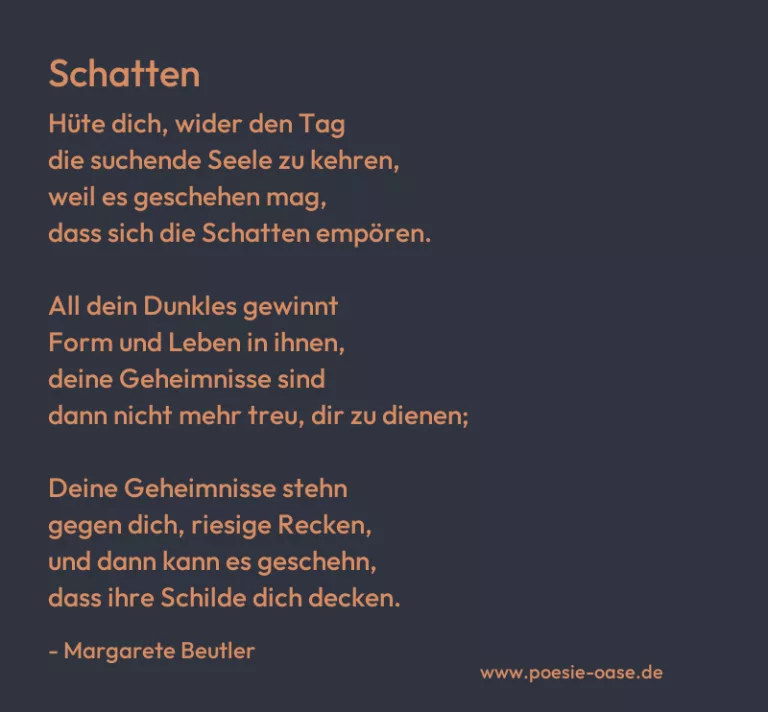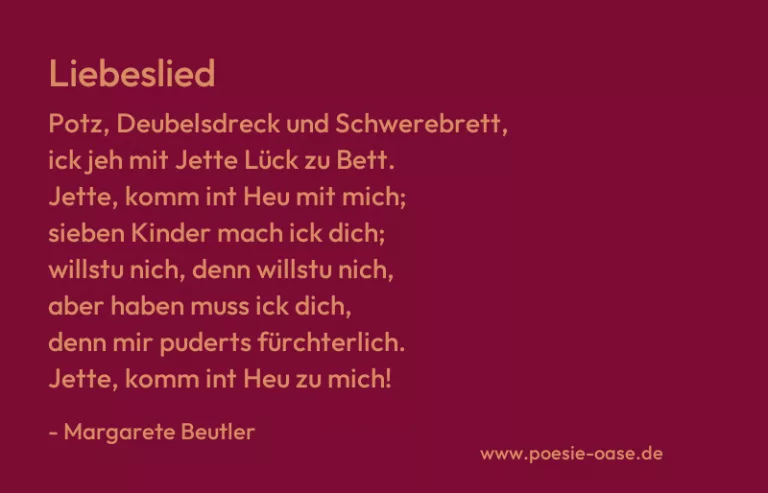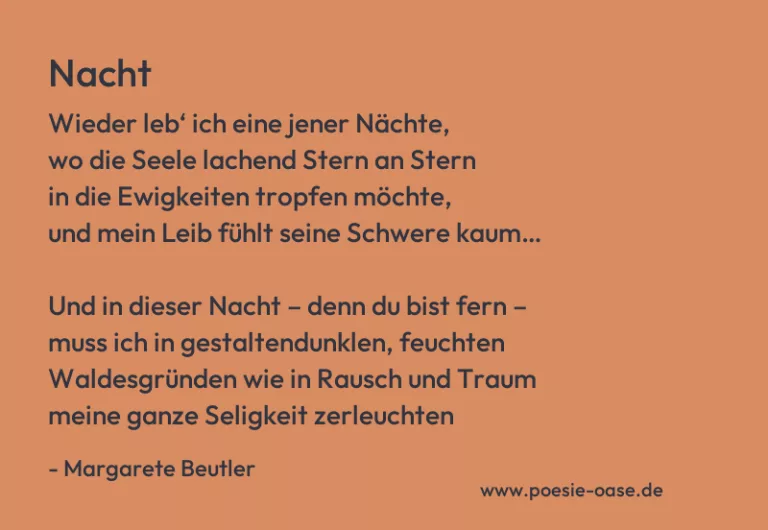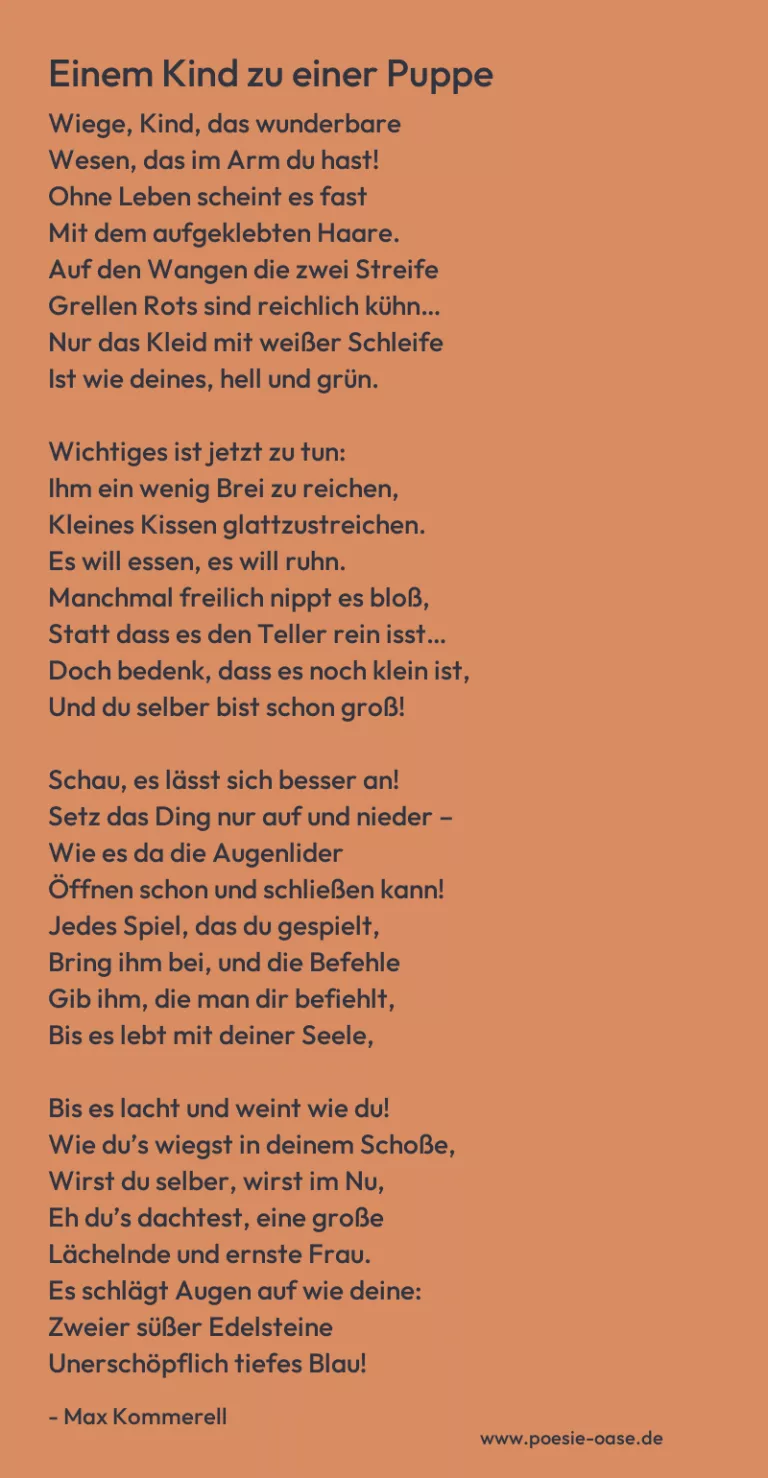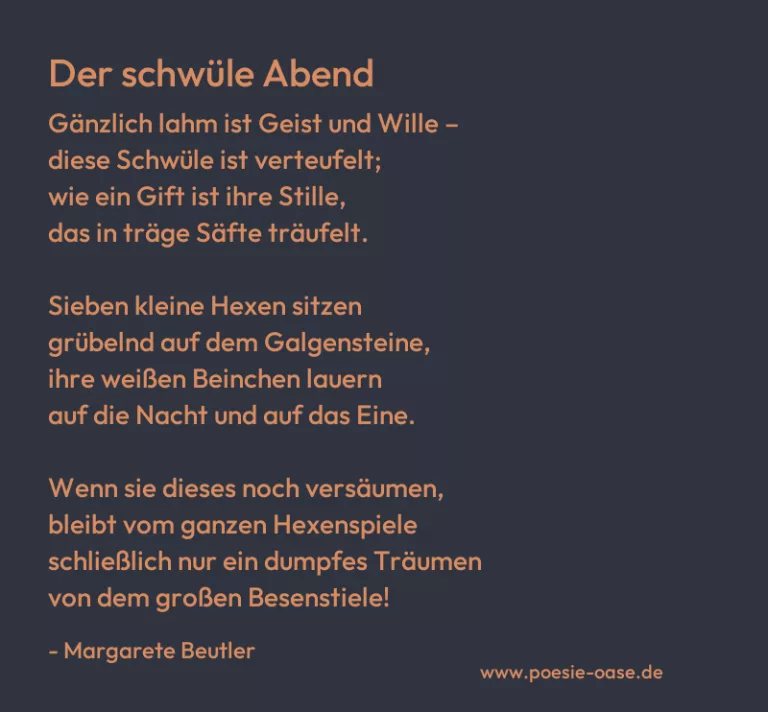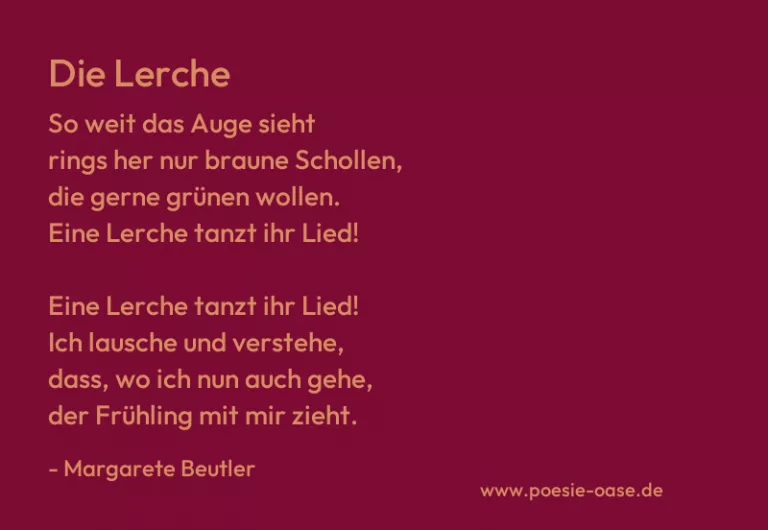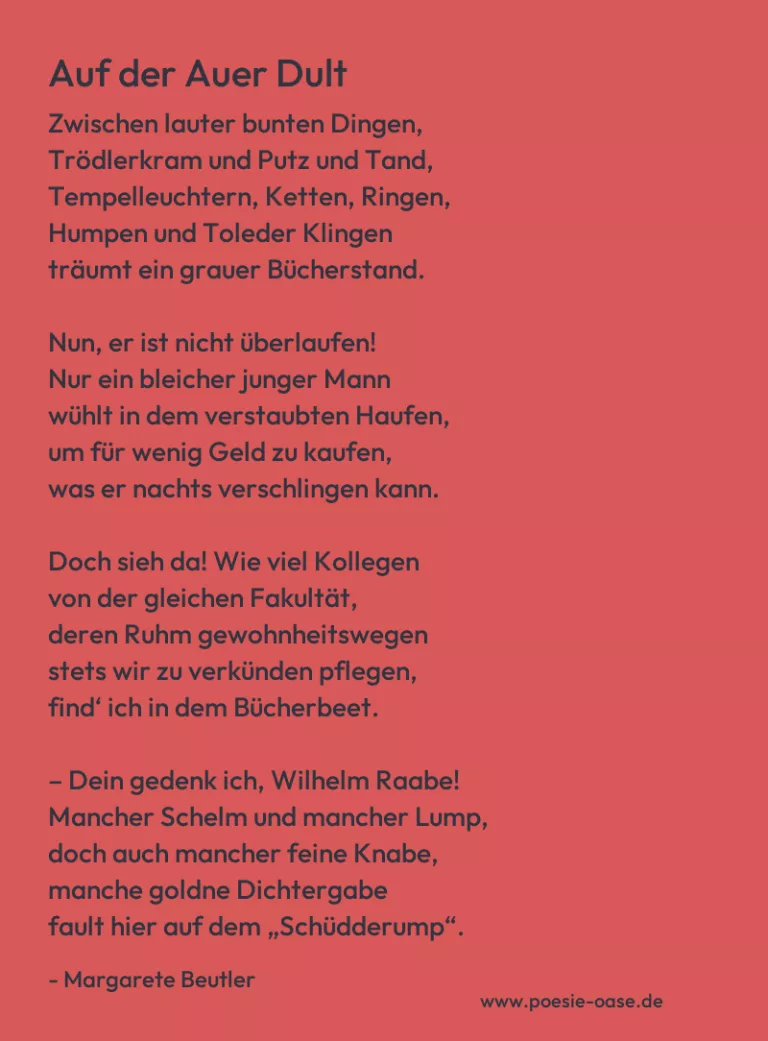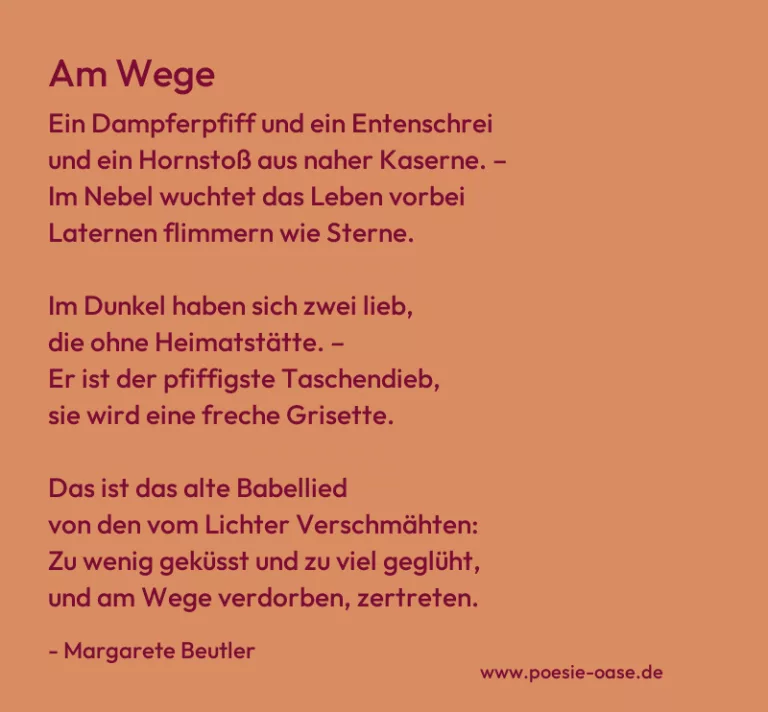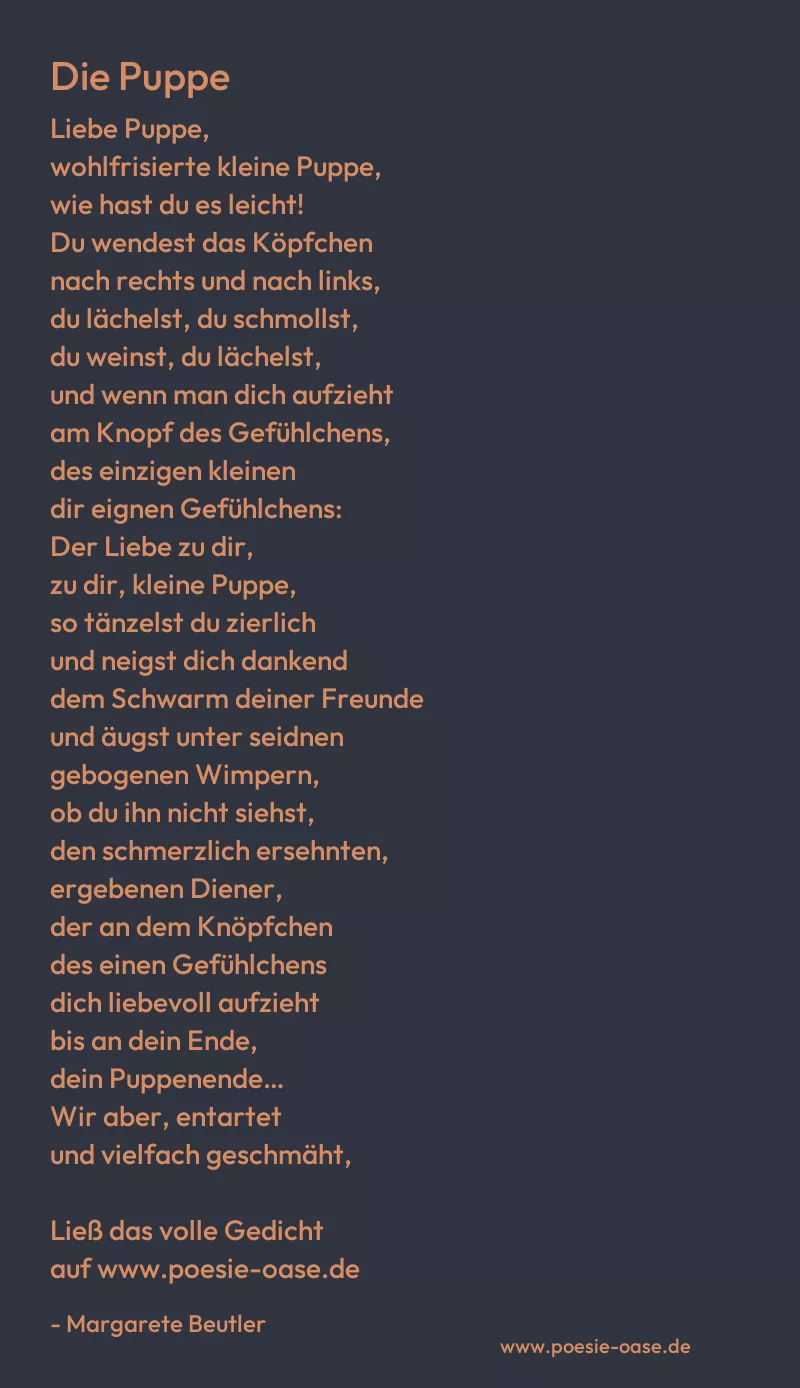Die Puppe
Liebe Puppe,
wohlfrisierte kleine Puppe,
wie hast du es leicht!
Du wendest das Köpfchen
nach rechts und nach links,
du lächelst, du schmollst,
du weinst, du lächelst,
und wenn man dich aufzieht
am Knopf des Gefühlchens,
des einzigen kleinen
dir eignen Gefühlchens:
Der Liebe zu dir,
zu dir, kleine Puppe,
so tänzelst du zierlich
und neigst dich dankend
dem Schwarm deiner Freunde
und äugst unter seidnen
gebogenen Wimpern,
ob du ihn nicht siehst,
den schmerzlich ersehnten,
ergebenen Diener,
der an dem Knöpfchen
des einen Gefühlchens
dich liebevoll aufzieht
bis an dein Ende,
dein Puppenende…
Wir aber, entartet
und vielfach geschmäht,
wir andern, wir Ernsten,
wir Dunklen, wir Schweren,
wir Trägerinnen
geheimen Wissens,
wir Deuterinnen
uralter Runen,
wir keuchen und brechen
fast unter der Last
des gnädigen Schicksals,
das sie uns gab,
unsre sehende Seele,
von der du nichts weißt. –
O liebe Puppe,
wohlfrisierte kleine Puppe,
wie hast du es leicht!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
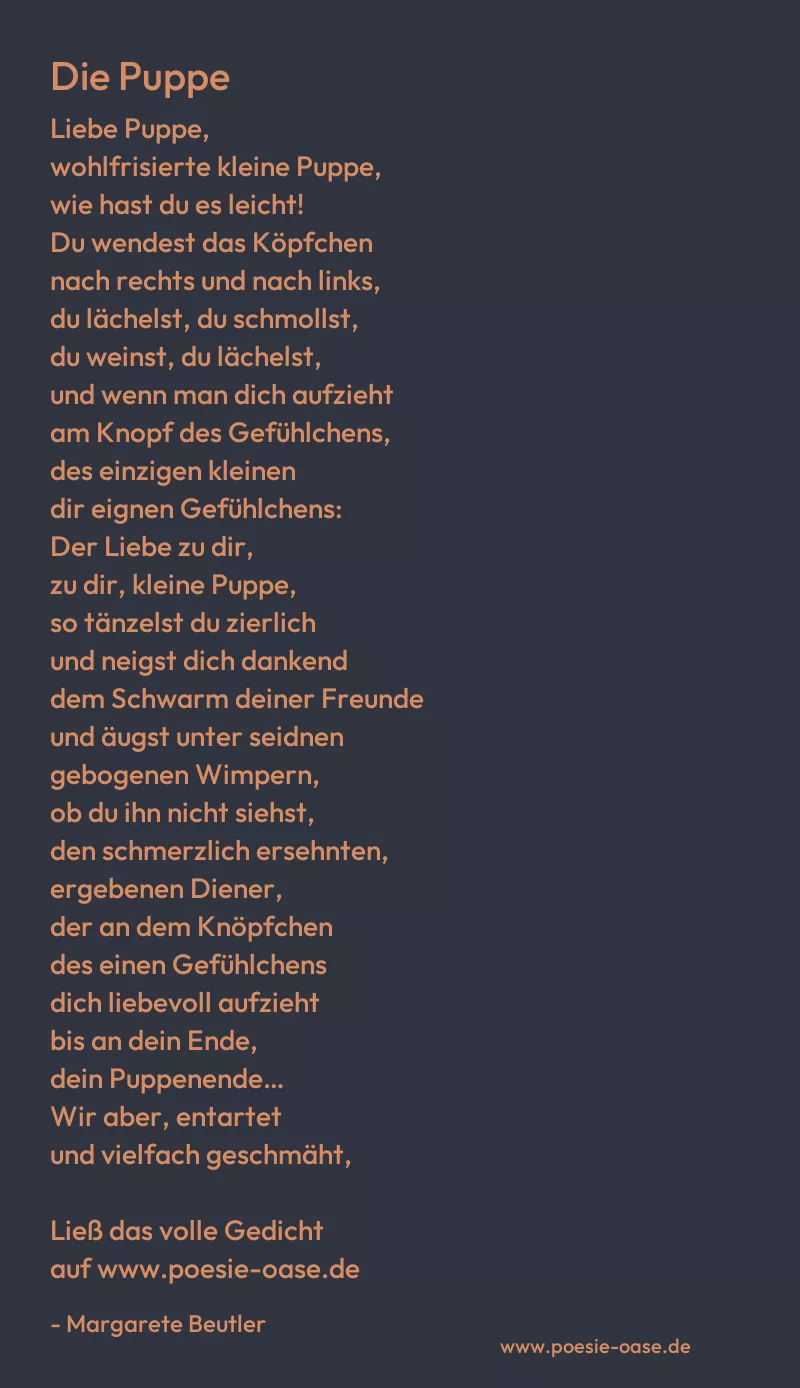
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Puppe“ von Margarete Beutler entfaltet in ironischem Ton eine scharfe Kritik an einem oberflächlichen, angepassten Frauenbild und stellt diesem die komplexe, belastete Existenz der „ernsten“ Frauen gegenüber. Im Zentrum steht eine Puppe, die als Sinnbild für Weiblichkeit ohne Tiefe, für emotionale Automatismen und gesellschaftlich akzeptierte Rollenerwartungen dient. Diese Puppe „tänzelt“ und „äugt“ kokett, sie reagiert auf äußere Impulse mechanisch, ganz ohne eigene innere Welt – ihr einziges „Gefühlchen“ ist die Selbstliebe.
Beutler nutzt die Puppe als Metapher für Frauen, die sich ganz dem Spiel der Erscheinung, der Liebeswerbung und der gefälligen Selbstdarstellung verschreiben. Das Bild der aufziehbaren Figur, die nur dann agiert, wenn man sie am richtigen „Knöpfchen“ berührt, entlarvt dieses Verhalten als künstlich, fremdbestimmt und letztlich leer. Diese Puppe weiß nichts von der „sehenden Seele“, von innerer Tiefe, existenzieller Schwere oder geistiger Eigenständigkeit.
Im scharfen Kontrast dazu stellt das lyrische Ich sich selbst und andere als „Ernste“, „Dunkle“, „Schwere“ dar – als Trägerinnen eines alten Wissens, eines tieferen Verständnisses der Welt und des eigenen Seins. Diese Frauen erscheinen zwar „entartet und vielfach geschmäht“, doch zugleich liegt in ihnen eine Würde und Tiefe, die die Puppe nie erreichen kann. Ihre Last ist groß, sie leiden an ihrer Erkenntnisfähigkeit und Reflexion, aber gerade darin besteht ihre Menschlichkeit und Stärke.
Die wiederholte Anrede „Liebe Puppe“ wirkt daher nicht nur spöttisch, sondern auch anklagend: Die Puppe hat es „leicht“, weil sie sich in einer Welt bewegt, die Komplexität scheut und Oberflächen bevorzugt. Beutler entlarvt so ein patriarchales Ideal der Weiblichkeit, das Weibsein auf Gefälligkeit und Gefühlssimulation reduziert, und hält ihm ein feministisches Gegenbild entgegen – das einer innerlich reichen, aber gesellschaftlich belasteten Frau. Das Gedicht ist eine leise wütende, aber auch poetisch fein gearbeitete Anklage gegen Rollenzwänge und geistige Enge.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.