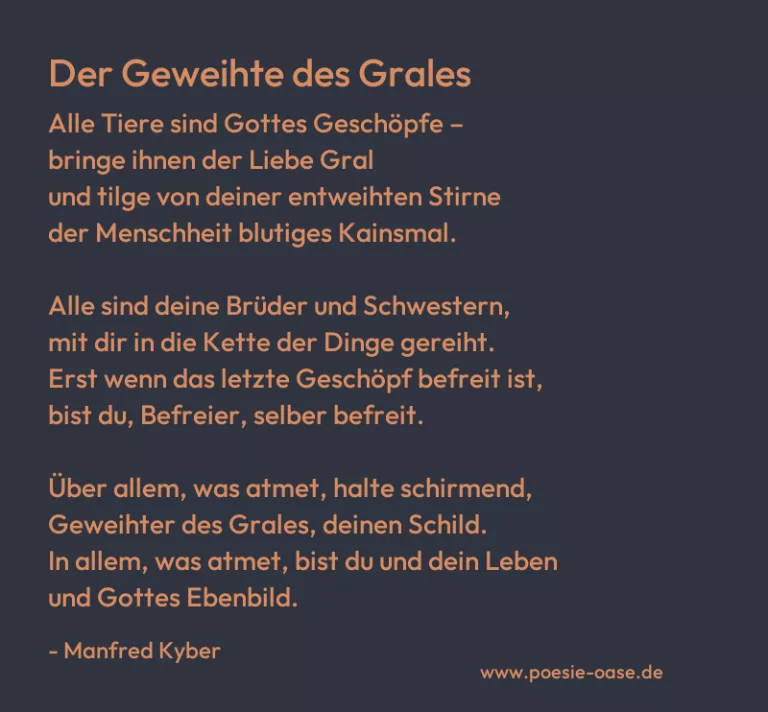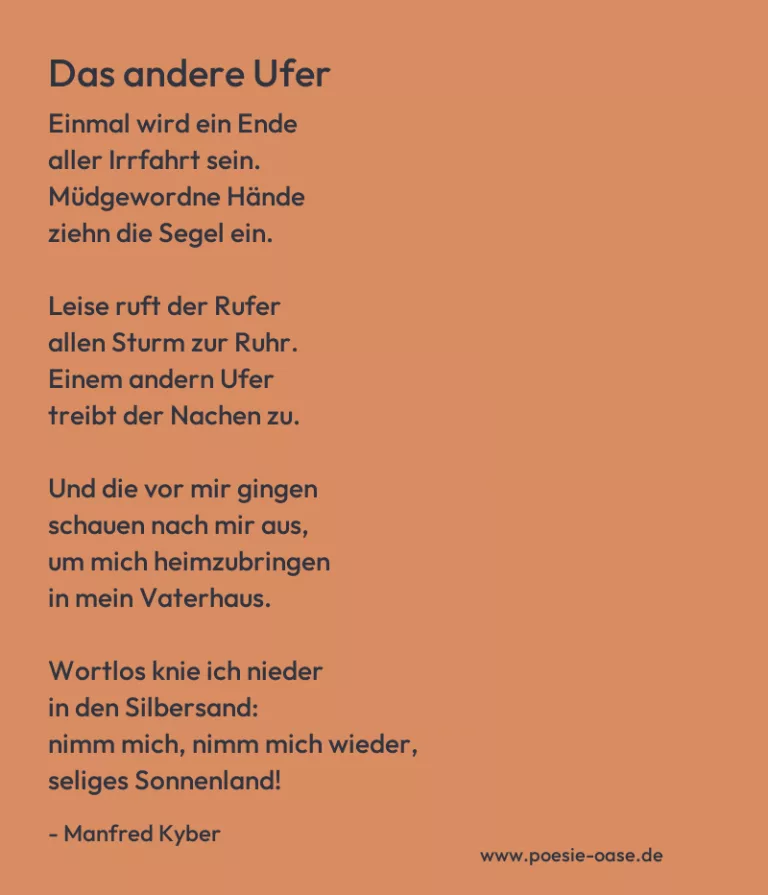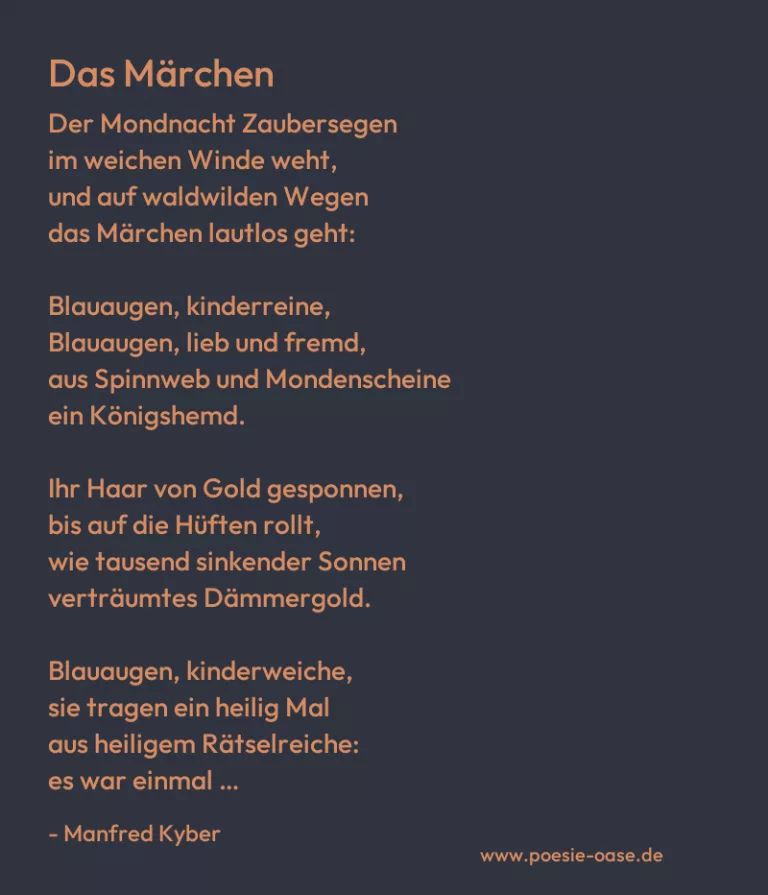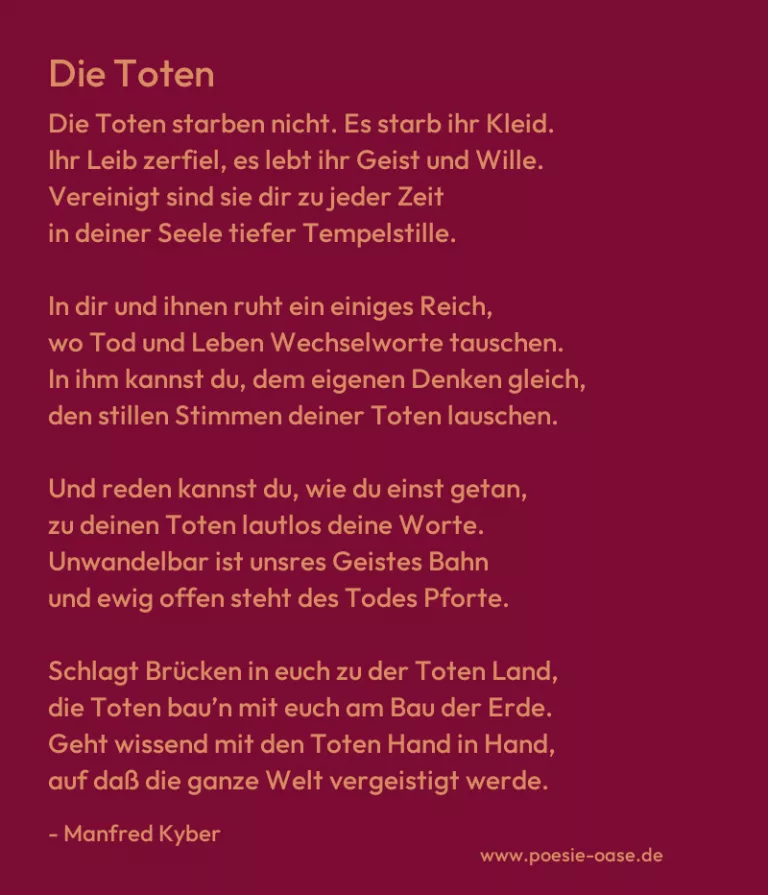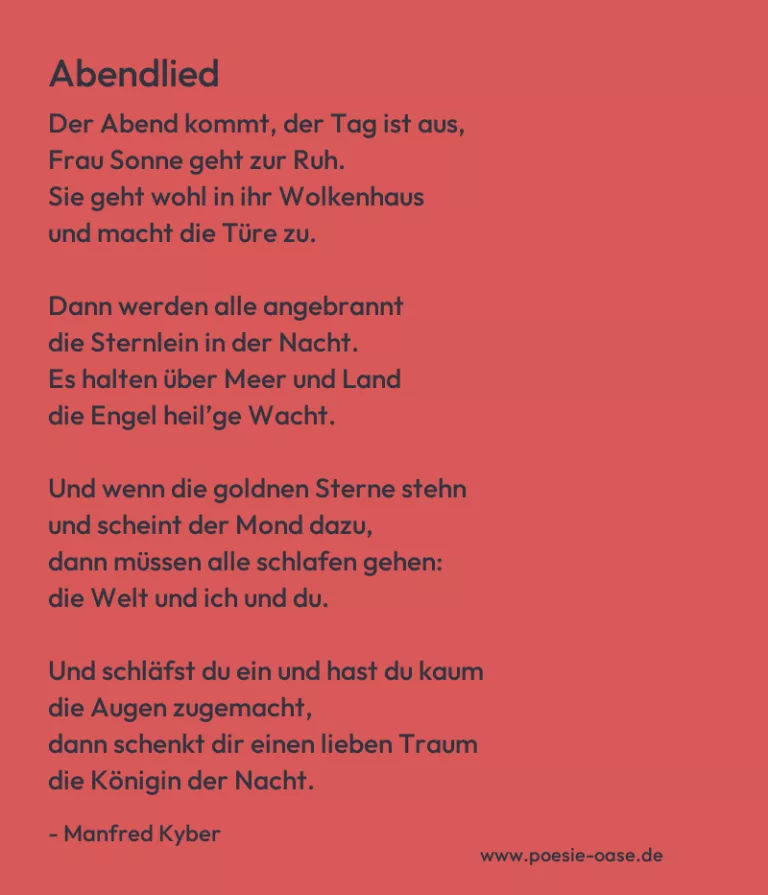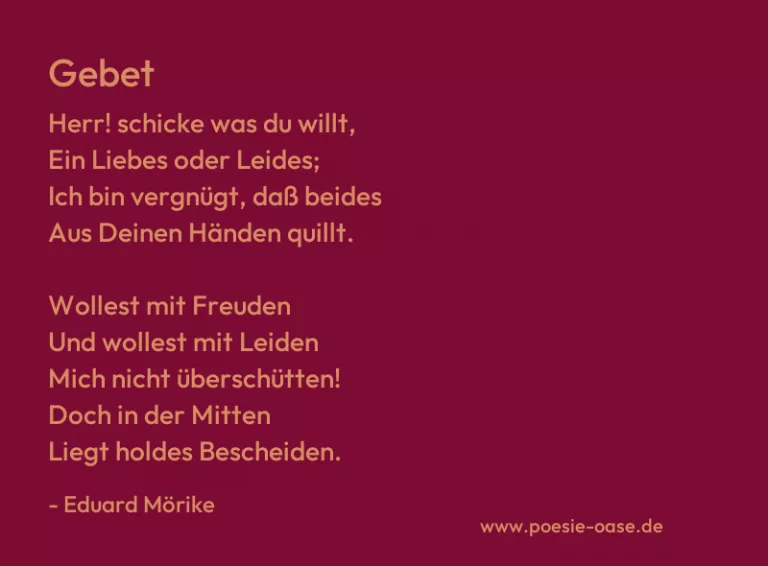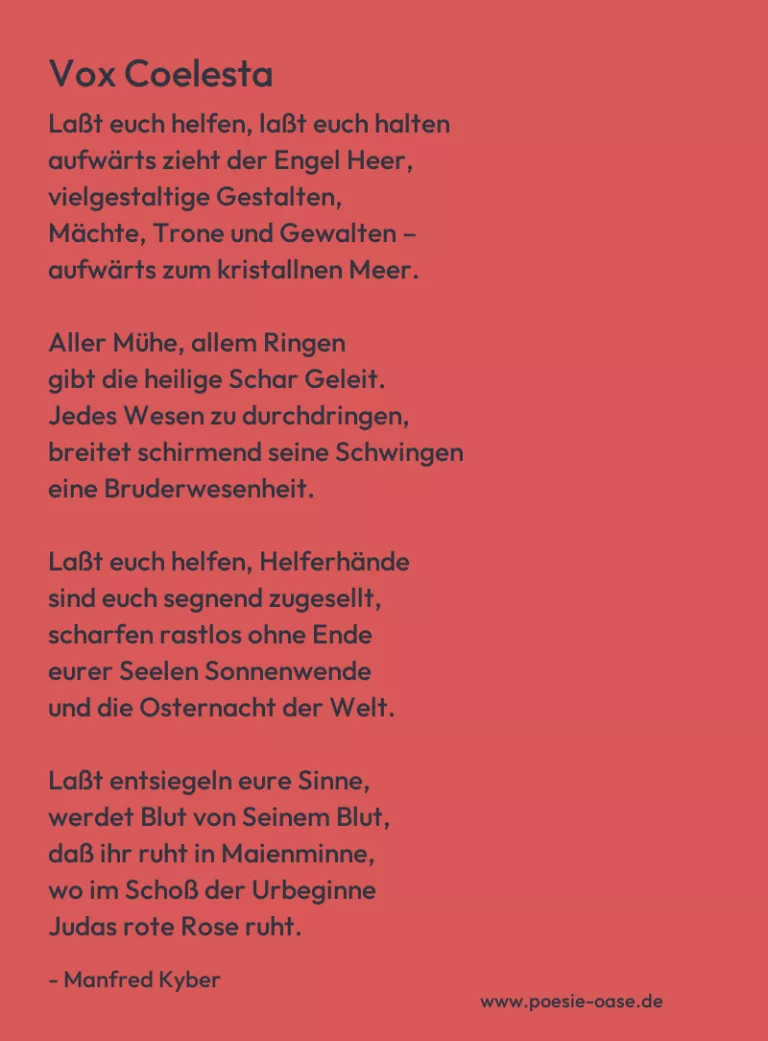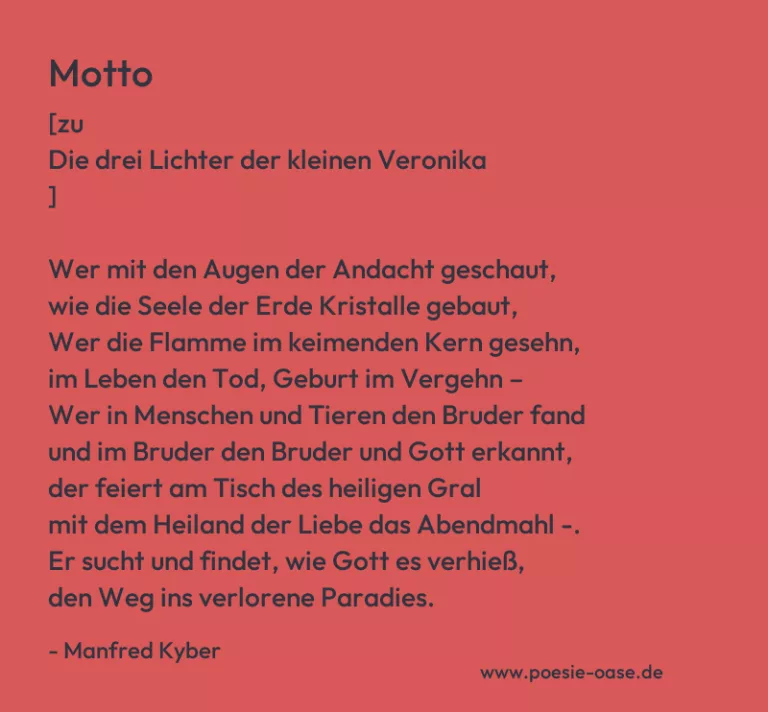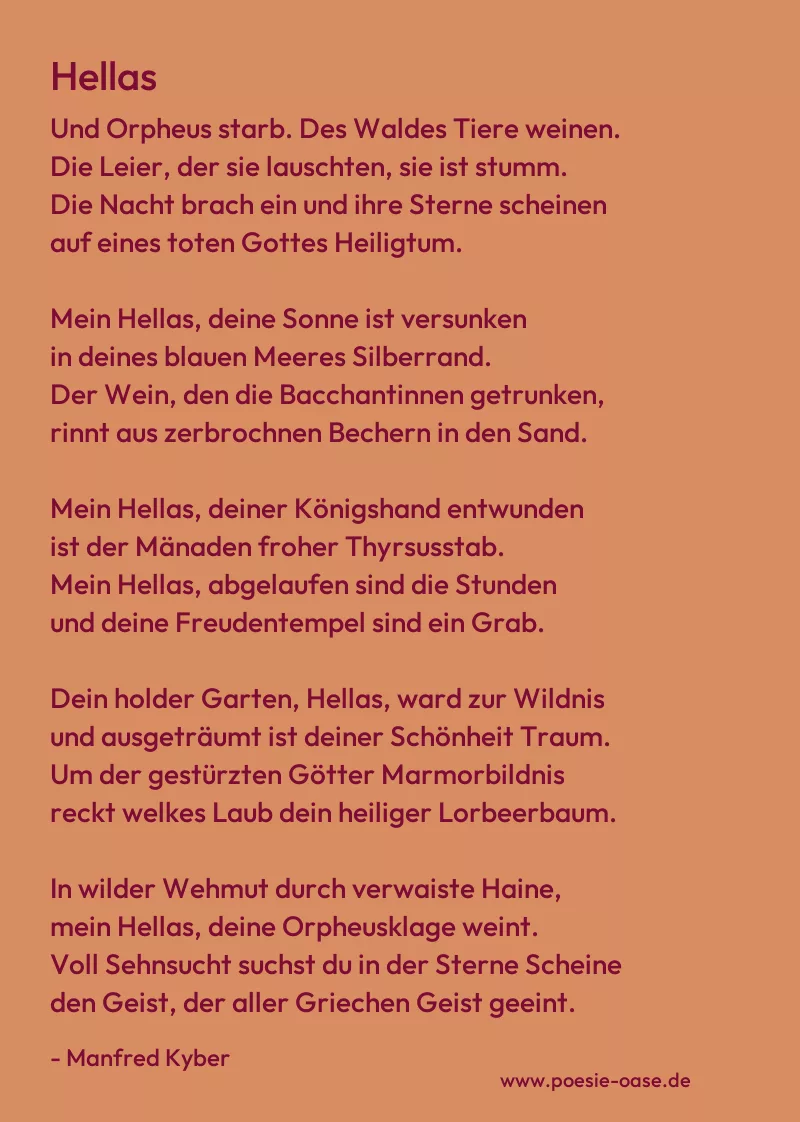Abenteuer & Reisen, Blumen & Pflanzen, Emotionen & Gefühle, Gedanken, Gemeinfrei, Harmonie, Herbst, Herzschmerz, Himmel & Wolken, Legenden, Natur, Sommer, Trauer & Melancholie, Wälder & Bäume, Weihnachten
Hellas
Und Orpheus starb. Des Waldes Tiere weinen.
Die Leier, der sie lauschten, sie ist stumm.
Die Nacht brach ein und ihre Sterne scheinen
auf eines toten Gottes Heiligtum.
Mein Hellas, deine Sonne ist versunken
in deines blauen Meeres Silberrand.
Der Wein, den die Bacchantinnen getrunken,
rinnt aus zerbrochnen Bechern in den Sand.
Mein Hellas, deiner Königshand entwunden
ist der Mänaden froher Thyrsusstab.
Mein Hellas, abgelaufen sind die Stunden
und deine Freudentempel sind ein Grab.
Dein holder Garten, Hellas, ward zur Wildnis
und ausgeträumt ist deiner Schönheit Traum.
Um der gestürzten Götter Marmorbildnis
reckt welkes Laub dein heiliger Lorbeerbaum.
In wilder Wehmut durch verwaiste Haine,
mein Hellas, deine Orpheusklage weint.
Voll Sehnsucht suchst du in der Sterne Scheine
den Geist, der aller Griechen Geist geeint.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
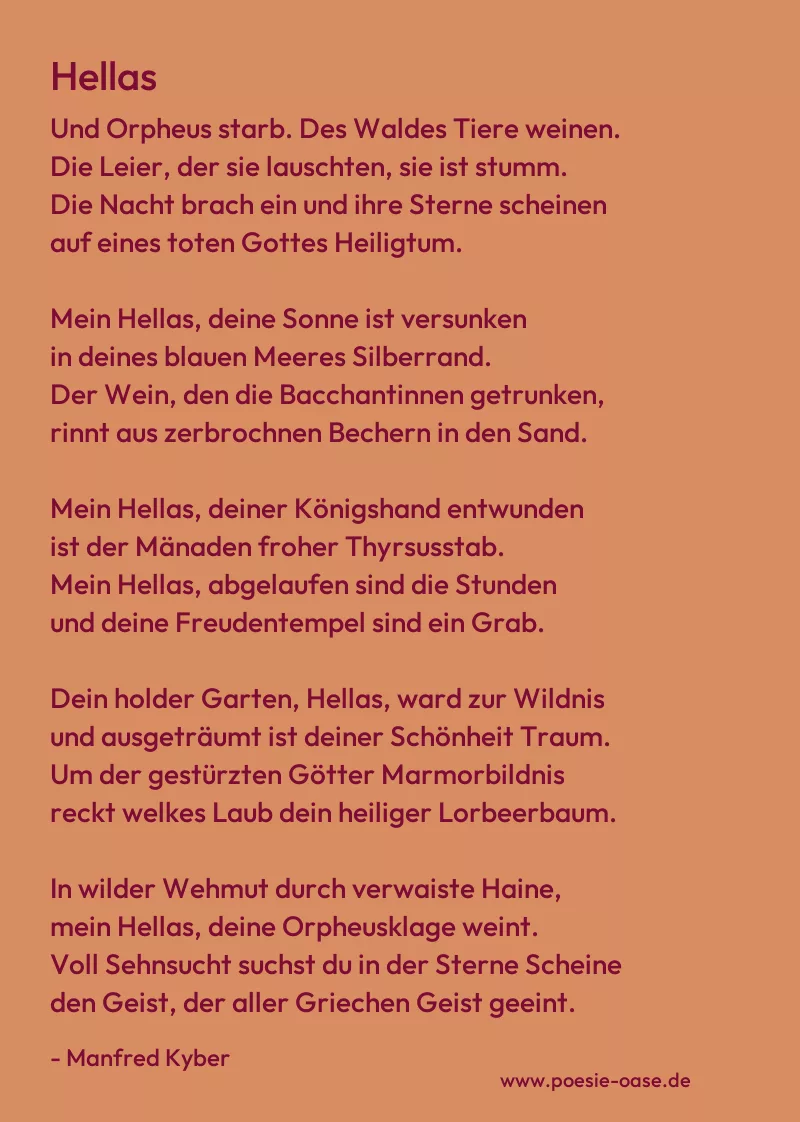
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Hellas“ von Manfred Kyber beschreibt einen elegischen Rückblick auf das antike Griechenland, das für seine Schönheit, Kultur und Götter verehrt wurde, aber nun in Vergessenheit und Verfall versinkt. Zu Beginn wird der Tod des Orpheus, des legendären Sängers, erwähnt, der eine symbolische Rolle für die Zerstörung der Harmonie und des Mythos spielt. Die „Waldes Tiere weinen“, was die Trauer der Natur über den Verlust eines göttlichen Wesens und einer goldenen Ära widerspiegelt. Die „Leier“ des Orpheus, die nun „stumm“ ist, symbolisiert den Verlust der Musik und der Kunst, die im antiken Hellas so hoch geschätzt wurden. Das Bild des „toten Gottes“ und seines „Heiligtums“ verweist auf das Ende der alten Götterwelt und das Verschwinden einer ganzen Ära.
In der zweiten Strophe wird das Bild des versunkenen „Hellas“ weitergeführt, indem die „Sonne“ als Symbol für das strahlende antike Griechenland beschrieben wird, das nun „versunken“ ist. Die „Bacchantinnen“, die für ihre ekstatischen Feste bekannt sind, sind nicht mehr in der Lage, ihren „Wein“ zu genießen, der aus „zerbrochnen Bechern in den Sand rinnt“. Dieses Bild von Zerfall und Verlust ist ein zentrales Motiv des Gedichts, das die Unvergänglichkeit von Schönheit und Freude in der Vergangenheit betrauert.
Der Verlust wird weiter vertieft, indem der „Thyrsusstab“, das Symbol des Bacchus, des Gottes des Weins und der Ekstase, von den „Mänaden“ entrissen wird. Auch die „Freudentempel“ sind nicht mehr die lebendigen Orte der Verehrung und Freude, sondern „ein Grab“. Diese Bilder des Verfalls und der Zerstörung verstärken das Gefühl, dass das antike Griechenland seine glorreichen Tage hinter sich gelassen hat.
In der vierten Strophe wird der einstige „holde Garten“ Griechenlands, ein Symbol für das goldene Zeitalter, zu einer „Wildnis“. Der „heilige Lorbeerbaum“, einst ein Zeichen des Ruhms und der Pracht, ist von „welkem Laub“ bedeckt und symbolisiert den Niedergang der antiken Schönheit. Das Bild der „gestürzten Götter“ und des „Marmorbildnisses“ verweist auf die Unbeständigkeit von Göttern und Idealen, die im Verfall begriffen sind.
In der letzten Strophe durchwandert der Sprecher, von „wilder Wehmut“ erfüllt, die verwaisten „Haine“ von Hellas, während die „Orpheusklage“ die Trauer und Sehnsucht nach einer vergangenen Zeit ausdrückt. Der Blick „in der Sterne Scheine“ sucht nach dem „Geist, der aller Griechen Geist geeint“ – einem idealisierten, vereinten Geist des antiken Griechenlands, der jedoch nur noch im Sternenhimmel und in der Erinnerung lebt. Das Gedicht endet mit einer melancholischen Sehnsucht nach der verlorenen Ära, in der die Harmonie von Kunst, Mythos und Philosophie untrennbar miteinander verbunden war.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.