Man frage nicht, was all die Zeit ich machte.
Ich bliebe stumm;
und sage nicht, warum.
Und Stille gibt es, daß die Erde krachte.
Kein Wort, das traf;
man spricht nur aus dem Schlaf.
Und träumt von einer Sonne, welche lachte.
Es geht vorbei;
nachher war′s einerlei.
Das Wort entschlief, als jene Zeit erwachte.
Man frage nicht
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
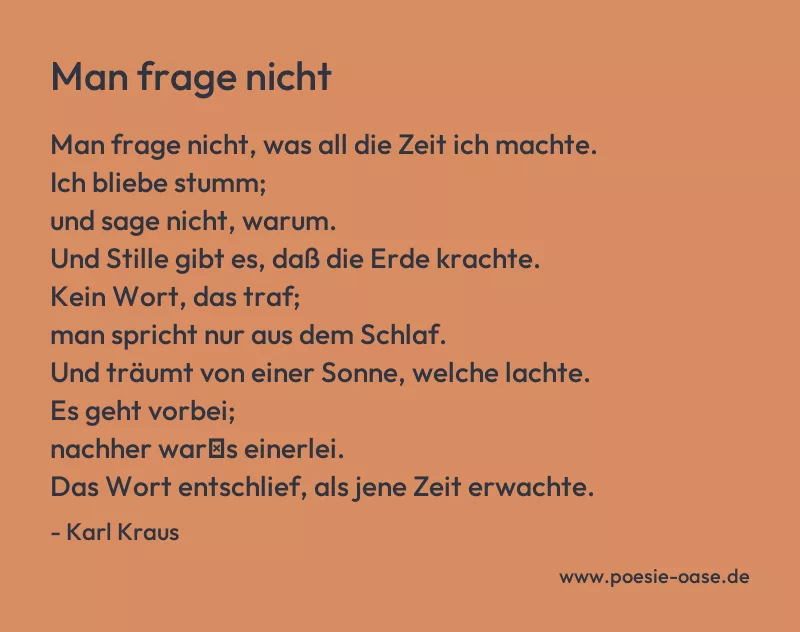
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Man frage nicht“ von Karl Kraus ist eine tiefgründige Reflexion über Schweigen, Zeit und die Unfähigkeit des Wortes, die tiefsten Erfahrungen zu fassen. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Sinnlosigkeit des Erzählens, wenn das Erlebte die Dimensionen der Sprache sprengt. Das Gedicht beginnt mit einem kategorischen „Man frage nicht“ und einer anschließenden Bekundung der Stummheit, was eine klare Abgrenzung von der Erwartungshaltung des Fragenden darstellt. Es suggeriert, dass die Erlebnisse, die die Stille auslösen, so überwältigend sind, dass jede verbale Äußerung scheitern muss.
Die zweite Strophe verstärkt diese Idee, indem sie die Macht der Stille beschreibt, die sogar die Erde zum Bersten bringen kann. Die Phrase „Kein Wort, das traf“ deutet auf die Unzulänglichkeit der Sprache hin, die nicht in der Lage ist, die Essenz des Erlebten zu erfassen. Das Sprechen wird auf den Zustand des Schlafes reduziert, was andeutet, dass die Worte lediglich Reflexionen eines unbewussten Zustands sind. Das Bild der „Sonne, welche lachte“ im Traum deutet auf eine Sehnsucht nach einer verlorenen oder unerreichbaren Freude hin, was die Kluft zwischen der erlebten Realität und dem, was ausgedrückt werden kann, weiter verdeutlicht. Der Hinweis auf das Träumen impliziert eine Distanzierung von der realen Welt und eine Hinwendung zu einer inneren, vielleicht auch verletzlichen Erfahrungsebene.
Die abschließenden Verse „Es geht vorbei; / nachher war’s einerlei“ drücken die Vergänglichkeit aus und die Erkenntnis, dass die Bedeutung des Erlebten im Nachhinein schwindet. Die Zeit, die vergeht, nimmt der Erinnerung ihre Schärfe, wodurch die Erfahrungen in eine Gleichgültigkeit übergehen. Der Verlust der Bedeutung wird durch das „Wort entschlief, als jene Zeit erwachte“ nochmals betont. Dies deutet auf einen doppelten Verlust hin: den Verlust des Erlebnisses und den Verlust der Fähigkeit, es in Worte zu fassen, wenn die Zeit des Erlebens vorüber ist. Die Erwachen der Zeit korrespondiert mit dem Einschlafen des Wortes, was die Unvereinbarkeit von Erfahrung und sprachlicher Ausdrucksmöglichkeit unterstreicht.
Insgesamt ist das Gedicht eine Meditation über die Grenzen der Sprache und die Unfähigkeit, tiefgreifende Erfahrungen adäquat zu kommunizieren. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Stille als dem authentischsten Ausdruck des Erlebten und der Vergänglichkeit, die jede Erfahrung im Lauf der Zeit relativiert. Kraus drückt hier eine tiefe Skepsis gegenüber der Reduzierung komplexer Erfahrungen auf sprachliche Formeln aus und betont die Bedeutung der Stille als Ausdrucksform, die das Unaussprechliche bewahren kann. Das Gedicht hinterlässt den Leser mit der Erkenntnis, dass manche Dinge am besten unausgesprochen bleiben.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
