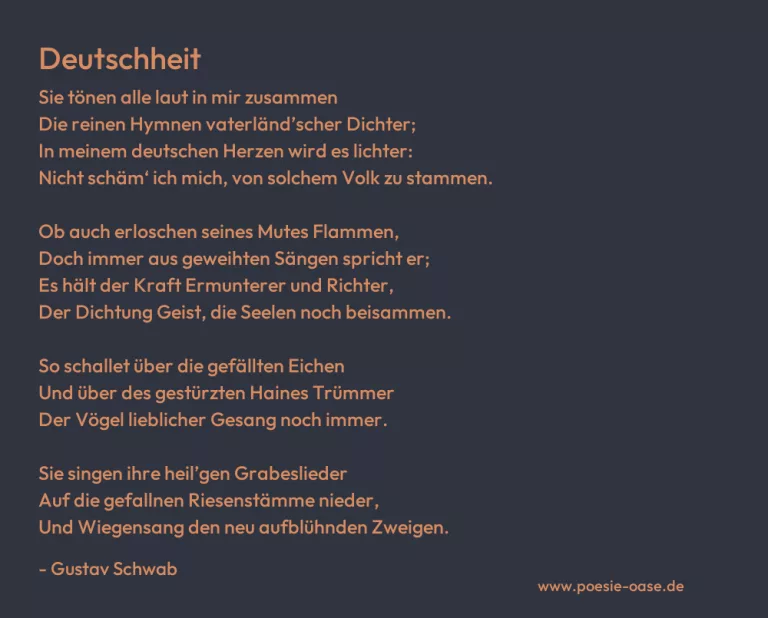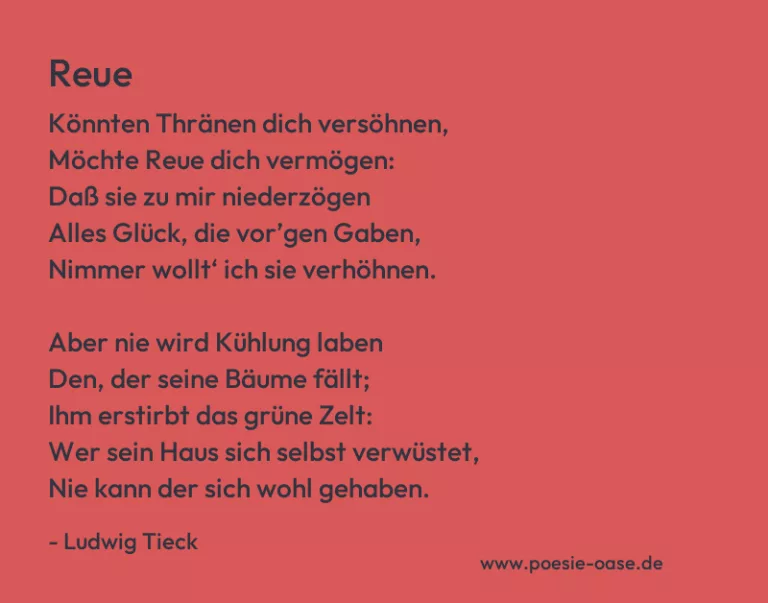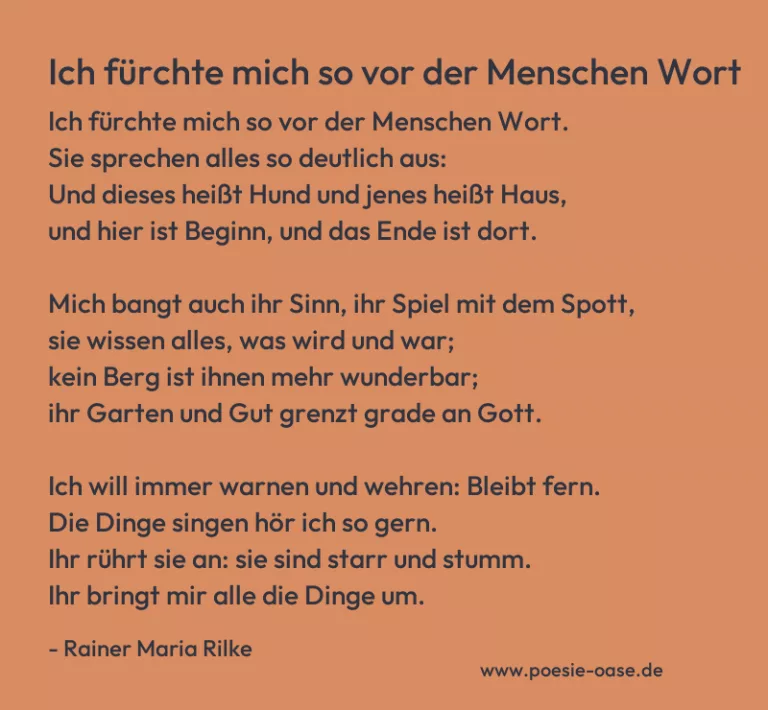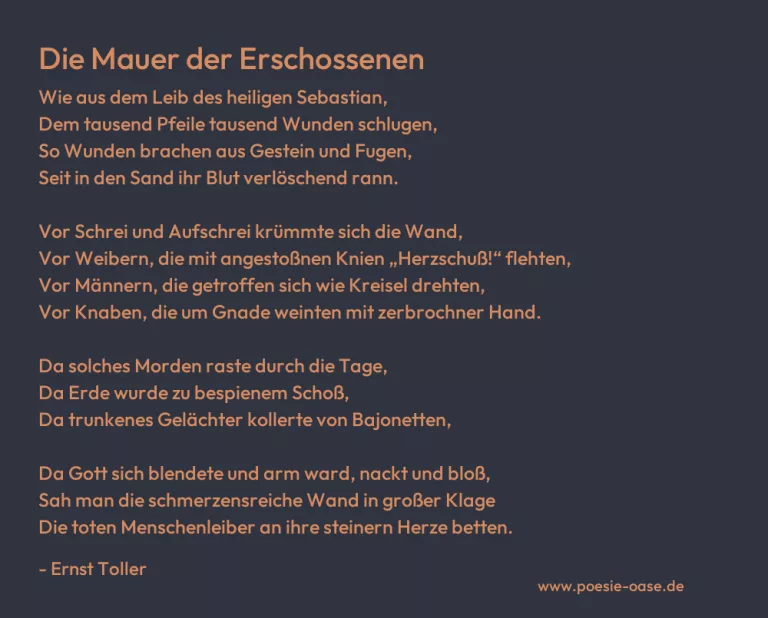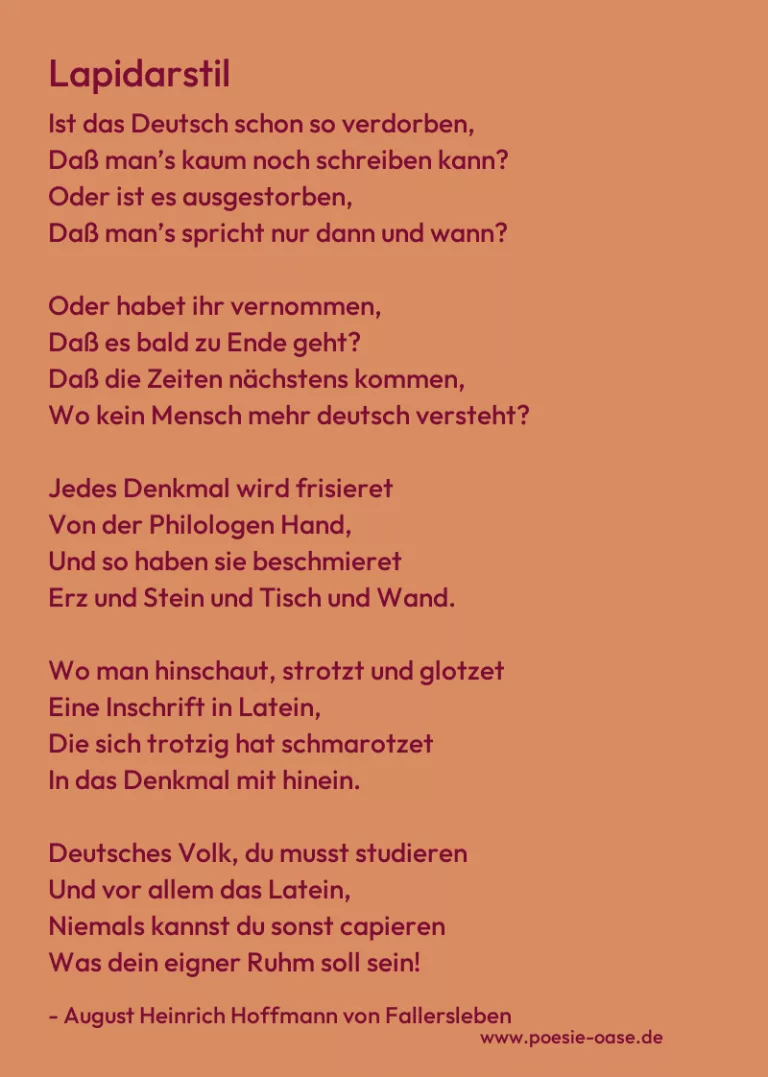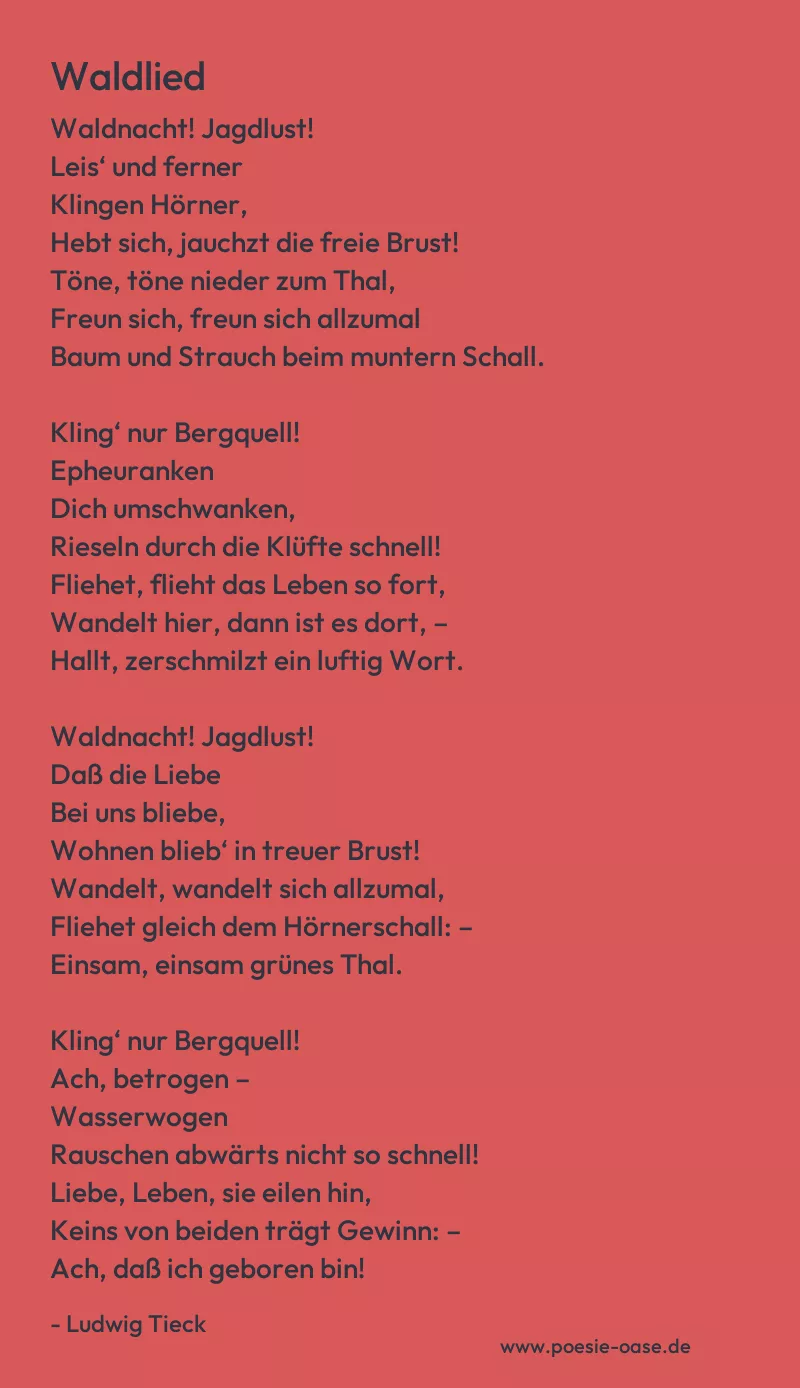Waldlied
Waldnacht! Jagdlust!
Leis‘ und ferner
Klingen Hörner,
Hebt sich, jauchzt die freie Brust!
Töne, töne nieder zum Thal,
Freun sich, freun sich allzumal
Baum und Strauch beim muntern Schall.
Kling‘ nur Bergquell!
Epheuranken
Dich umschwanken,
Rieseln durch die Klüfte schnell!
Fliehet, flieht das Leben so fort,
Wandelt hier, dann ist es dort, –
Hallt, zerschmilzt ein luftig Wort.
Waldnacht! Jagdlust!
Daß die Liebe
Bei uns bliebe,
Wohnen blieb‘ in treuer Brust!
Wandelt, wandelt sich allzumal,
Fliehet gleich dem Hörnerschall: –
Einsam, einsam grünes Thal.
Kling‘ nur Bergquell!
Ach, betrogen –
Wasserwogen
Rauschen abwärts nicht so schnell!
Liebe, Leben, sie eilen hin,
Keins von beiden trägt Gewinn: –
Ach, daß ich geboren bin!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
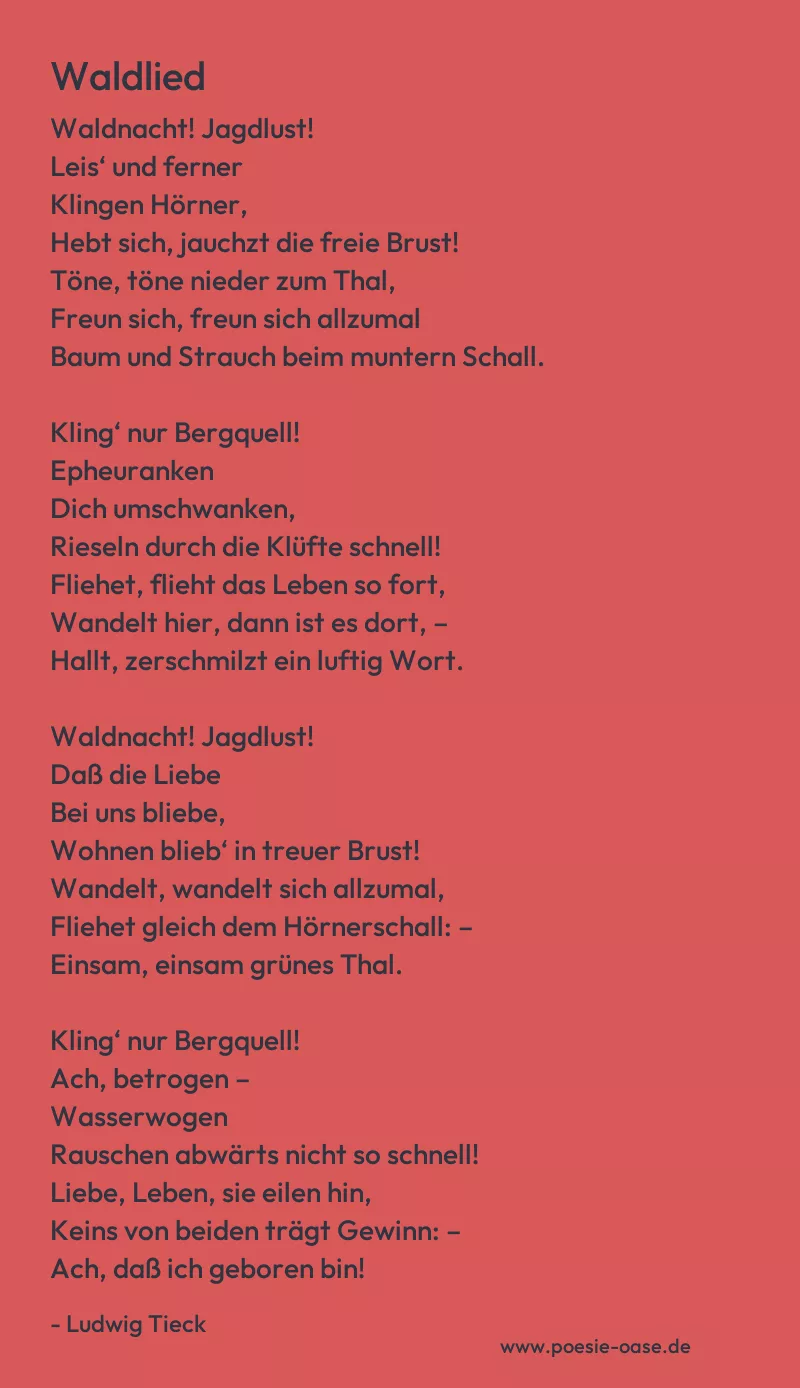
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Waldlied“ von Ludwig Tieck beschreibt eine emotionale und zugleich naturverbundene Darstellung von Liebe, Sehnsucht und Vergänglichkeit. Die erste Strophe öffnet mit der „Waldnacht“ und einer Atmosphäre der Jagdlust, die durch das „leise“ Klingen von Hörnern und das „Jauchzen“ der „freien Brust“ lebendig wird. Es wird ein Bild von Freiheit und Lebenslust gezeichnet, in dem die Natur, represented durch Bäume und Sträucher, mit dem Klang der Jagdhörner in Harmonie schwingt. Die Musik und der Klang scheinen die Natur zu erwecken und in eine freudige Bewegung zu versetzen.
In der zweiten Strophe wird der Klang des Bergquells als ein weiterer wichtiger Naturklang eingeführt, der das Bild der bewegten Natur und der Freiheit verstärkt. Die „Epheuranken“ und die „Klüfte“ symbolisieren die Natur, die im stetigen Fluss ist, während die fließenden Wasser den Verlauf des Lebens metaphorisch widerspiegeln. Der Vers „Fliehet, flieht das Leben so fort“ spricht die Vergänglichkeit des Lebens und die Flüchtigkeit der Momente an. Die letzte Zeile, „Hallt, zerschmilzt ein luftig Wort“, weist darauf hin, dass auch Worte und Gedanken nicht lange bestehen bleiben, sondern sich im Wind der Zeit auflösen.
In der dritten Strophe wendet sich das Gedicht stärker der Thematik der Liebe zu. Der Wunsch, dass die Liebe „bei uns bliebe“ und in „treuer Brust“ wohnen sollte, wird formuliert. Diese Bitte um Beständigkeit wird jedoch von der Erkenntnis überschattet, dass auch die Liebe vergänglich ist. Die Veränderung und das Fortfliehen der Liebe wird mit dem Klang des Jagdhorns verglichen, das ebenso schnell verhallt wie die Liebe selbst. Die „Einsamkeit“ des grünen Tales am Ende dieser Strophe deutet darauf hin, dass trotz der schönen, anfangs lebendigen Natur, letztlich ein Gefühl der Einsamkeit und der Vergänglichkeit zurückbleibt.
Die letzte Strophe vertieft die Melancholie und Enttäuschung, indem der Bergquell nicht mehr als Symbol für das Leben, sondern für den „betrogenen“ Wasserfluss erscheint, der „nicht so schnell“ rauscht. Die Liebe und das Leben eilen „hin“, ohne dass sie etwas Beständiges oder Gewinnbringendes hinterlassen. Der verzweifelte Ausruf „Ach, dass ich geboren bin!“ drückt das Gefühl des Sprechers aus, dass das Leben, trotz aller Freuden und Sehnsüchte, letztlich unerfüllt bleibt und von einer tiefen, existenziellen Enttäuschung begleitet ist.
Tieck nutzt in diesem Gedicht die Naturbilder des Waldes, des Bergquells und der Jagdlust als Metaphern für das Leben, die Liebe und die Vergänglichkeit. Während zu Beginn eine Atmosphäre der Freude und Freiheit herrscht, verwandelt sich die Stimmung gegen Ende in eine düstere Reflexion über die Unbeständigkeit und das Unvermögen des Lebens, dauerhaftes Glück zu bieten. Das Gedicht spiegelt die romantische Haltung wider, dass das Streben nach Liebe und Erfüllung oft von Enttäuschung und der Erkenntnis der Vergänglichkeit überschattet wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.