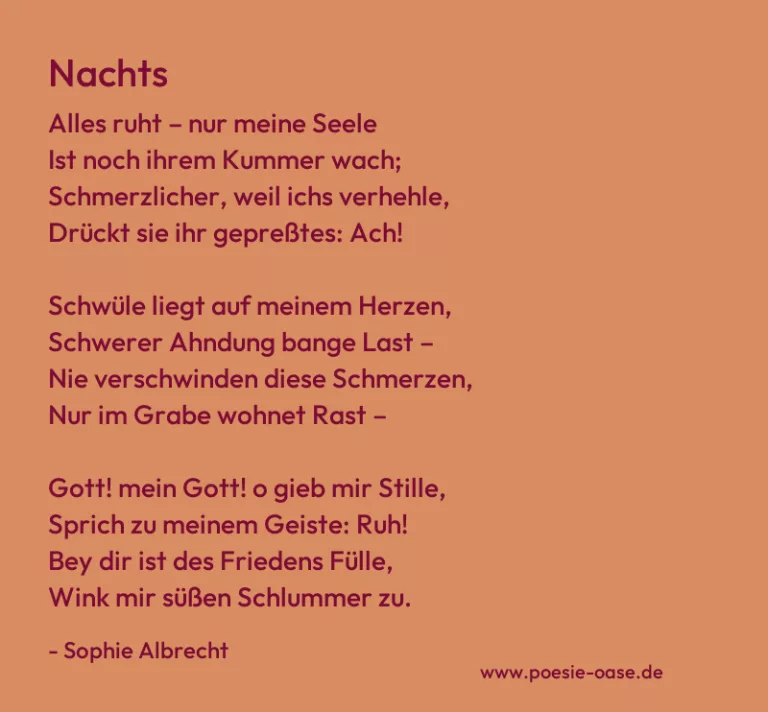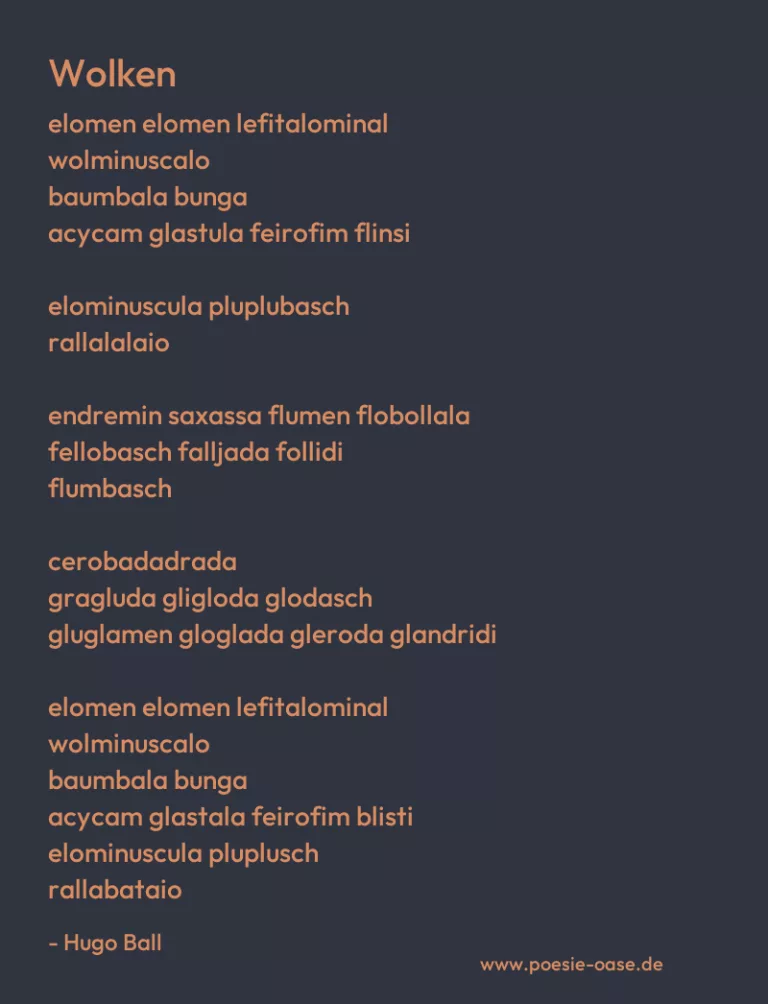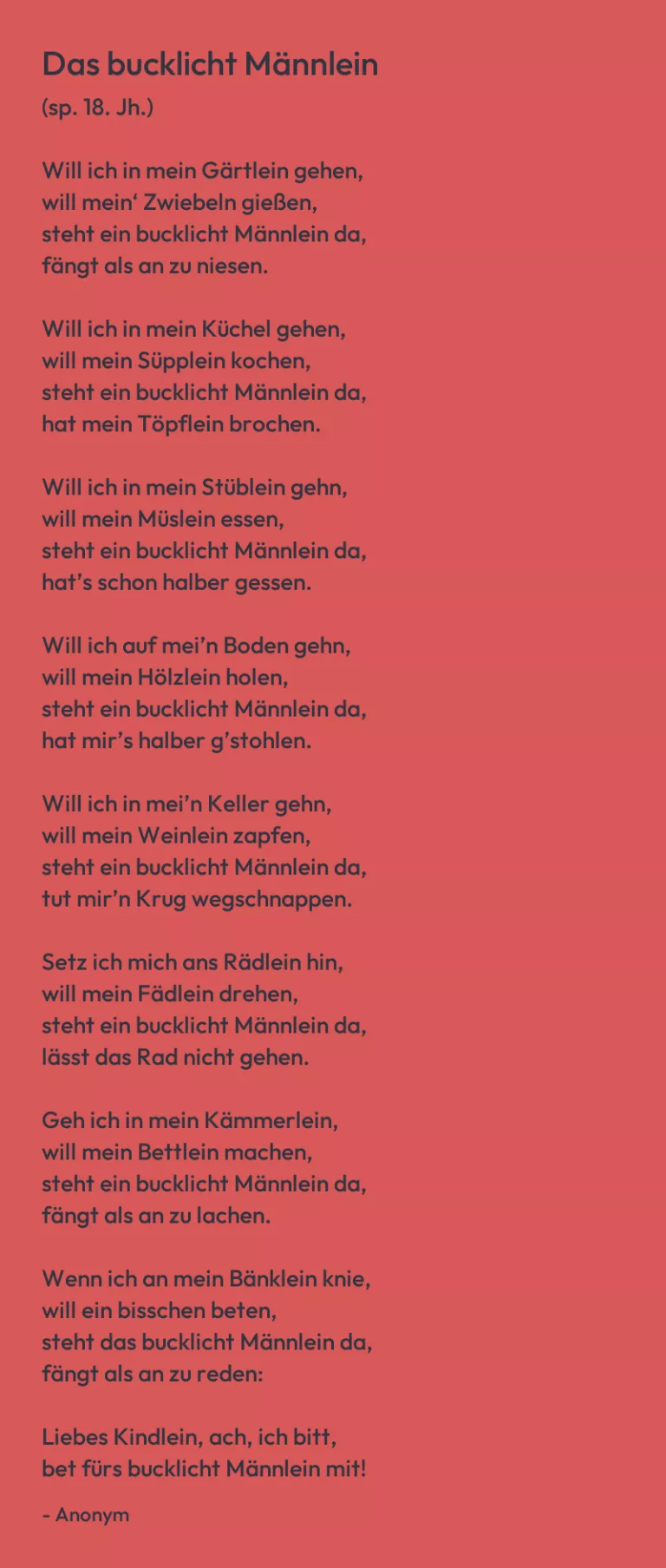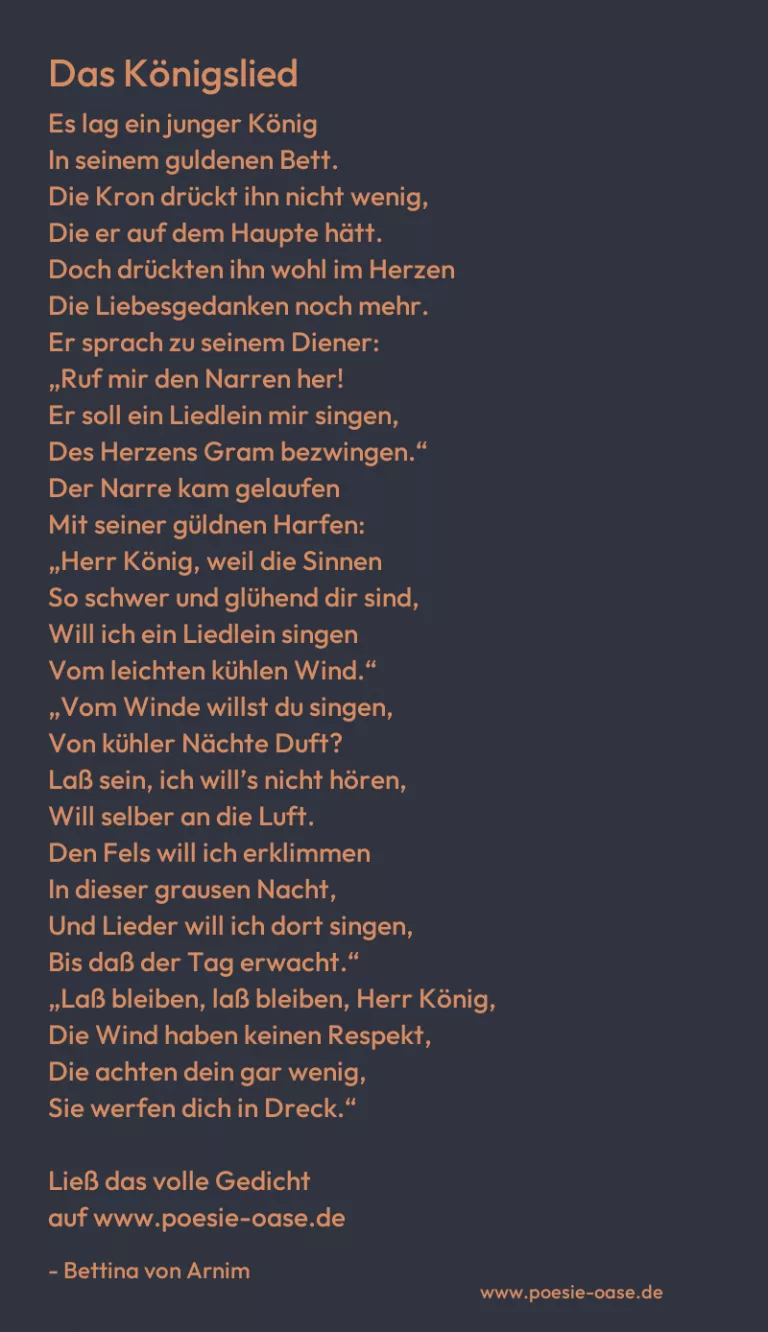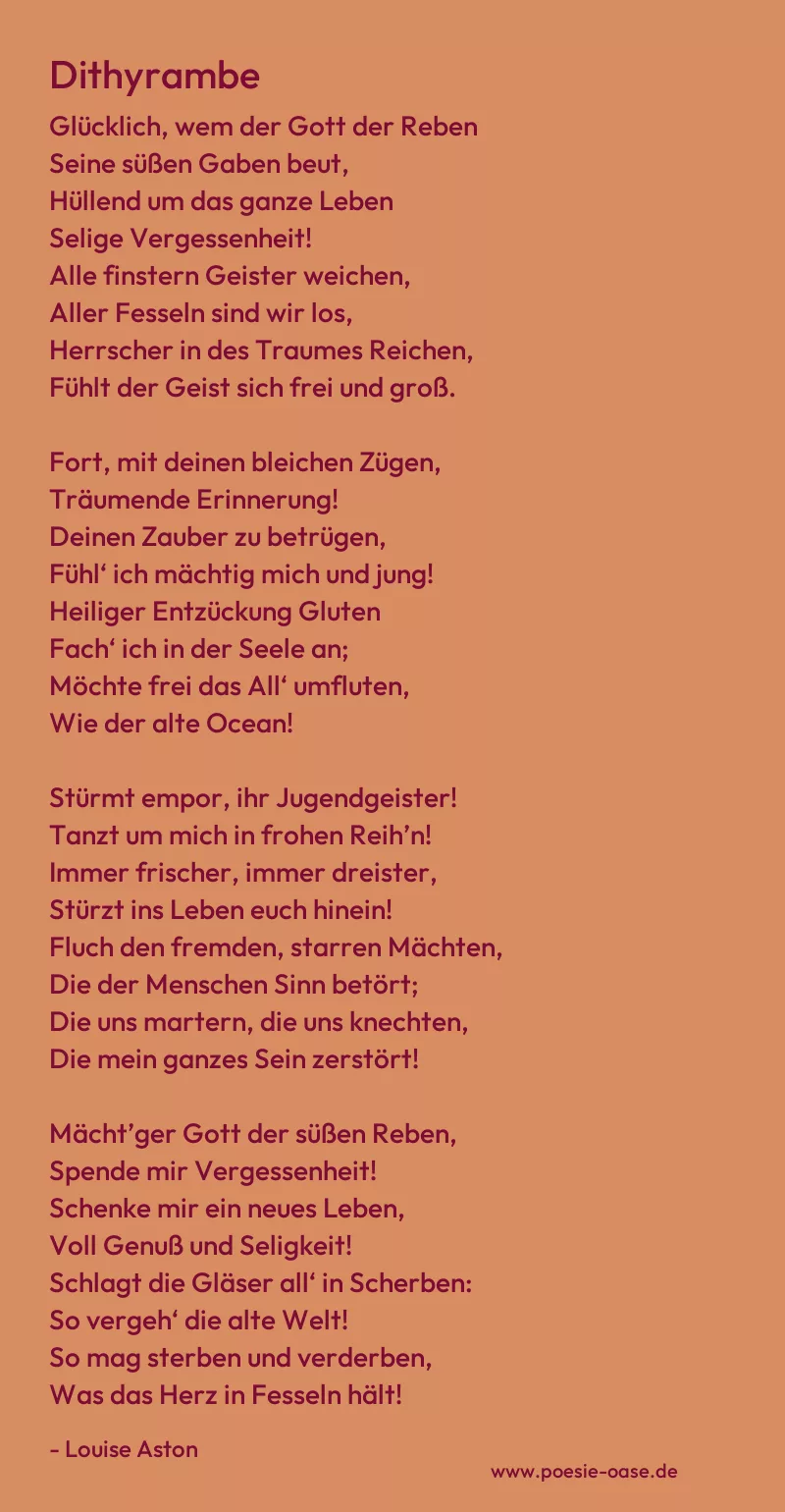Dithyrambe
Glücklich, wem der Gott der Reben
Seine süßen Gaben beut,
Hüllend um das ganze Leben
Selige Vergessenheit!
Alle finstern Geister weichen,
Aller Fesseln sind wir los,
Herrscher in des Traumes Reichen,
Fühlt der Geist sich frei und groß.
Fort, mit deinen bleichen Zügen,
Träumende Erinnerung!
Deinen Zauber zu betrügen,
Fühl‘ ich mächtig mich und jung!
Heiliger Entzückung Gluten
Fach‘ ich in der Seele an;
Möchte frei das All‘ umfluten,
Wie der alte Ocean!
Stürmt empor, ihr Jugendgeister!
Tanzt um mich in frohen Reih’n!
Immer frischer, immer dreister,
Stürzt ins Leben euch hinein!
Fluch den fremden, starren Mächten,
Die der Menschen Sinn betört;
Die uns martern, die uns knechten,
Die mein ganzes Sein zerstört!
Mächt’ger Gott der süßen Reben,
Spende mir Vergessenheit!
Schenke mir ein neues Leben,
Voll Genuß und Seligkeit!
Schlagt die Gläser all‘ in Scherben:
So vergeh‘ die alte Welt!
So mag sterben und verderben,
Was das Herz in Fesseln hält!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
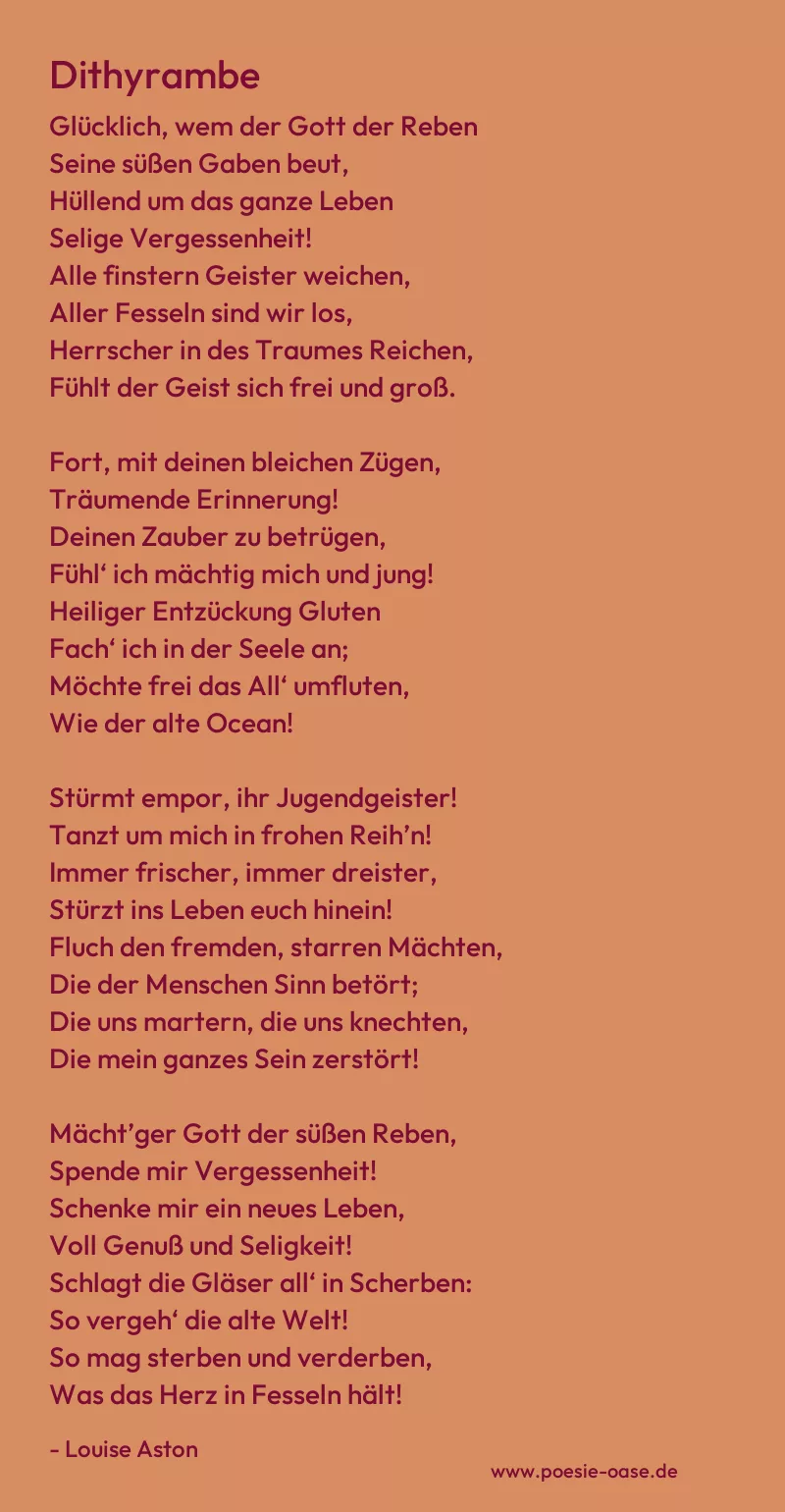
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Dithyrambe“ von Louise Aston ist ein leidenschaftliches Loblied auf die Befreiung des Geistes durch Rausch, Ekstase und jugendliche Lebenslust. Im Stil antiker Dithyramben – ekstatische Gesänge zu Ehren des Weingottes Dionysos – entfaltet sich hier ein poetisches Manifest gegen die Fesseln von Erinnerung, gesellschaftlichem Zwang und innerer Unterdrückung.
Bereits die erste Strophe ruft den „Gott der Reben“ an, der mit seinen „süßen Gaben“ das Leben in selige Vergessenheit hüllt. Der Wein steht dabei nicht nur für Genuss, sondern auch für geistige Freiheit und Entrückung. In diesem Zustand lösen sich die dunklen Kräfte des Alltags auf, und der Mensch fühlt sich „frei und groß“ – ein Zustand, den Aston als eine Art inneren Triumph feiert.
In der zweiten Strophe setzt sich das lyrische Ich entschieden von der Vergangenheit ab. Die „träumende Erinnerung“ mit ihren „bleichen Zügen“ wird als etwas Bedrückendes dargestellt, das überwunden werden muss. Stattdessen entfacht sich ein Feuer der „heiligen Entzückung“ in der Seele, das den Wunsch nach Weite und Selbstentgrenzung weckt – wie der „alte Ocean“ möchte das Ich alles umfluten, durchdringen, sich selbst auflösen im großen Ganzen.
Die dritte Strophe ruft die „Jugendgeister“ auf, sich mutig und ungebremst ins Leben zu stürzen. Dieser Aufruf zum Tanz ist mehr als eine Metapher für Ausgelassenheit – er ist ein Protest gegen „fremde, starre Mächte“, die Menschen manipulieren, unterdrücken und zerstören. Hier zeigt sich Aston als rebellische Stimme ihrer Zeit, die sich gegen moralische, politische und gesellschaftliche Zwänge wendet und für ein selbstbestimmtes Dasein kämpft.
Die Schlussstrophe ist ein radikaler Befreiungsschlag: Der Ruf nach einem neuen Leben, voll „Genuß und Seligkeit“, gipfelt im symbolischen Zerschlagen der Gläser – ein ritueller Akt, durch den die „alte Welt“ vergeht. Alles, was das Herz in Fesseln hält, soll „sterben und verderben“. Der Ton ist aufwühlend, fast revolutionär, doch getragen von einem tiefen Bedürfnis nach innerer Freiheit.
„Dithyrambe“ ist damit ein Rauschlied im doppelten Sinn – eines, das die Ekstase feiert, aber auch als Ausdruck eines politischen und existenziellen Freiheitsdrangs verstanden werden kann. Louise Aston verbindet Genuss mit Auflehnung, Vergessen mit Selbstverwirklichung – und stellt damit den Wein, den Tanz und die Jugend gegen eine starre Welt, die das Leben zu unterdrücken droht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.