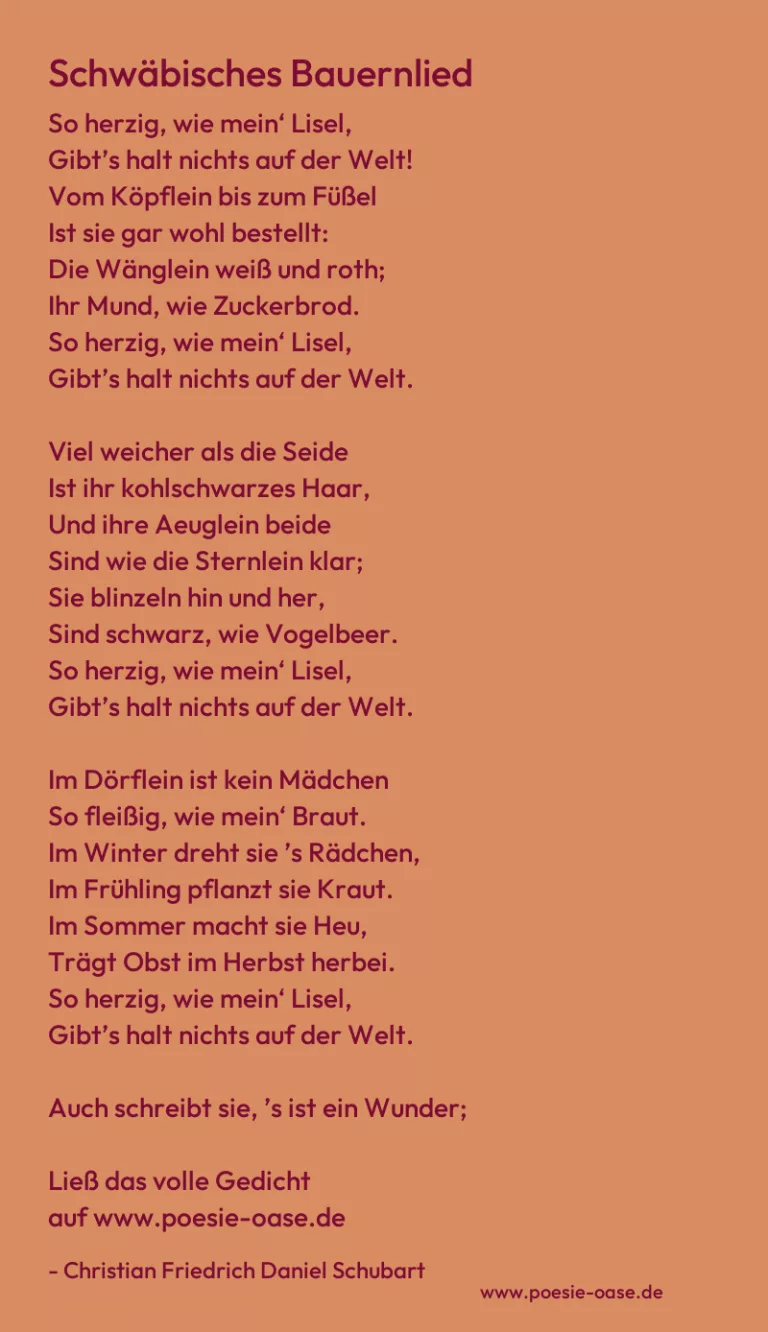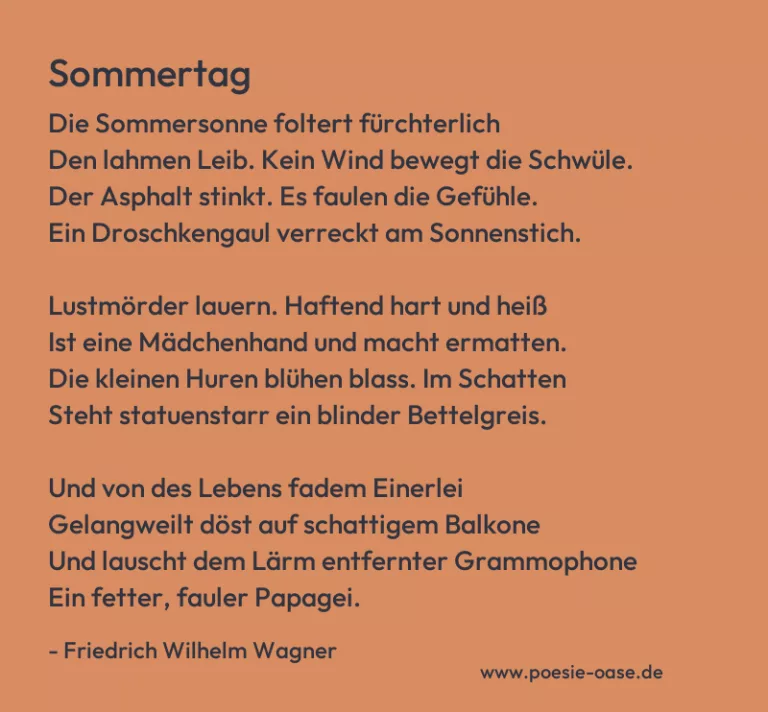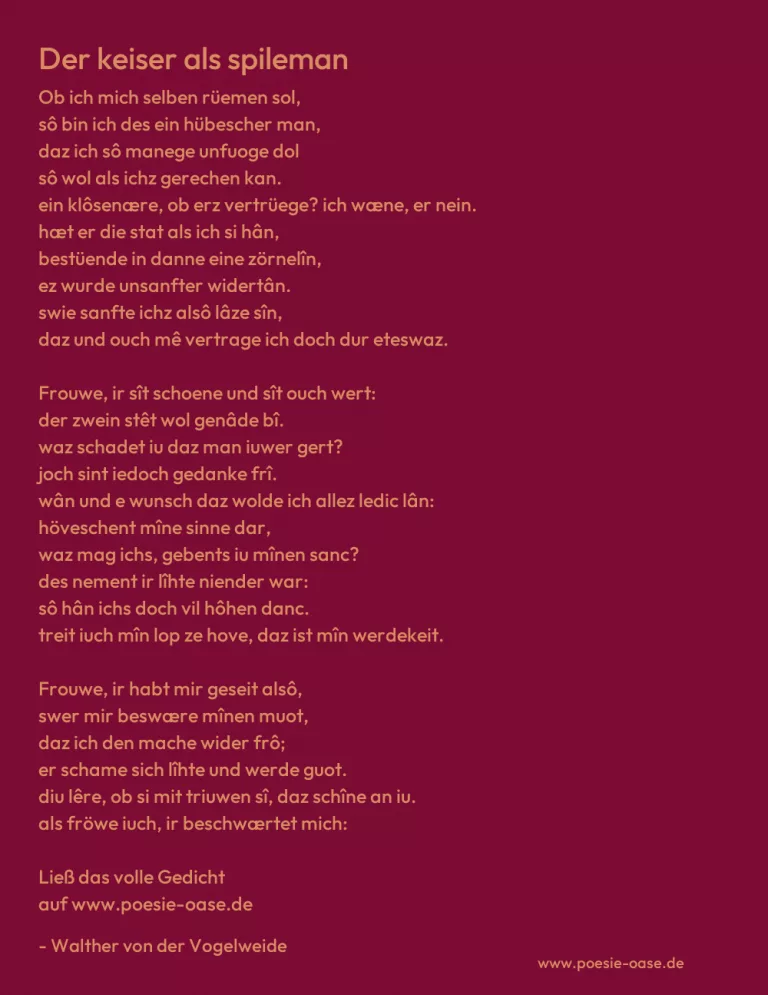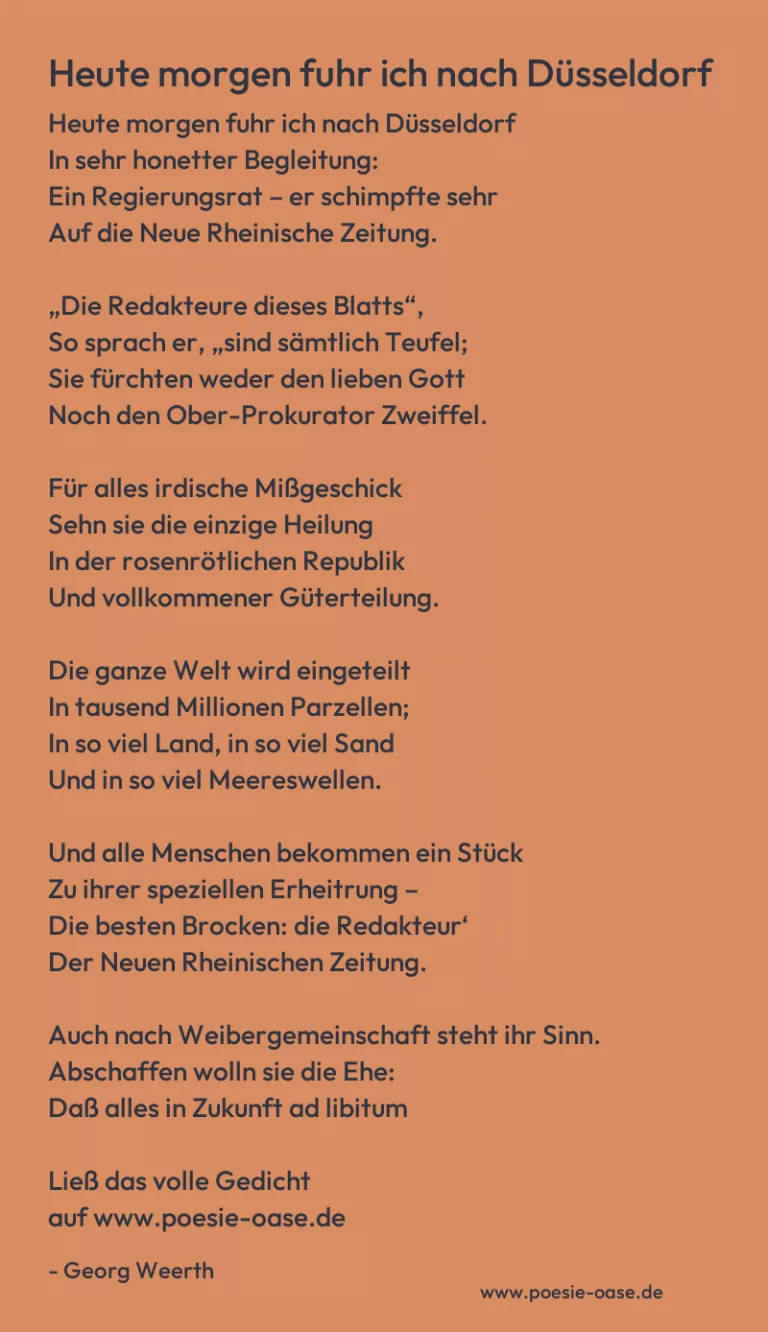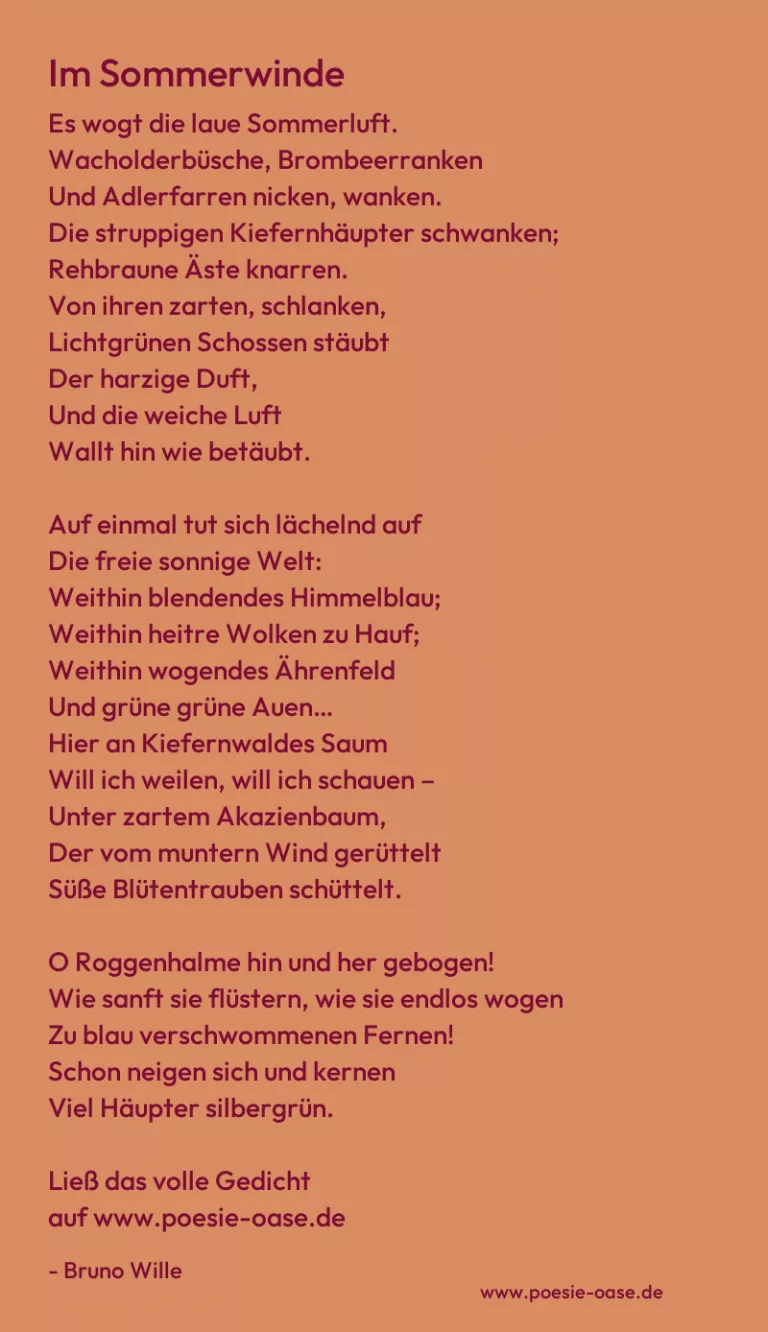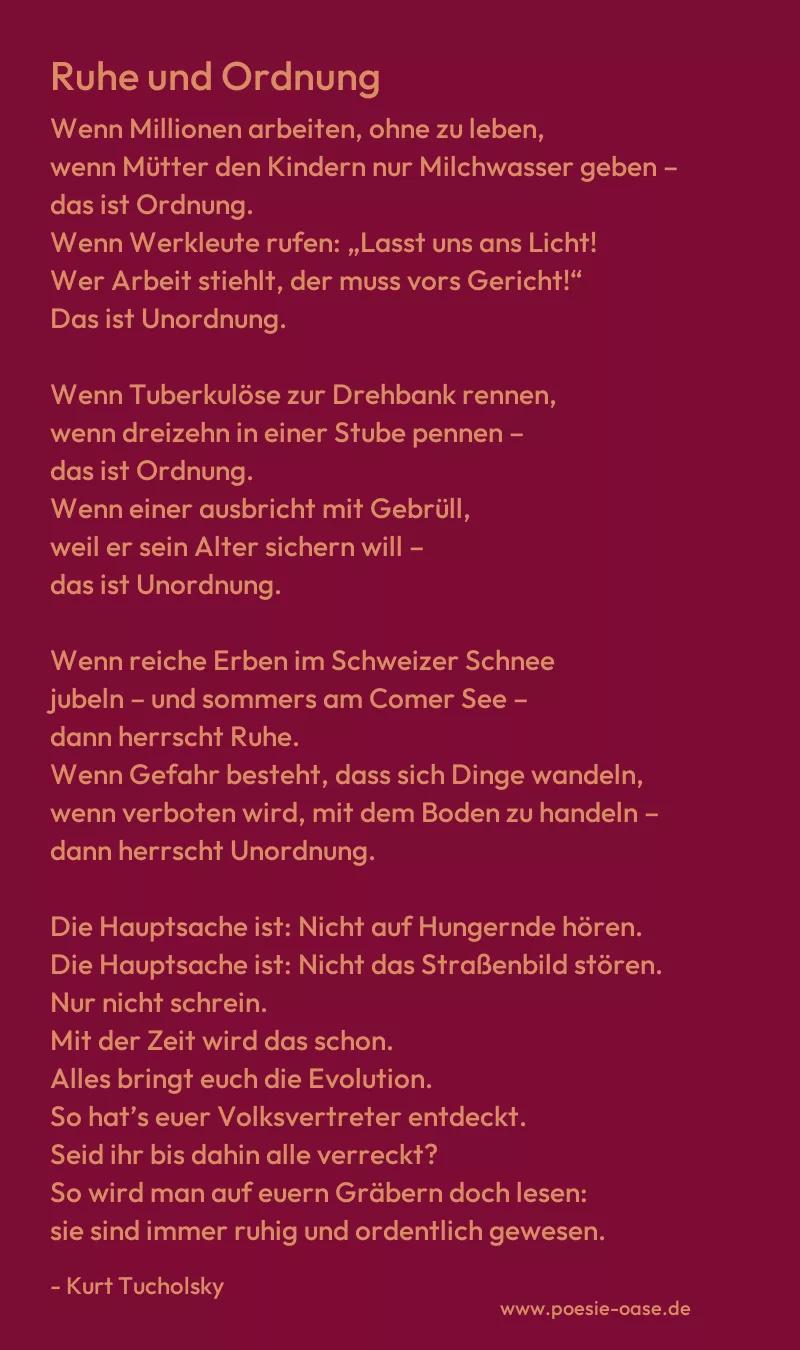Alltag, Angst, Chaos, Feiertage, Fleiß, Fortschritt, Gemeinfrei, Harmonie, Heimat & Identität, Unschuld, Winter
Ruhe und Ordnung
Wenn Millionen arbeiten, ohne zu leben,
wenn Mütter den Kindern nur Milchwasser geben –
das ist Ordnung.
Wenn Werkleute rufen: „Lasst uns ans Licht!
Wer Arbeit stiehlt, der muss vors Gericht!“
Das ist Unordnung.
Wenn Tuberkulöse zur Drehbank rennen,
wenn dreizehn in einer Stube pennen –
das ist Ordnung.
Wenn einer ausbricht mit Gebrüll,
weil er sein Alter sichern will –
das ist Unordnung.
Wenn reiche Erben im Schweizer Schnee
jubeln – und sommers am Comer See –
dann herrscht Ruhe.
Wenn Gefahr besteht, dass sich Dinge wandeln,
wenn verboten wird, mit dem Boden zu handeln –
dann herrscht Unordnung.
Die Hauptsache ist: Nicht auf Hungernde hören.
Die Hauptsache ist: Nicht das Straßenbild stören.
Nur nicht schrein.
Mit der Zeit wird das schon.
Alles bringt euch die Evolution.
So hat’s euer Volksvertreter entdeckt.
Seid ihr bis dahin alle verreckt?
So wird man auf euern Gräbern doch lesen:
sie sind immer ruhig und ordentlich gewesen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
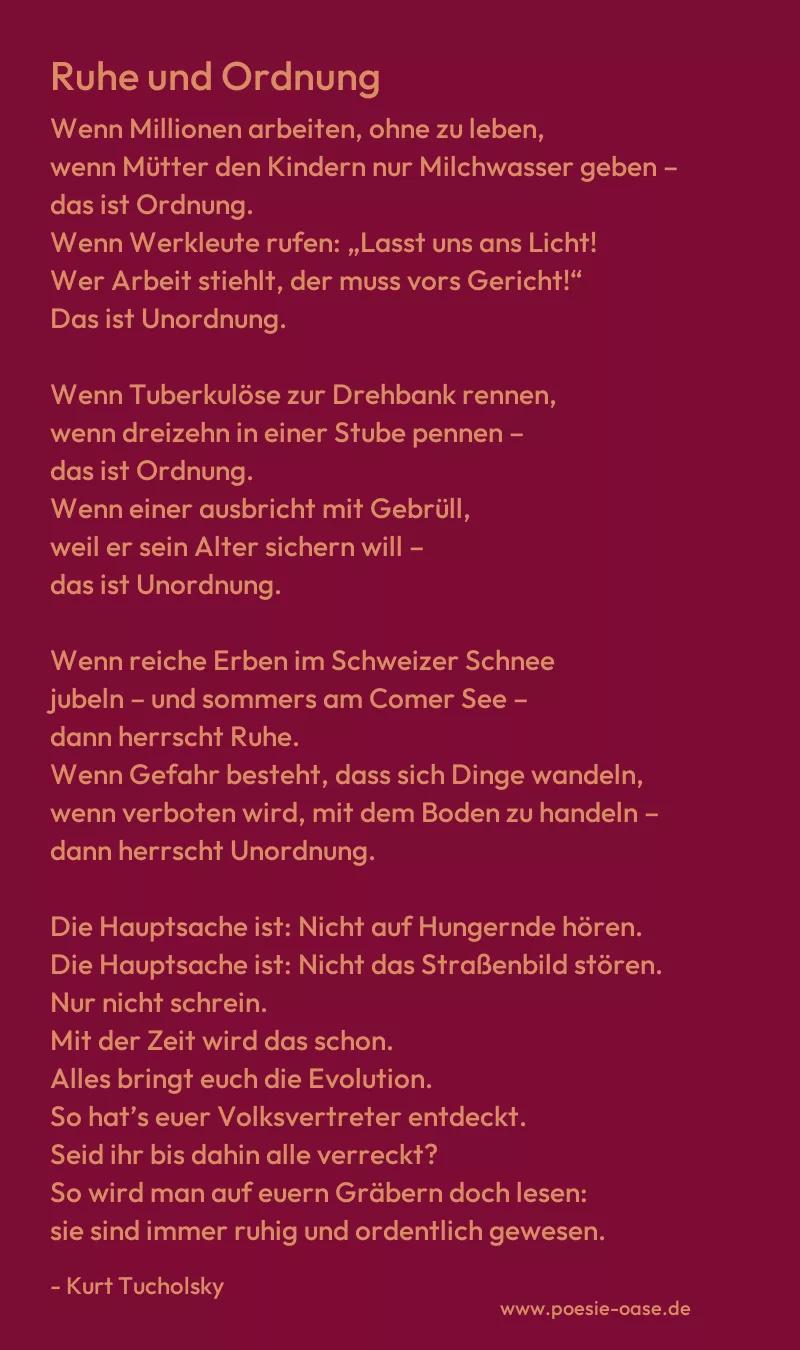
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ruhe und Ordnung“ von Kurt Tucholsky ist eine scharfsinnige und ironische Kritik an der gesellschaftlichen Ordnung, die auf Ungerechtigkeit und Ausbeutung beruht. Zu Beginn beschreibt Tucholsky eine scheinbare „Ordnung“, die in Wirklichkeit die Unterdrückung und das Elend der Arbeiter und der Armen widerspiegelt. Mütter, die ihren Kindern nur „Milchwasser“ geben, und Arbeiter, die unter ausbeuterischen Bedingungen schuften, ohne je wirklich zu leben, sind Symptome eines Systems, das den Wohlstand einer kleinen Elite über das Wohl der breiten Bevölkerung stellt. Die Aussage „das ist Ordnung“ ist hier eine zynische Bemerkung, die darauf hinweist, dass solche Zustände von den Mächtigen als normal und akzeptabel betrachtet werden.
Im Gegensatz dazu stellt Tucholsky die „Unordnung“ dar, die entsteht, wenn Arbeiter und Unterdrückte für ihre Rechte eintreten. Der Ruf der „Werkleute“ nach Licht und Gerechtigkeit sowie der Widerstand gegen Ausbeutung werden als „Unordnung“ bezeichnet, was die Ironie der gesellschaftlichen Normen unterstreicht. Das Gedicht spiegelt die soziale Realität wider, in der es als störend und unangemessen angesehen wird, sich gegen die bestehende Ordnung aufzulehnen, während das fortwährende Leiden der Armen als unveränderlich akzeptiert wird.
In den nächsten Versen wird diese Ironie weiter ausgebaut: Tucholsky beschreibt, wie Menschen unter extremen Bedingungen leben müssen – wie etwa „dreizehn in einer Stube“ oder „Tuberkulöse zur Drehbank rennen“ – und dies dennoch als „Ordnung“ angesehen wird, während das Streben nach einem besseren Leben und die Forderung nach Veränderung als Unruhe und Chaos dargestellt wird. Die gesellschaftliche Ordnung wird hier als künstlich und ungerecht dargestellt, indem sie die Notlage der Menschen als normalen Zustand akzeptiert.
Die abschließenden Zeilen des Gedichts zeigen eine noch schärfere Kritik an der politischen und sozialen Haltung gegenüber den Leidtragenden. Die „Hauptsache“ ist nicht, auf das Leiden der Hungernden zu hören oder Veränderungen zuzulassen, sondern die „Ordnung“ aufrechtzuerhalten, selbst wenn dies bedeutet, die Unterdrückung der Schwachen zu ignorieren. Der letzte Vers, der mit einer zynischen Bemerkung endet, dass die Toten „immer ruhig und ordentlich gewesen“ sind, stellt das System in einem besonders düsteren Licht dar: Die Menschen werden in ihrer Unterdrückung ignoriert und erst nach ihrem Tod als „ruhig“ und „geordnet“ verewigt – was die kalte Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber dem Leben der Armen anzeigt.
Tucholsky kritisiert in „Ruhe und Ordnung“ auf humorvolle, aber auch erschreckende Weise das bestehende soziale System, das Ungerechtigkeit als „Ordnung“ betrachtet und sich gegen Veränderungen sträubt. Das Gedicht ist ein Appell, die Augen für das Leiden der Menschen zu öffnen und sich nicht von oberflächlicher Ruhe und Ordnung täuschen zu lassen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.