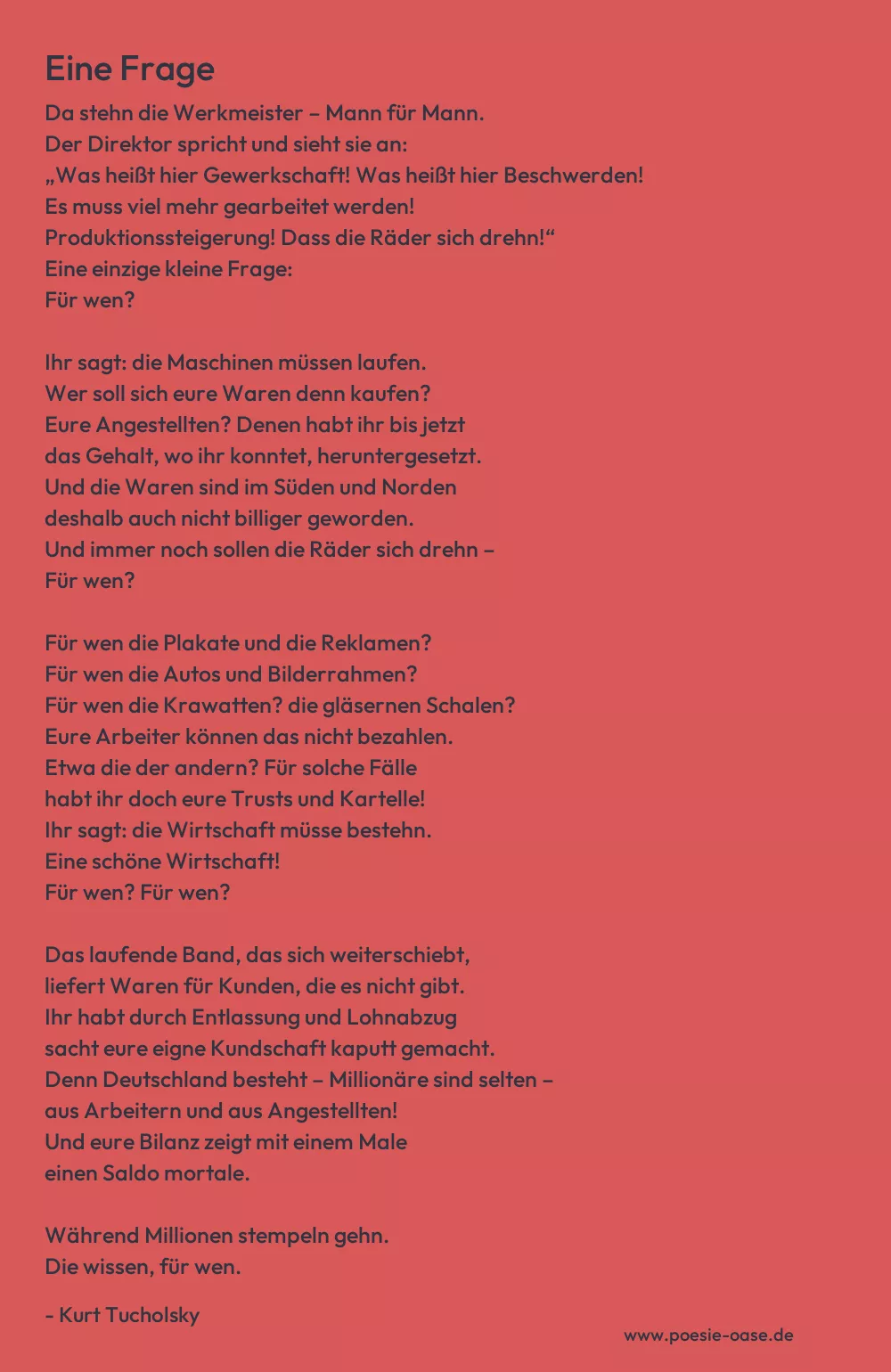Eine Frage
Da stehn die Werkmeister – Mann für Mann.
Der Direktor spricht und sieht sie an:
„Was heißt hier Gewerkschaft! Was heißt hier Beschwerden!
Es muss viel mehr gearbeitet werden!
Produktionssteigerung! Dass die Räder sich drehn!“
Eine einzige kleine Frage:
Für wen?
Ihr sagt: die Maschinen müssen laufen.
Wer soll sich eure Waren denn kaufen?
Eure Angestellten? Denen habt ihr bis jetzt
das Gehalt, wo ihr konntet, heruntergesetzt.
Und die Waren sind im Süden und Norden
deshalb auch nicht billiger geworden.
Und immer noch sollen die Räder sich drehn –
Für wen?
Für wen die Plakate und die Reklamen?
Für wen die Autos und Bilderrahmen?
Für wen die Krawatten? die gläsernen Schalen?
Eure Arbeiter können das nicht bezahlen.
Etwa die der andern? Für solche Fälle
habt ihr doch eure Trusts und Kartelle!
Ihr sagt: die Wirtschaft müsse bestehn.
Eine schöne Wirtschaft!
Für wen? Für wen?
Das laufende Band, das sich weiterschiebt,
liefert Waren für Kunden, die es nicht gibt.
Ihr habt durch Entlassung und Lohnabzug
sacht eure eigne Kundschaft kaputt gemacht.
Denn Deutschland besteht – Millionäre sind selten –
aus Arbeitern und aus Angestellten!
Und eure Bilanz zeigt mit einem Male
einen Saldo mortale.
Während Millionen stempeln gehn.
Die wissen, für wen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
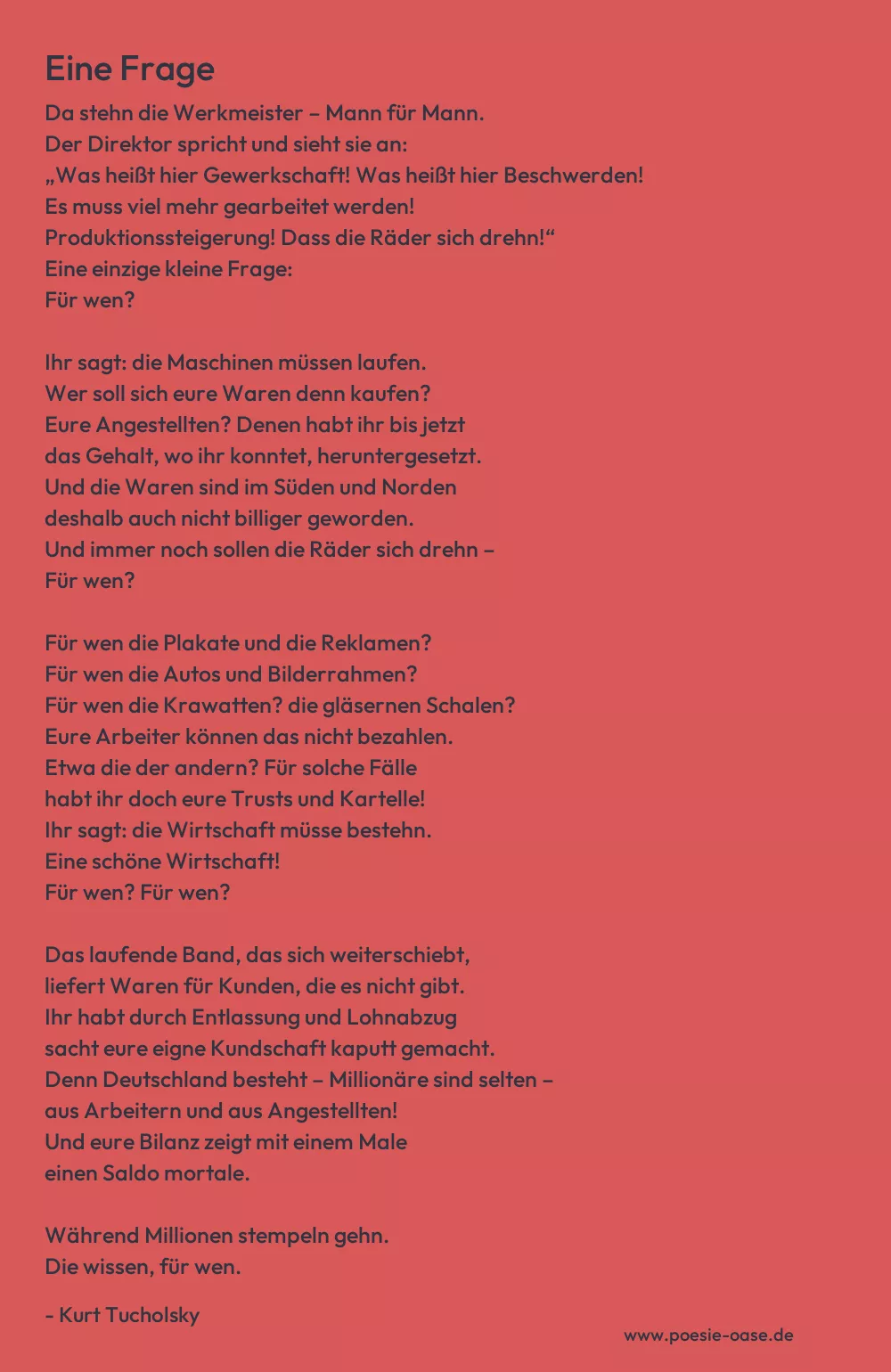
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Eine Frage“ von Kurt Tucholsky ist eine prägnante, wirtschaftskritische Anklage gegen die Widersprüche und Ungerechtigkeiten des kapitalistischen Systems der Weimarer Republik – mit hoher Aktualität auch für spätere Zeiten. In klarer, zugespitzter Sprache entlarvt Tucholsky die Absurdität eines Wirtschaftssystems, das Produktion über Menschen stellt und seine eigene Basis untergräbt. Die immer wiederkehrende Frage „Für wen?“ ist das zentrale rhetorische Element und stellt die grundlegende Sinnfrage hinter allen wirtschaftlichen Vorgängen.
Bereits in der ersten Strophe konfrontiert Tucholsky die autoritäre Sprache eines Direktors mit der Wirklichkeit der Arbeiter. Forderungen wie „Produktionssteigerung“ und „mehr arbeiten“ werden nicht mit Bedürfnissen oder Perspektiven der Beschäftigten begründet, sondern erscheinen als hohle Parolen. Die Gegenfrage „Für wen?“ entlarvt diese Forderungen als selbstbezogene Interessen der Unternehmer – es geht nicht um die Menschen, sondern um abstrakte Zahlen und Profite.
In den folgenden Strophen baut Tucholsky seine Kritik systematisch auf: Wenn Löhne gekürzt und Menschen entlassen werden, können diese selbst keine Konsumenten mehr sein. Die Kluft zwischen Produktion und Kaufkraft wird als selbstverschuldete Krise dargestellt. Die ironische Frage nach der Zielgruppe für „Plakate“, „Krawatten“ oder „gläserne Schalen“ zeigt den Irrsinn eines Systems, das Waren in Massen produziert, während es gleichzeitig die Käufer verarmt.
Besonders scharf ist die Kritik an wirtschaftlichen Zusammenschlüssen wie „Trusts und Kartellen“, die die Konkurrenz ausschalten, aber keine Lösung für die strukturelle Überproduktion bieten. Stattdessen führen sie zu einem „Saldo mortale“ – einem tödlichen Ergebnis –, das Tucholsky als die logische Konsequenz einer entfremdeten Wirtschaft beschreibt. Der Begriff verdichtet die wirtschaftliche und soziale Bankrotterklärung eines Systems, das sich selbst zerlegt.
In der letzten Strophe gibt Tucholsky eine knappe, aber eindringliche Antwort auf die wiederholte Frage: Die Millionen Arbeitslosen, die „stempeln gehn“, wissen genau, für wen diese Wirtschaft nicht ist – nämlich nicht für sie. Damit endet das Gedicht mit einer düsteren, aber klaren Botschaft: Ein Wirtschaftssystem, das sich von den Bedürfnissen der Mehrheit entfernt, wird zum Selbstzweck – und zum sozialen Desaster.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.