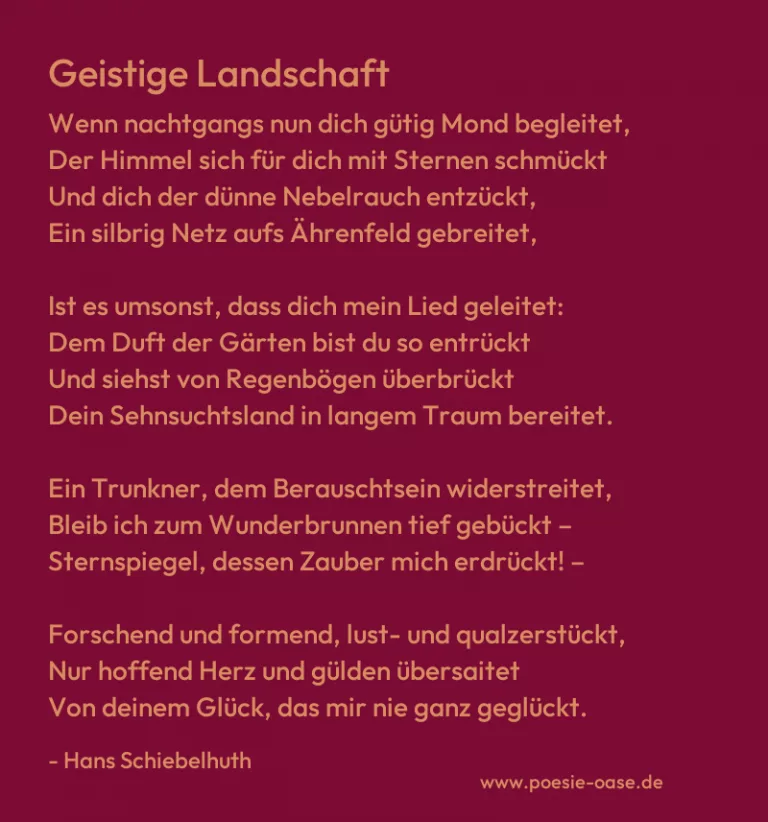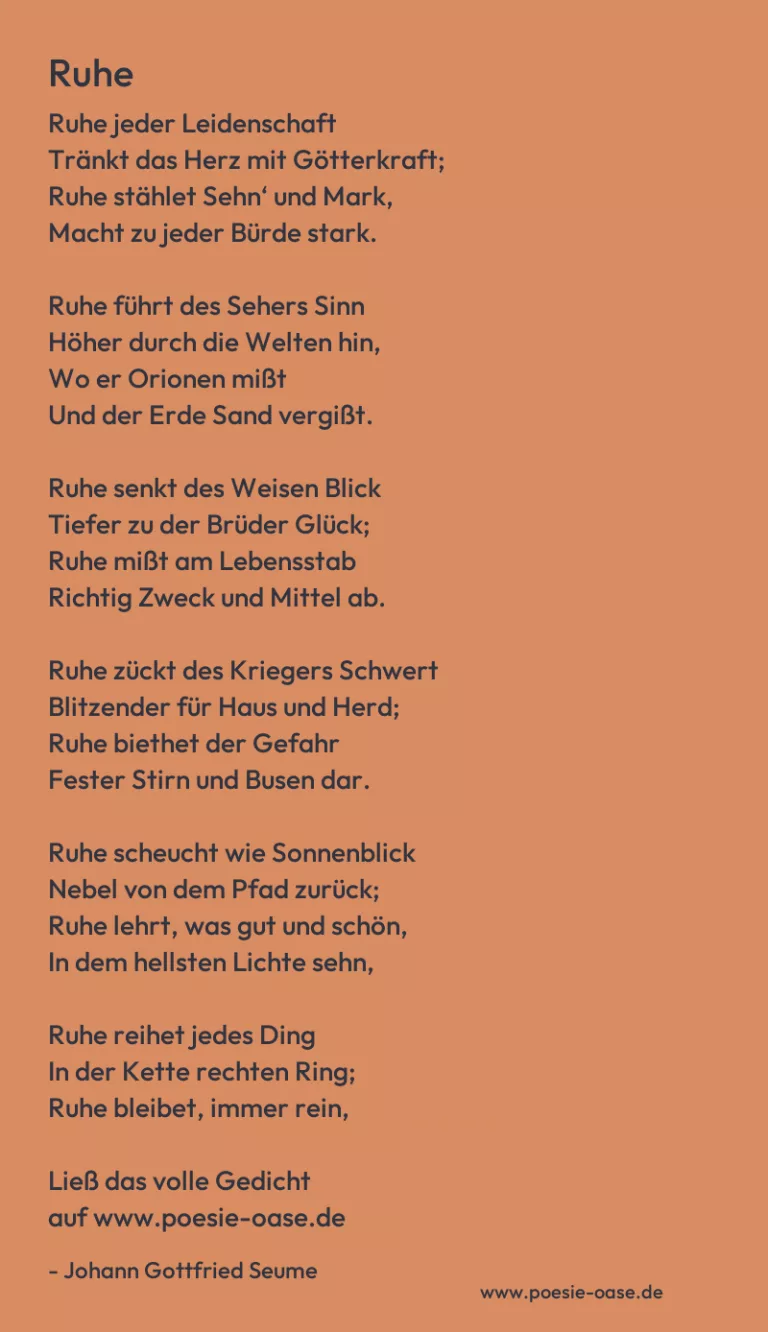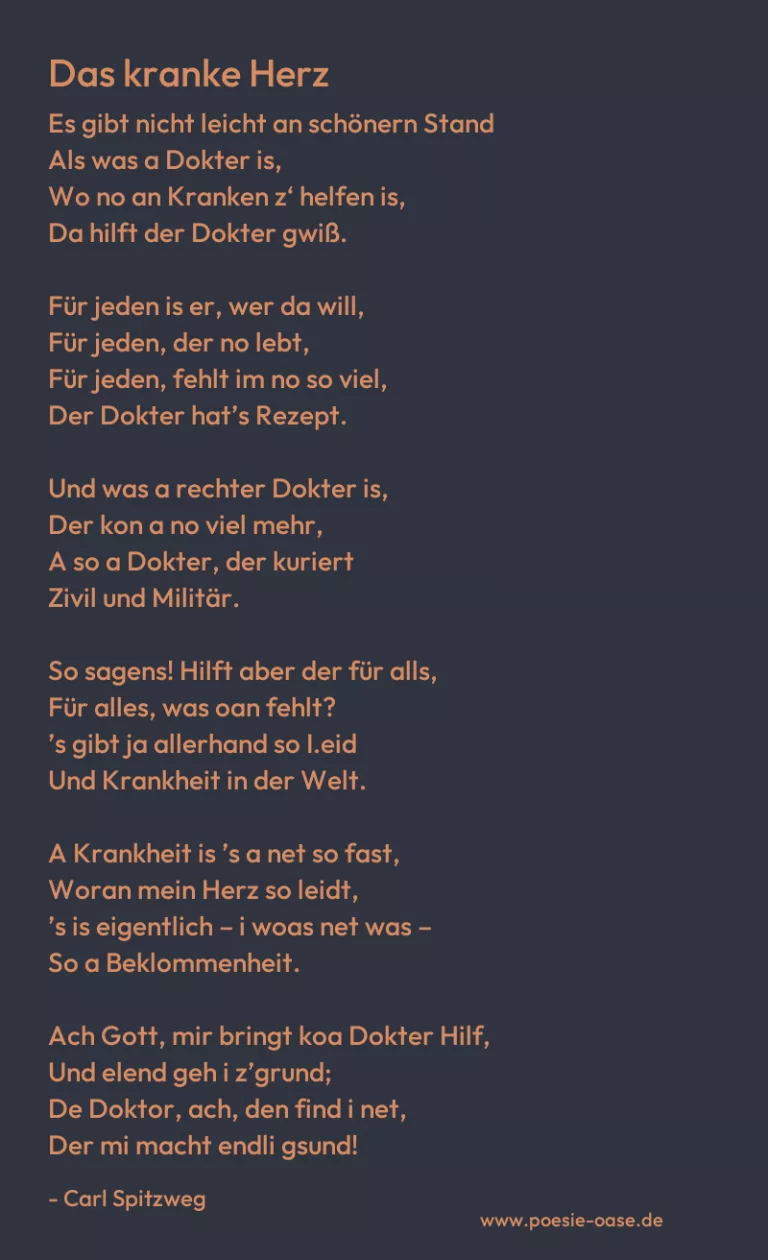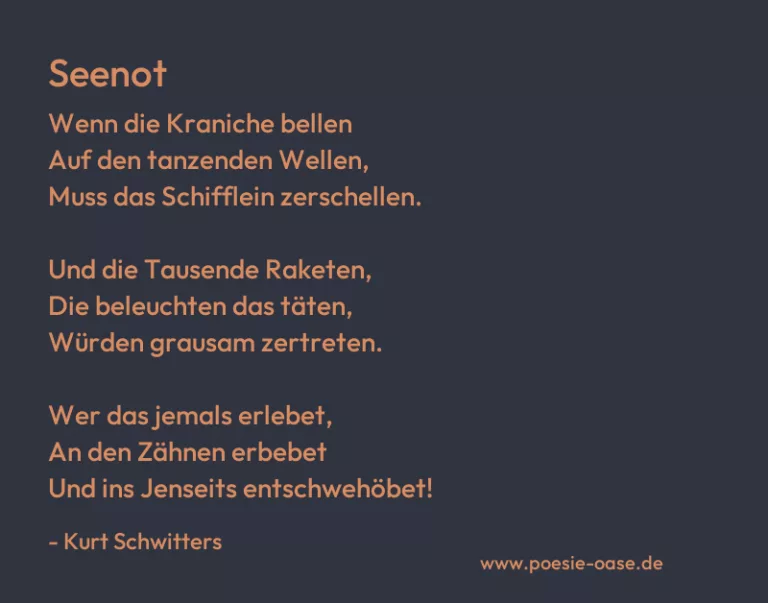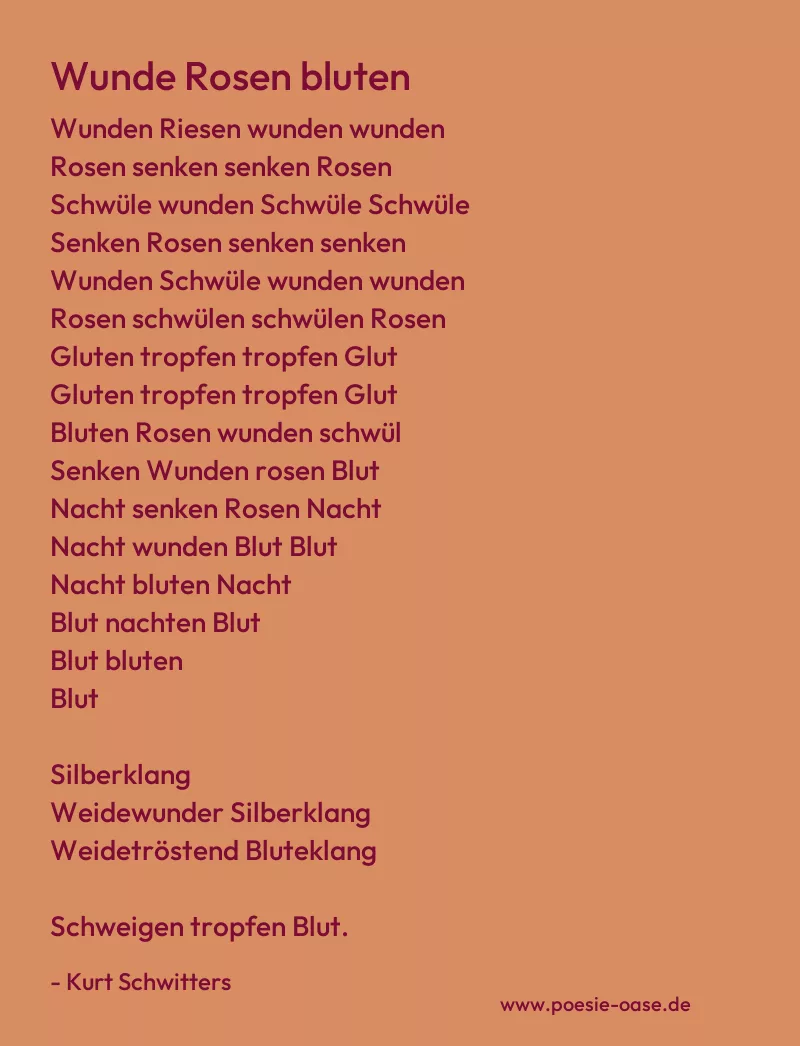Wunde Rosen bluten
Wunden Riesen wunden wunden
Rosen senken senken Rosen
Schwüle wunden Schwüle Schwüle
Senken Rosen senken senken
Wunden Schwüle wunden wunden
Rosen schwülen schwülen Rosen
Gluten tropfen tropfen Glut
Gluten tropfen tropfen Glut
Bluten Rosen wunden schwül
Senken Wunden rosen Blut
Nacht senken Rosen Nacht
Nacht wunden Blut Blut
Nacht bluten Nacht
Blut nachten Blut
Blut bluten
Blut
Silberklang
Weidewunder Silberklang
Weidetröstend Bluteklang
Schweigen tropfen Blut.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
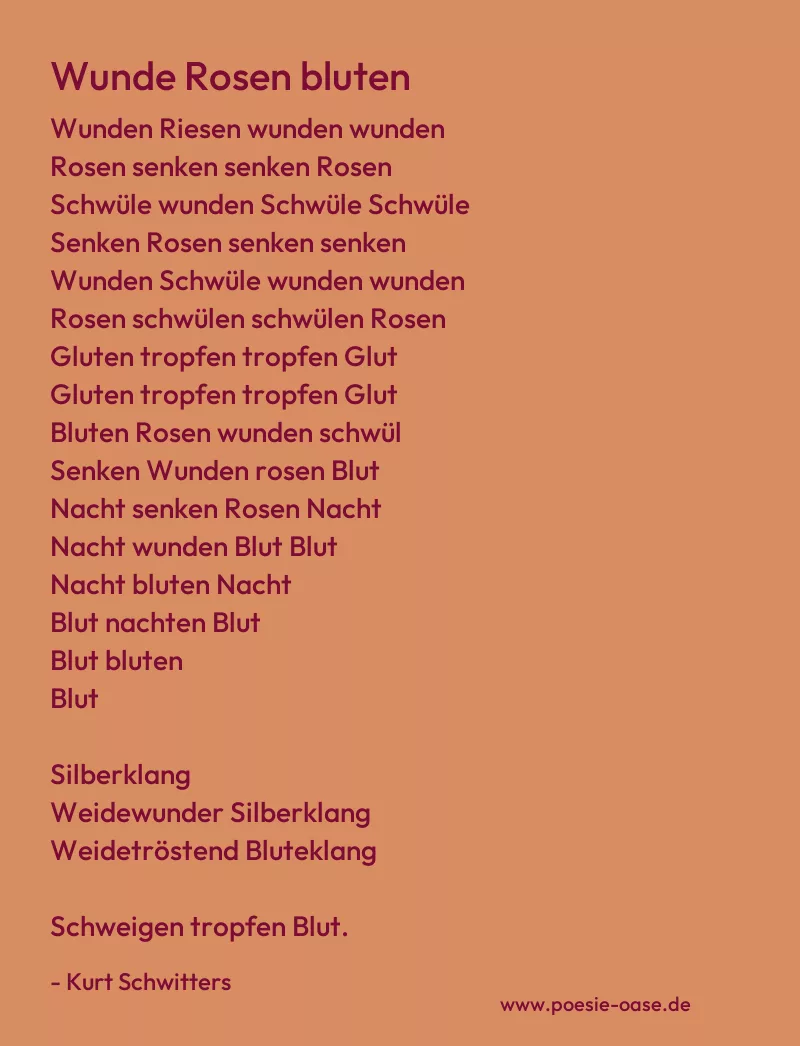
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wunde Rosen bluten“ von Kurt Schwitters ist ein experimentelles, dadaistisches Werk, das die Grenzen traditioneller Poesie aufhebt und mit der Sprache und den Bildern auf eine fragmentierte und emotionale Weise spielt. Die wiederholte Verwendung von Wörtern wie „Wunden“, „Rosen“, „Blut“ und „Schwüle“ erzeugt eine starke, fast bedrohliche Atmosphäre, die durch die ständige Wiederholung und den Rhythmus verstärkt wird.
Die ersten Zeilen, in denen „wunden“ und „Rosen“ immer wieder aufeinandertreffen, schaffen eine Assoziation von Schmerz und Schönheit. Rosen, als symbolische Bilder für Liebe und Schönheit, sind hier mit Wunden verbunden, was das paradoxe Bild einer verletzten oder zerstörten Schönheit erzeugt. Der ständige Wechsel zwischen den Begriffen „senken“, „bluten“, „schwülen“ und „Gluten“ verstärkt das Gefühl von Zerfall und leidenschaftlichem Schmerz. Diese Bilder scheinen sich in einem Zyklus von Schmerz und Schönheit zu wiederholen, was die Vergänglichkeit und die ambivalente Natur von Leid und Schönheit thematisiert.
Die wiederholte Vorstellung von „Blut“ und „Nacht“ baut eine düstere und düster melancholische Stimmung auf. Die Worte „Nacht senken Rosen Nacht“ und „Nacht bluten Nacht“ verweisen auf die Dunkelheit, sowohl im physischen als auch im metaphorischen Sinne, und lassen die Vorstellung aufkommen, dass der Schmerz und das Leiden sich mit der Nacht und dem Unbekannten verbinden. Das Bluten der Rosen ist hier nicht nur ein physischer Prozess, sondern wird auch zu einem Symbol für das innere Leiden und das Unaussprechliche.
Die abrupten Übergänge zu „Silberklang“ und „Weidewunder“ bieten einen Kontrast, der die abstrakte, fast transzendente Dimension des Gedichts hervorhebt. „Weidetröstend Bluteklang“ scheint eine mystische und doch verstörende Mischung aus Trost und Schmerz zu suggerieren. Der Klang von „Blut“ wird hier nicht nur als physisches Phänomen, sondern auch als ein musikalisches, fast unheimliches Element dargestellt. Diese Verschränkung von Klang, Bild und Gefühl verweist auf die dadaistische Praxis, die verschiedenen Elemente der Kunst miteinander zu vermischen und die traditionelle Bedeutung aufzulösen.
Das Gedicht endet mit den Worten „Schweigen tropfen Blut“, was eine finale, fast beklemmende Stille suggeriert. Das Schweigen als Gegensatz zum vorherigen lauten, wiederholten Bluten und Tropfen des Blutes lässt eine leere, erschöpfte Welt zurück. Hier wird das Schweigen als ein dunkler, abschließender Moment dargestellt, der die intensive, leidvolle Bewegung des Gedichts zum Erliegen bringt. Schwitters nutzt die Sprache hier nicht nur als Mittel der Kommunikation, sondern als eine Art des experimentellen Ausdrucks, der den Leser in eine Welt der Emotionen, des Leidens und der Transformation eintauchen lässt.
Insgesamt ist „Wunde Rosen bluten“ ein Gedicht, das mit der Form, der Sprache und den Bildern spielt und dabei eine Atmosphäre des Schmerzes, der Vergänglichkeit und der Dunkelheit erschafft. Schwitters verbindet intensive, körperliche Bilder mit einer fast mystischen, poetischen Dimension, die das Gedicht zu einer dadaistischen Auseinandersetzung mit den Themen Schönheit, Leid und Zerfall macht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.