Wenn die Kraniche bellen
Auf den tanzenden Wellen,
Muss das Schifflein zerschellen.
Und die Tausende Raketen,
Die beleuchten das täten,
Würden grausam zertreten.
Wer das jemals erlebet,
An den Zähnen erbebet
Und ins Jenseits entschwehöbet!
Wenn die Kraniche bellen
Auf den tanzenden Wellen,
Muss das Schifflein zerschellen.
Und die Tausende Raketen,
Die beleuchten das täten,
Würden grausam zertreten.
Wer das jemals erlebet,
An den Zähnen erbebet
Und ins Jenseits entschwehöbet!
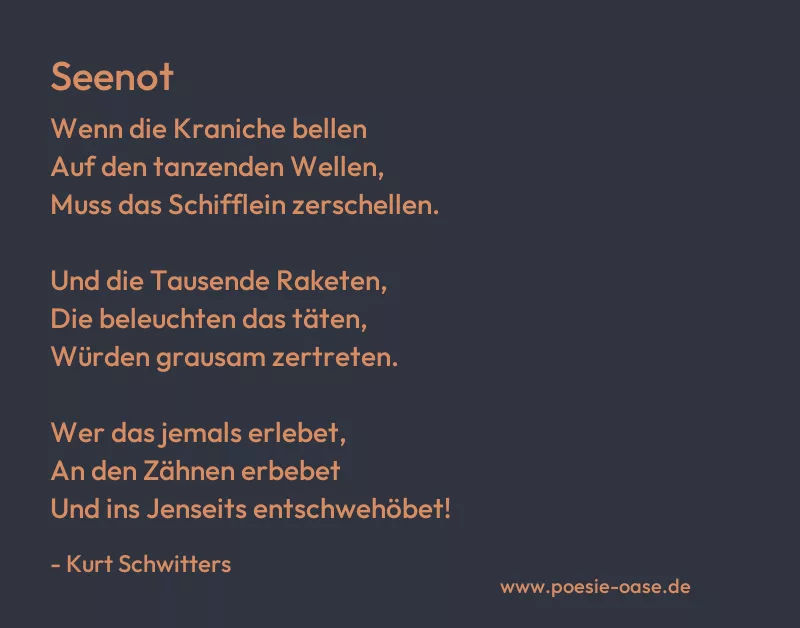
Das Gedicht „Seenot“ von Kurt Schwitters greift in knapper, fast kindlich gereimter Form ein düsteres, existenzielles Thema auf: den drohenden Untergang auf See und die damit verbundene Todeserfahrung. Trotz der scheinbar harmlosen Dreizeiler wirkt das Gedicht bedrohlich und surreal – eine Kombination, die typisch für Schwitters’ poetischen Stil ist.
Bereits die erste Strophe stellt eine irritierende Bildwelt vor: Kraniche „bellen“ – eine absurde, dadaistische Verkehrung natürlicher Ordnung. Dieser Laut, der eigentlich nicht zu den eleganten Zugvögeln passt, kündigt Unheil an. In Verbindung mit „tanzenden Wellen“ entsteht eine Szene von instabiler, unheimlicher Bewegung, an deren Ende das „Schifflein zerschellen“ muss. Das Diminutiv „Schifflein“ verstärkt die Hilflosigkeit gegenüber den Naturgewalten.
In der zweiten Strophe wird die Gefahr potenziert: Selbst die Raketen, die vielleicht als Signale der Hoffnung oder Rettung gedacht sind, würden „grausam zertreten“. Auch hier arbeitet Schwitters mit einem Bruch der Logik – Licht wird nicht nur nutzlos, sondern zerstörerisch. Die Formulierungen erinnern fast an Albtraumbilder: Die Welt ist verkehrt, Hilfe wird zur Gefahr.
Die letzte Strophe steigert die Bedrohung zur existenziellen Katastrophe. Wer diese Szene erlebt habe, zittere noch an den „Zähnen“ – ein ungewöhnlicher Ausdruck für Furcht und körperliche Erschütterung. Die Wortneuschöpfung „entschwehöbet“ parodiert die religiöse Vorstellung vom Erheben der Seele ins Jenseits, wird aber durch ihren kindlich-poetischen Klang gleichzeitig ins Absurde gezogen.
„Seenot“ spielt somit mit der Grenze zwischen Ernst und Parodie. Schwitters verbindet dadaistische Elemente – wie sinnentleerte Lautspiele, absurde Bilder und ironische Neologismen – mit einem tiefen Gefühl der Bedrohung. Das Gedicht wirkt wie eine karikaturhafte Vision des Weltuntergangs: komisch und erschreckend zugleich, wie ein Tanz auf dem schwankenden Deck vor dem unausweichlichen Untergang.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.