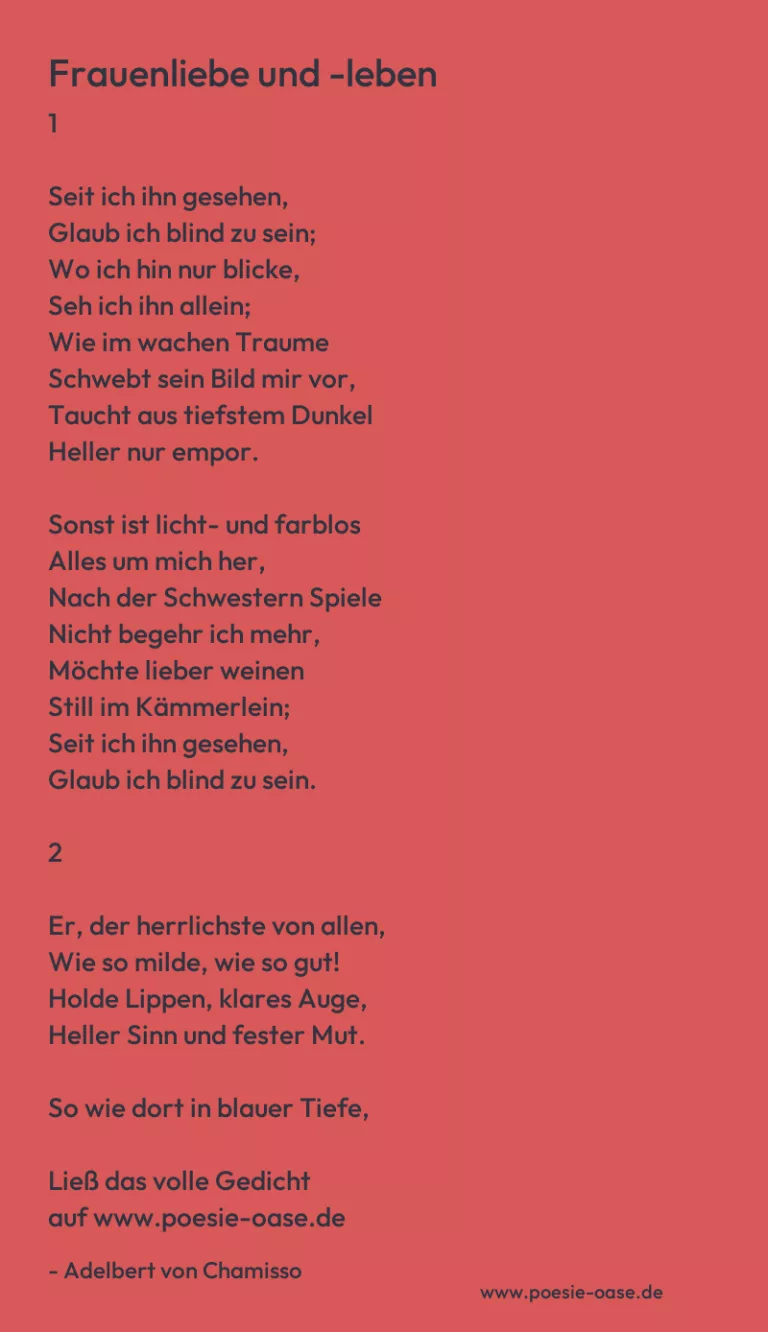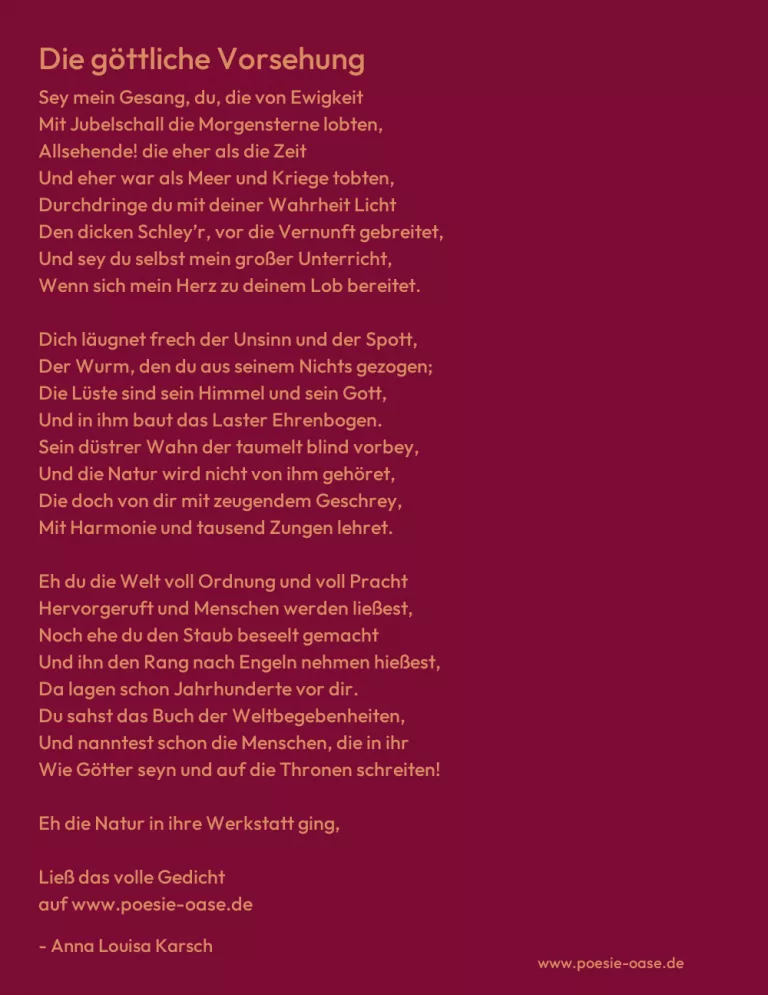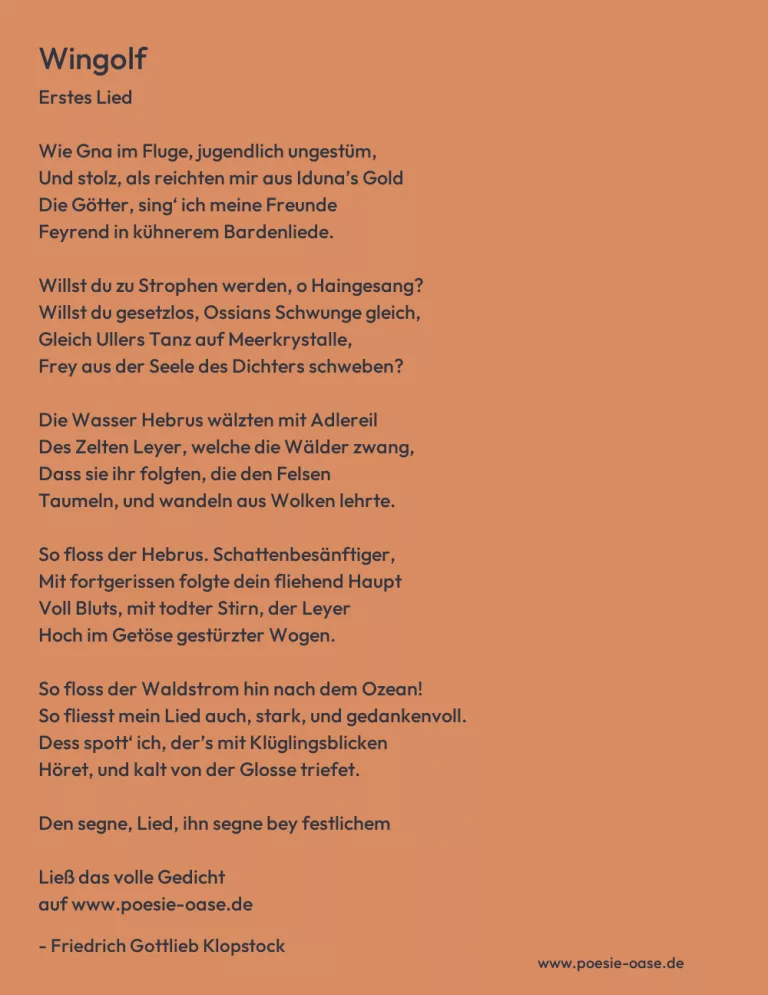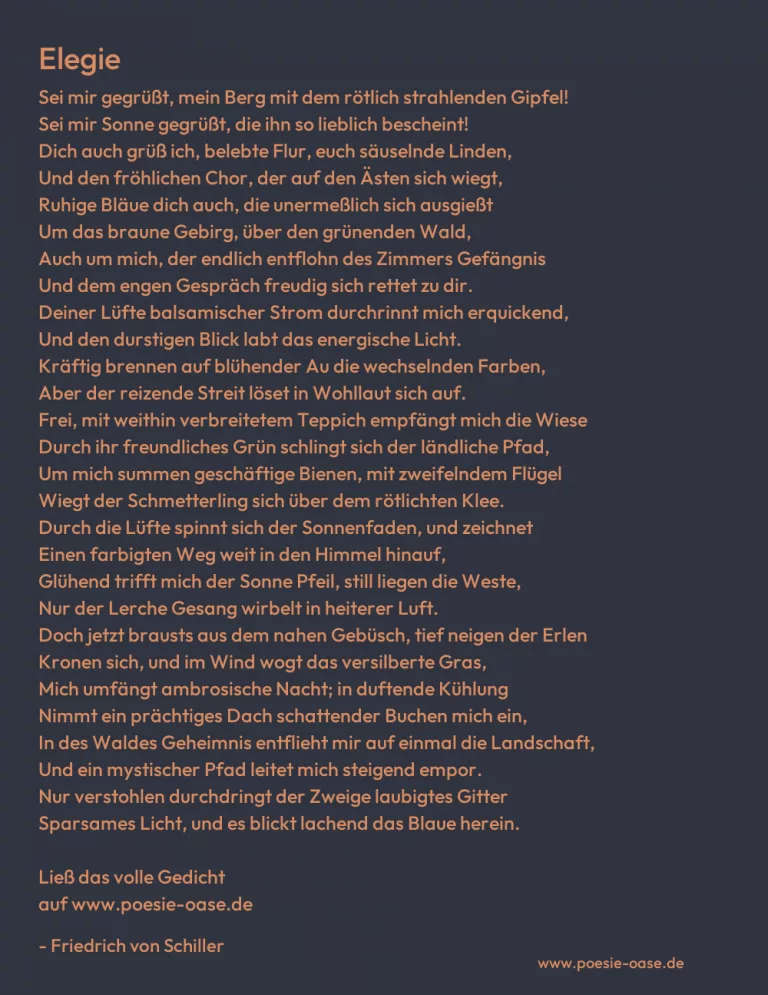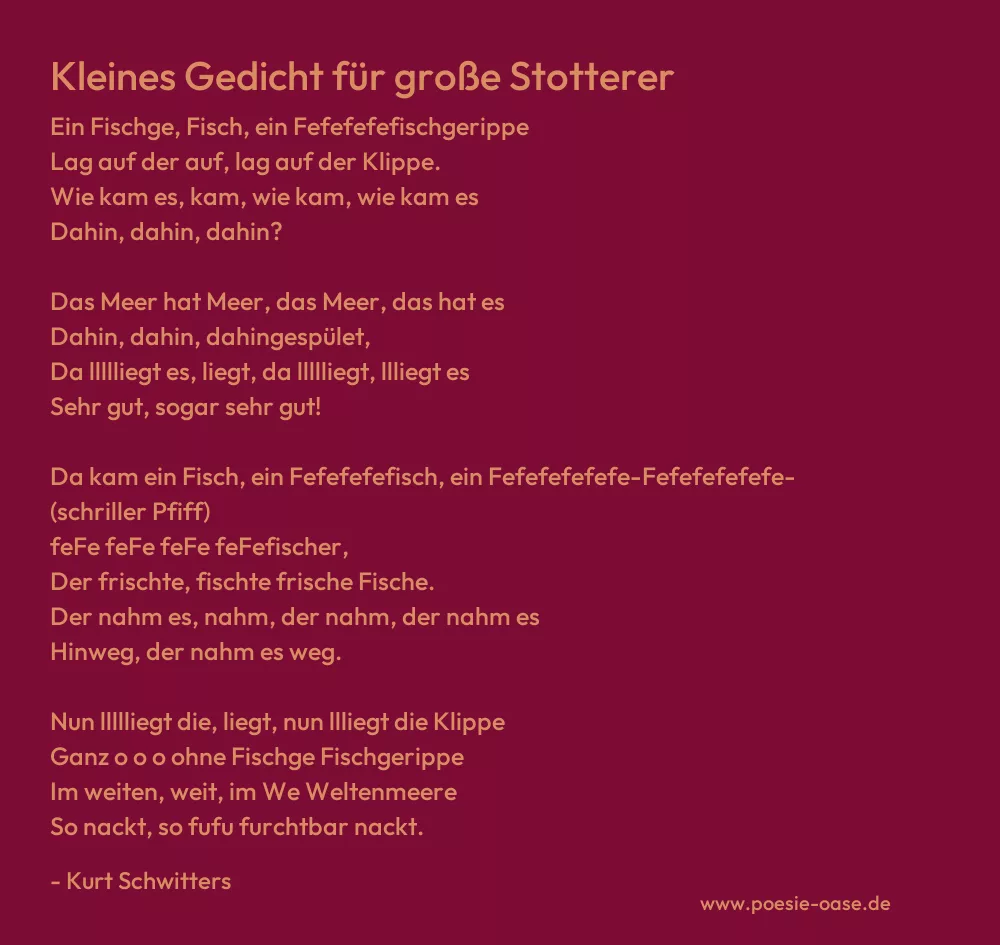Kleines Gedicht für große Stotterer
Ein Fischge, Fisch, ein Fefefefefischgerippe
Lag auf der auf, lag auf der Klippe.
Wie kam es, kam, wie kam, wie kam es
Dahin, dahin, dahin?
Das Meer hat Meer, das Meer, das hat es
Dahin, dahin, dahingespület,
Da llllliegt es, liegt, da llllliegt, llliegt es
Sehr gut, sogar sehr gut!
Da kam ein Fisch, ein Fefefefefisch, ein Fefefefefefe-Fefefefefefe-
(schriller Pfiff)
feFe feFe feFe feFefischer,
Der frischte, fischte frische Fische.
Der nahm es, nahm, der nahm, der nahm es
Hinweg, der nahm es weg.
Nun llllliegt die, liegt, nun llliegt die Klippe
Ganz o o o ohne Fischge Fischgerippe
Im weiten, weit, im We Weltenmeere
So nackt, so fufu furchtbar nackt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
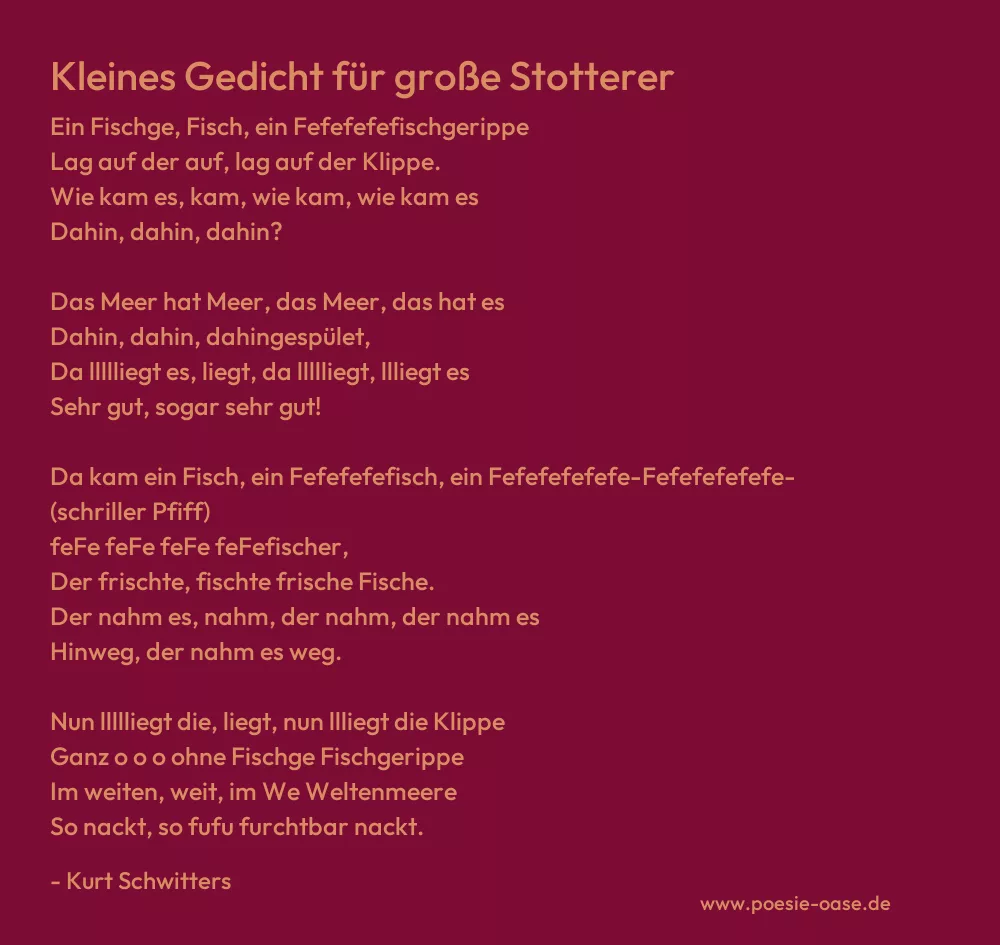
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Kleines Gedicht für große Stotterer“ von Kurt Schwitters ist ein humorvolles und zugleich experimentelles Werk, das sich mit dem Stottern als Sprachphänomen auseinandersetzt. Schwitters nutzt die Wiederholung und das Stottern als stilistisches Mittel, um die Zerrissenheit und den inneren Konflikt auszudrücken, die mit der Sprachstörung einhergehen. Die wiederholten Silben und das „Fefefefefischgerippe“ erzeugen eine Art Klangchaos, das den Unwillen oder die Schwierigkeiten, sich auszudrücken, widerspiegelt.
Die erste Strophe zeigt, wie das Wort „Fischge“ und die wiederholte Silbe „Fefefefefisch“ eine Sprache der Unsicherheit und des Widerstandes hervorrufen. Das Gedicht spielt mit dem Klang der Wörter, ohne dass eine klare Bedeutung vermittelt wird. Der Fisch, der „auf der Klippe“ liegt, wird hier zu einem Symbol für das Sprachchaos – eine absurde, fast surreale Darstellung der Unfähigkeit, die Dinge flüssig und ohne Stottern zu benennen.
In der Mitte des Gedichts setzt Schwitters das Bild des Fischers ein, der „frischte, fischte frische Fische“. Hier wird der Vorgang des Fischens als eine Art verzweifelter Versuch beschrieben, sich durch die Sprachblockaden hindurch zu „fischen“. Das Bild des „FeFe feFe feFe feFefischers“ verstärkt das Spiel mit der Sprache und die wiederholte, nahezu „verzweifelte“ Anstrengung, sich selbst und die Welt auszudrücken. Der „schrille Pfiff“ könnte als Hinweis auf die Unruhe und die nervliche Anspannung verstanden werden, die mit der Sprachstörung verbunden sind.
Die abschließende Strophe bringt das Bild der leeren Klippe, die nun „ganz ohne Fischge Fischgerippe“ da liegt, was die Abwesenheit von Bedeutung und Ausdruck symbolisiert. Die Wiederholung des „nackt“ und das „fufu furchtbar nackt“ vermitteln das Gefühl der Leere und des Verlustes, das mit der Sprachbarriere einhergeht – eine Leere, die sowohl die Worte als auch den Menschen betrifft. Das Gedicht endet mit einem bitteren Humor, der die Absurdität und Tragik der sprachlichen Einschränkungen aufzeigt.
Insgesamt ist das Gedicht eine kreative Auseinandersetzung mit dem Thema Stottern und der Schwierigkeit, sich auszudrücken. Schwitters nutzt Sprache nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern als Kunstform, die das Unvermögen, sich flüssig auszudrücken, reflektiert und zum Kunstwerk selbst macht. Die ständige Wiederholung und das Spiel mit Lauten verdeutlichen das emotionale Durcheinander und die innere Zerrissenheit, die mit dem Stottern verbunden sind.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.