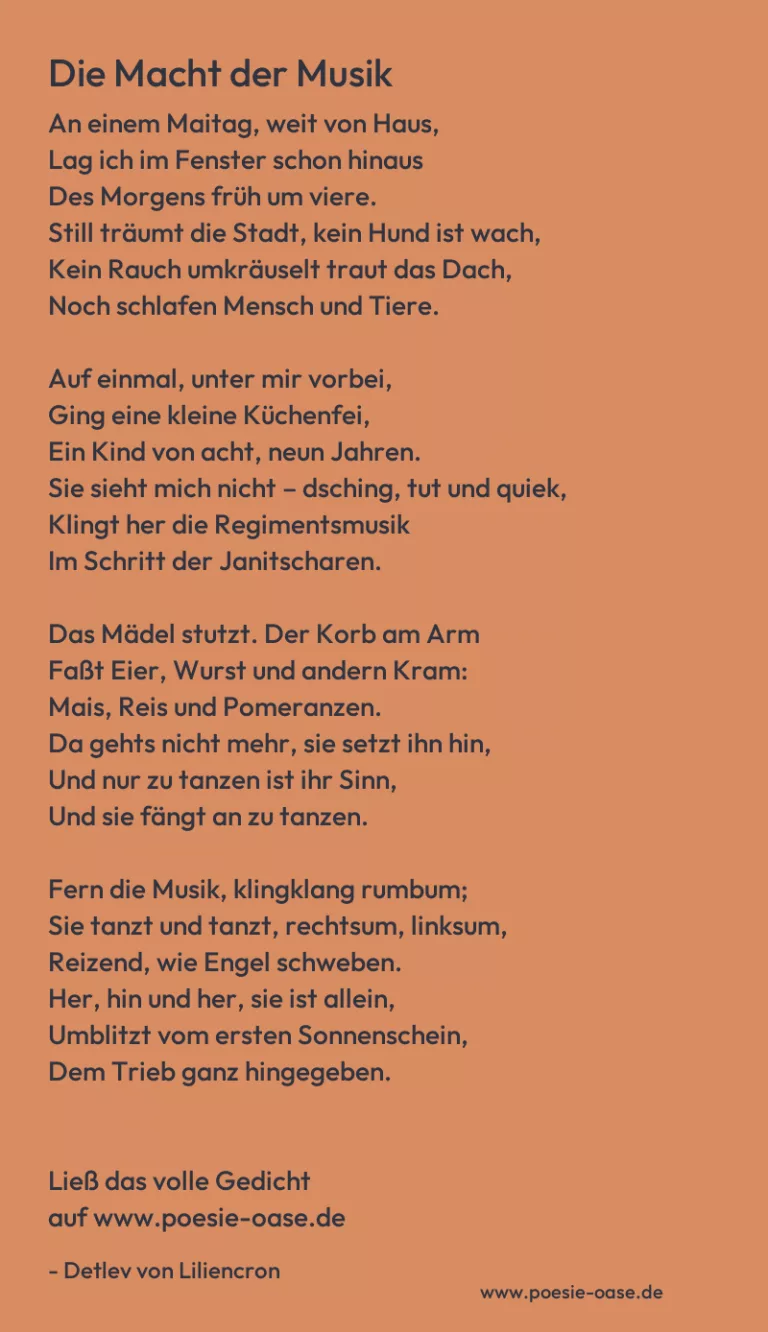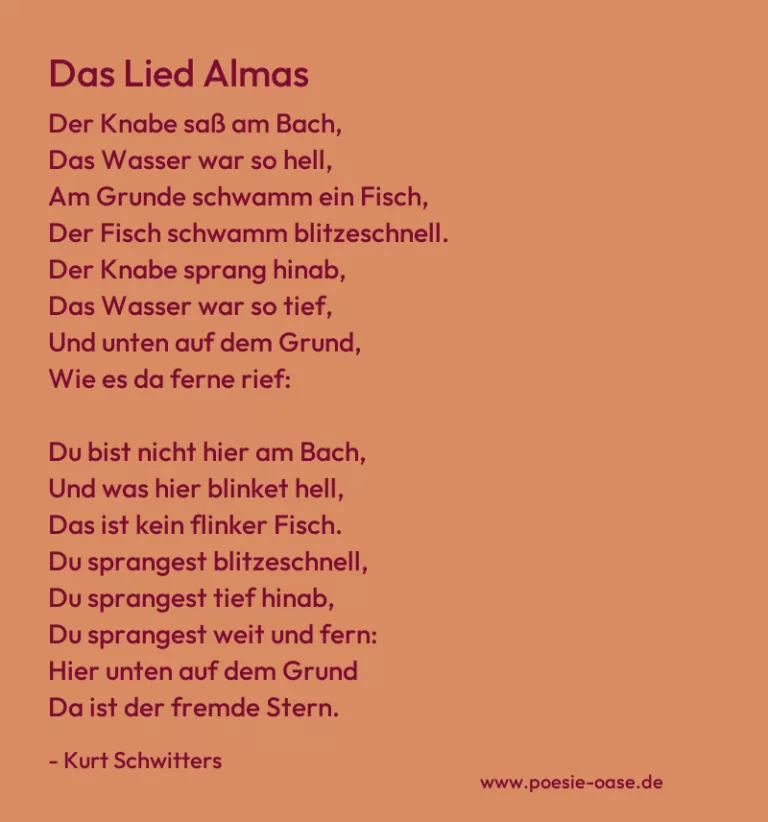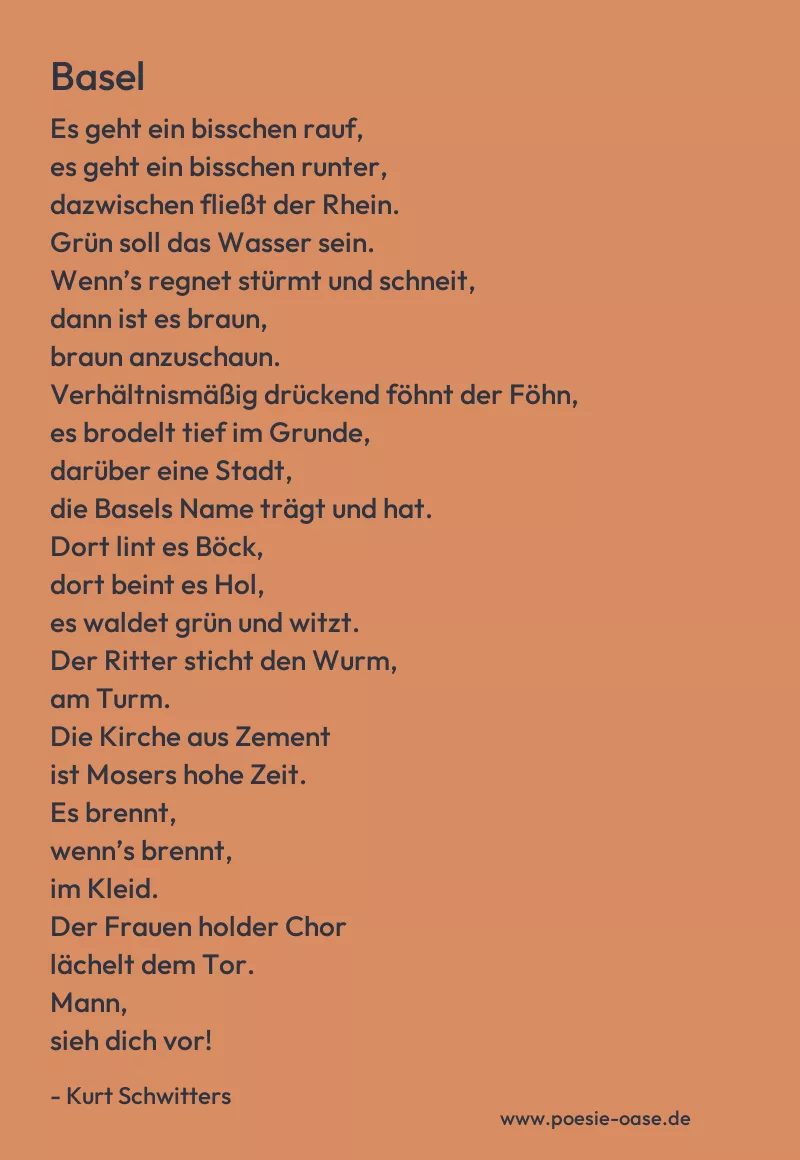Basel
Es geht ein bisschen rauf,
es geht ein bisschen runter,
dazwischen fließt der Rhein.
Grün soll das Wasser sein.
Wenn’s regnet stürmt und schneit,
dann ist es braun,
braun anzuschaun.
Verhältnismäßig drückend föhnt der Föhn,
es brodelt tief im Grunde,
darüber eine Stadt,
die Basels Name trägt und hat.
Dort lint es Böck,
dort beint es Hol,
es waldet grün und witzt.
Der Ritter sticht den Wurm,
am Turm.
Die Kirche aus Zement
ist Mosers hohe Zeit.
Es brennt,
wenn’s brennt,
im Kleid.
Der Frauen holder Chor
lächelt dem Tor.
Mann,
sieh dich vor!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
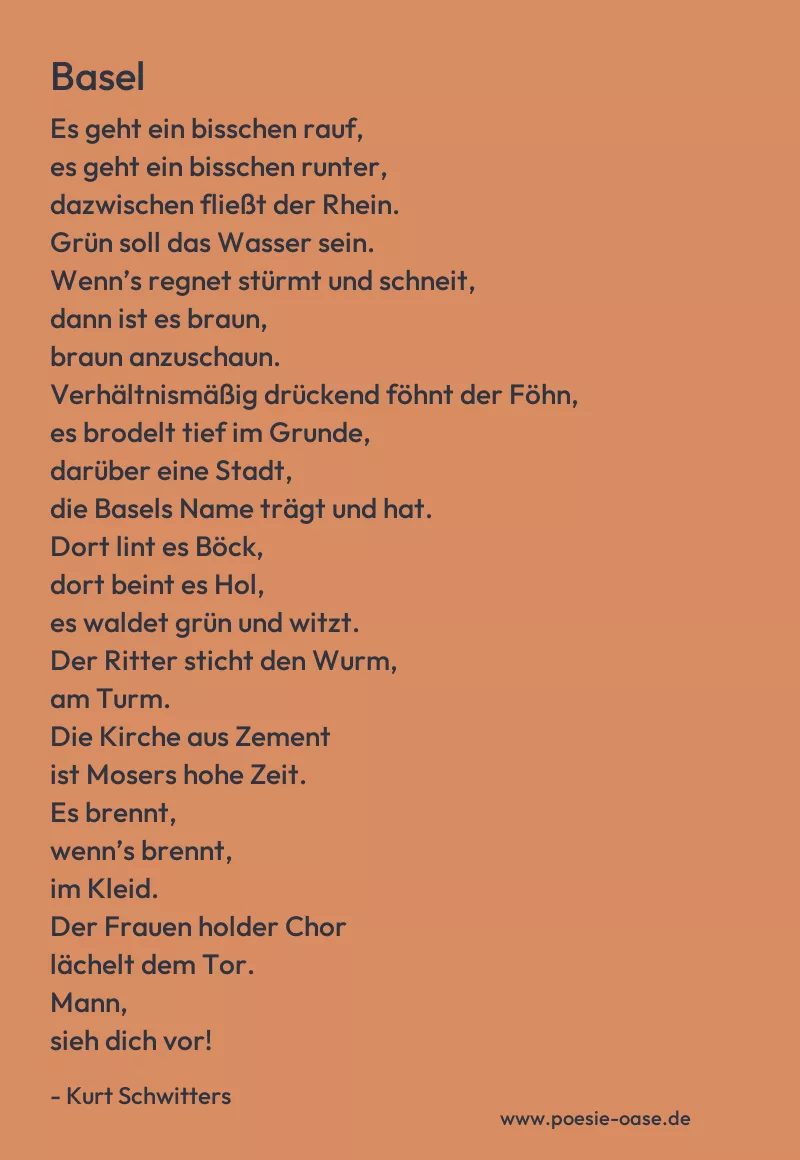
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Basel“ von Kurt Schwitters zeichnet ein Bild der Stadt Basel, indem es mit sprachlichen Experimenten und spielerischen Elementen die Wahrnehmung der Stadt durch den Leser herausfordert. Zu Beginn beschreibt der Sprecher die geographischen Merkmale der Stadt, wie den Rhein, der in seiner Darstellung mal grün, mal braun erscheint, je nachdem, wie das Wetter sich verändert. Diese Schwankungen spiegeln die Veränderlichkeit und Unbeständigkeit wider, die sowohl in der Natur als auch in der städtischen Wahrnehmung existieren.
Schwitters verwendet absichtlich unkonventionelle, teilweise unsinnige Begriffe wie „lint es Böck“ oder „beint es Hol“, um die gewöhnliche Wahrnehmung von Sprache zu untergraben und dem Leser zu zeigen, dass Sprache nicht nur der Verständigung dient, sondern auch als kreatives Werkzeug genutzt werden kann, um Emotionen und Eindrücke zu vermitteln. Der Duktus des Gedichts erinnert an dadaistische Prinzipien, bei denen die Bedeutung von Worten durch deren willentliche Verfremdung verändert wird.
Das Bild der Stadt Basel wird von Schwitters durch surrealistische Eindrücke, wie den „Ritter, der den Wurm am Turm sticht“, und der „Kirche aus Zement“, verstärkt. Diese Metaphern und visuellen Bilder werfen Fragen auf und lassen die Stadt als ein rätselhaftes, fast traumhaftes Gebilde erscheinen, das zwischen Tradition und Moderne schwankt. Der ungewöhnliche Wechsel von „es brennt, wenn’s brennt“ und die Erwähnung von „Frauen“ und „Tor“ erzeugen eine starke Konfrontation der Sinneseindrücke und der sozialen Realität.
Schwitters nutzt den freien Vers und eine sprunghafte Erzählweise, um eine Atmosphäre der Dichte und der Komplexität zu schaffen, die die Vielschichtigkeit einer Stadt wie Basel spiegelt. Die Verszeilen wechseln oft abrupt, was eine gewisse Unruhe in den Lesefluss bringt und gleichzeitig die Dynamik der Stadt, mit all ihren verschiedenen Facetten und Einflüssen, einfängt. Auch der „Föhn“, der in seiner „drückenden“ Weise das Wetter beeinflusst, fungiert als Metapher für die intensiven, oft widersprüchlichen Kräfte, die in der Stadt wirken. Schwitters schafft es, mit einfachen, teils nonsensischen Bildern die Komplexität einer urbanen Identität zu erfassen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.