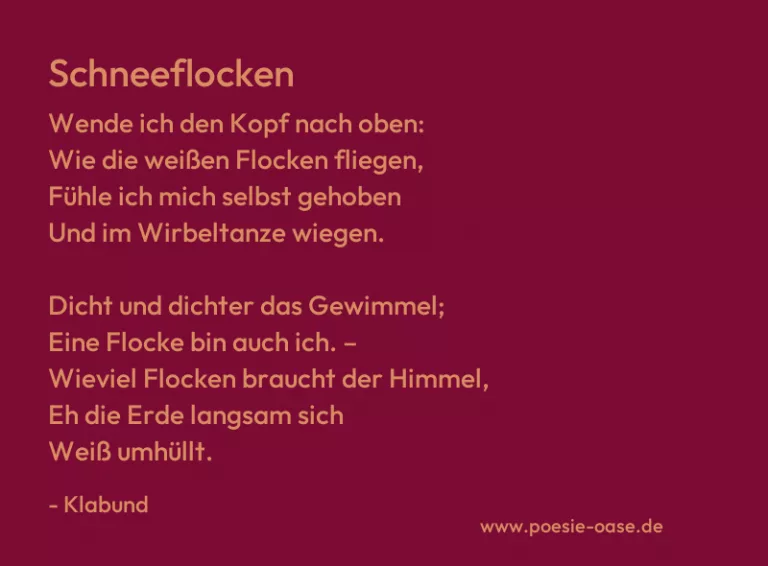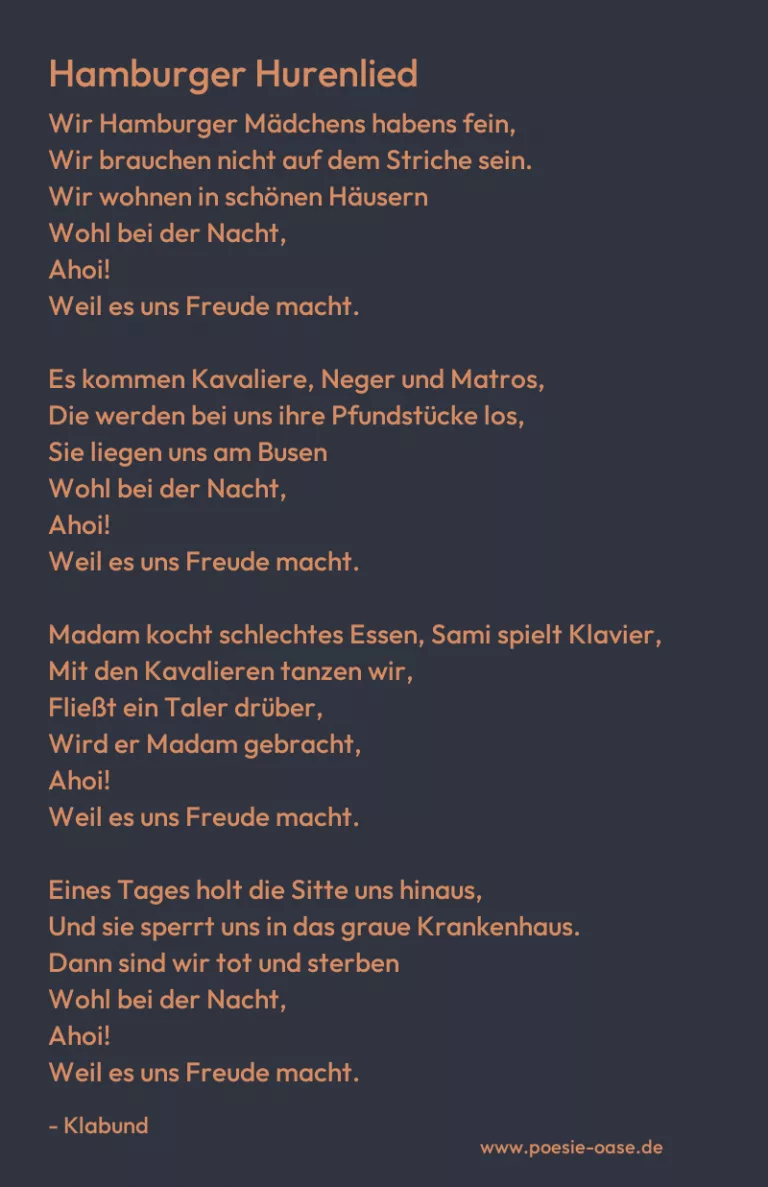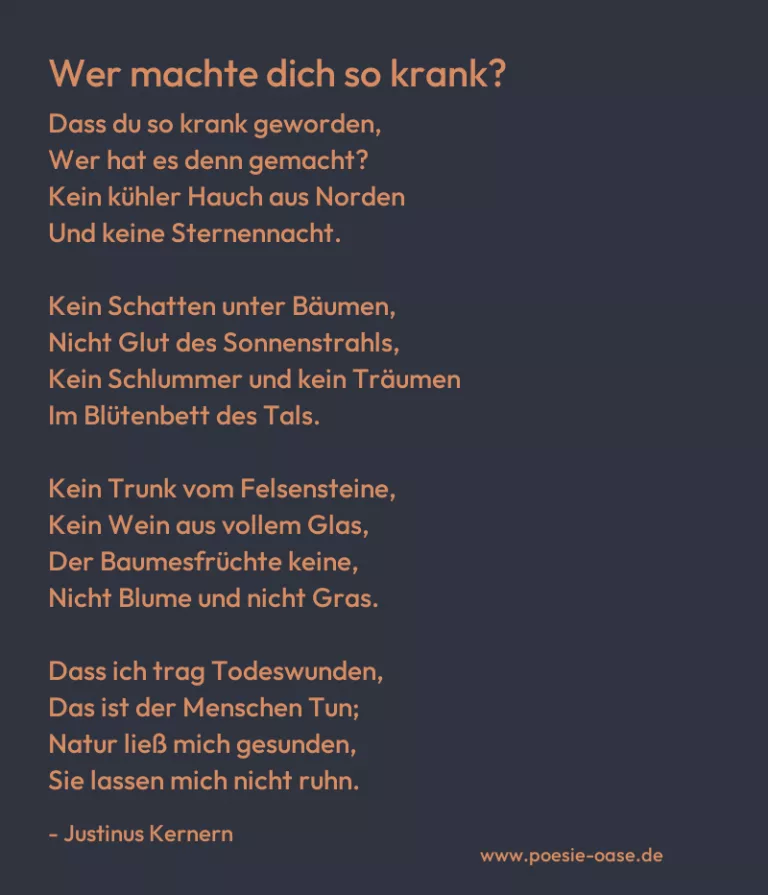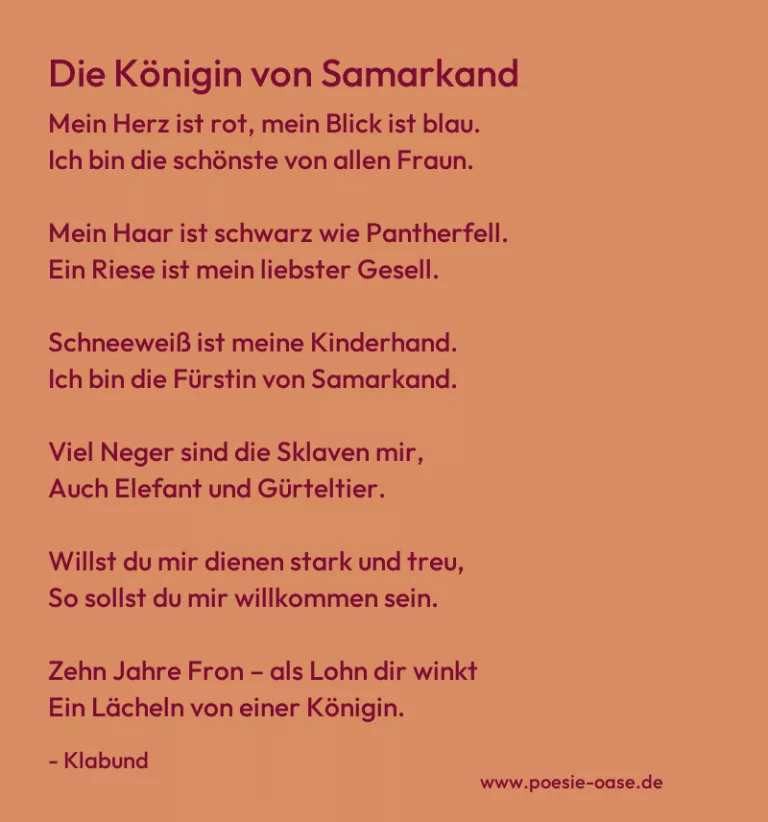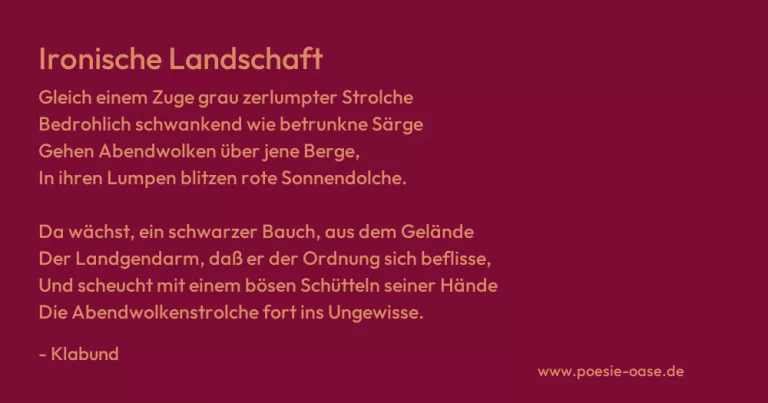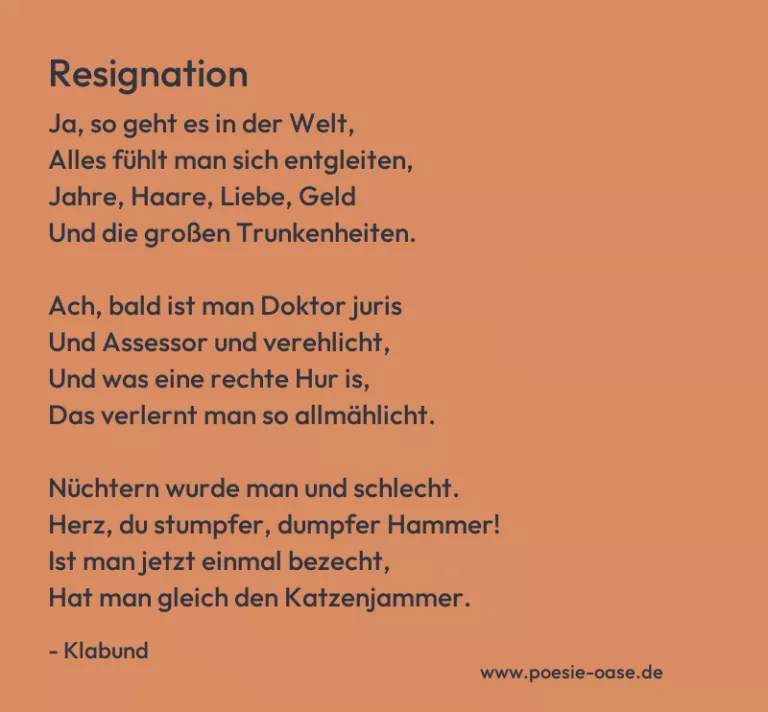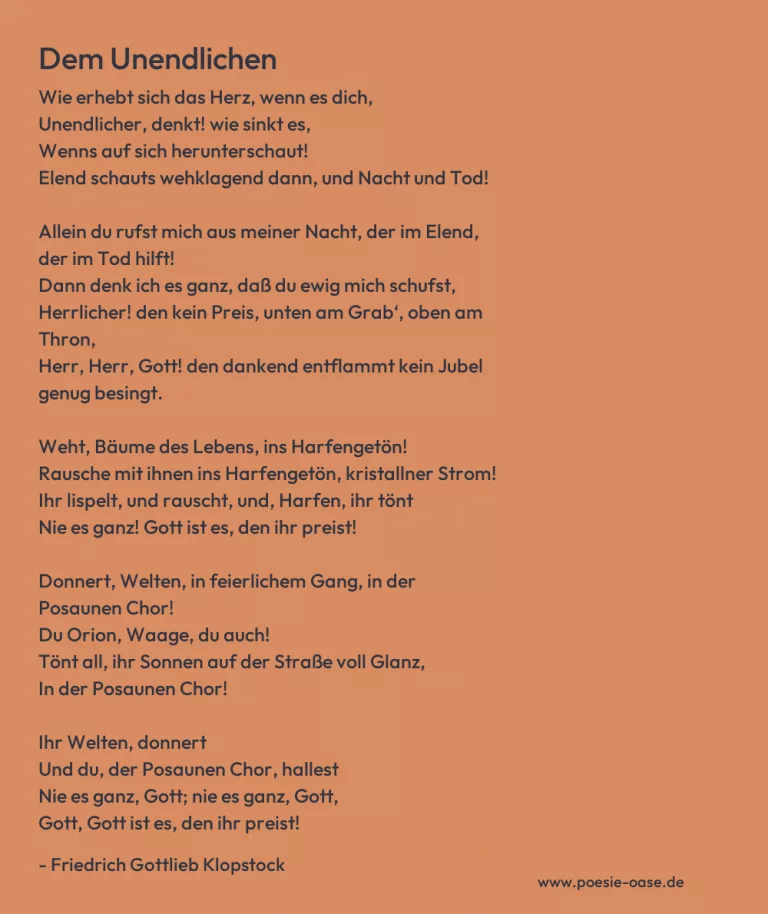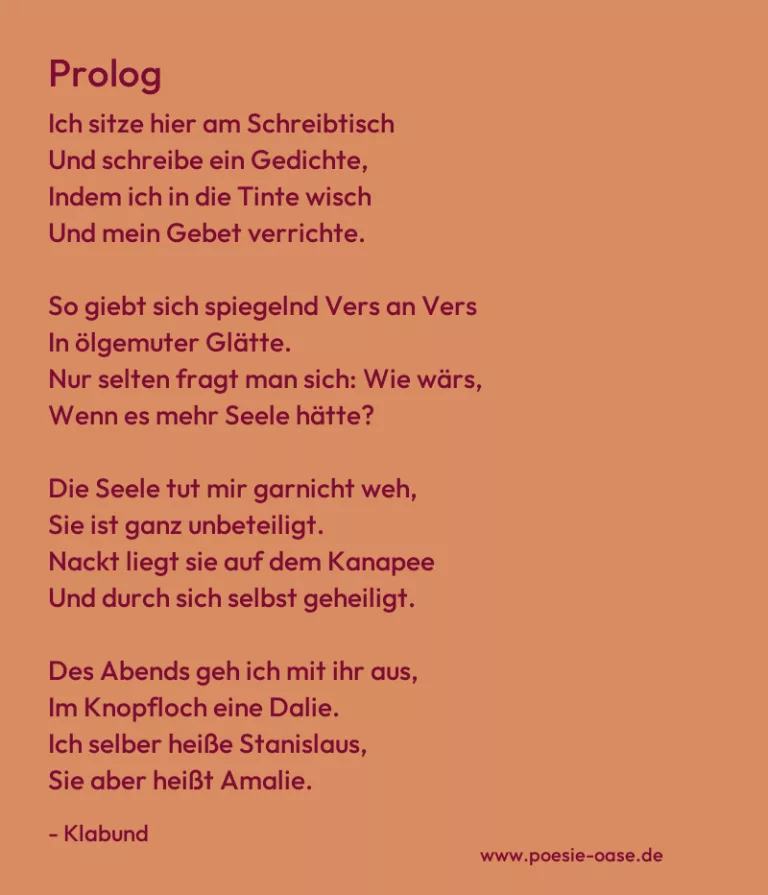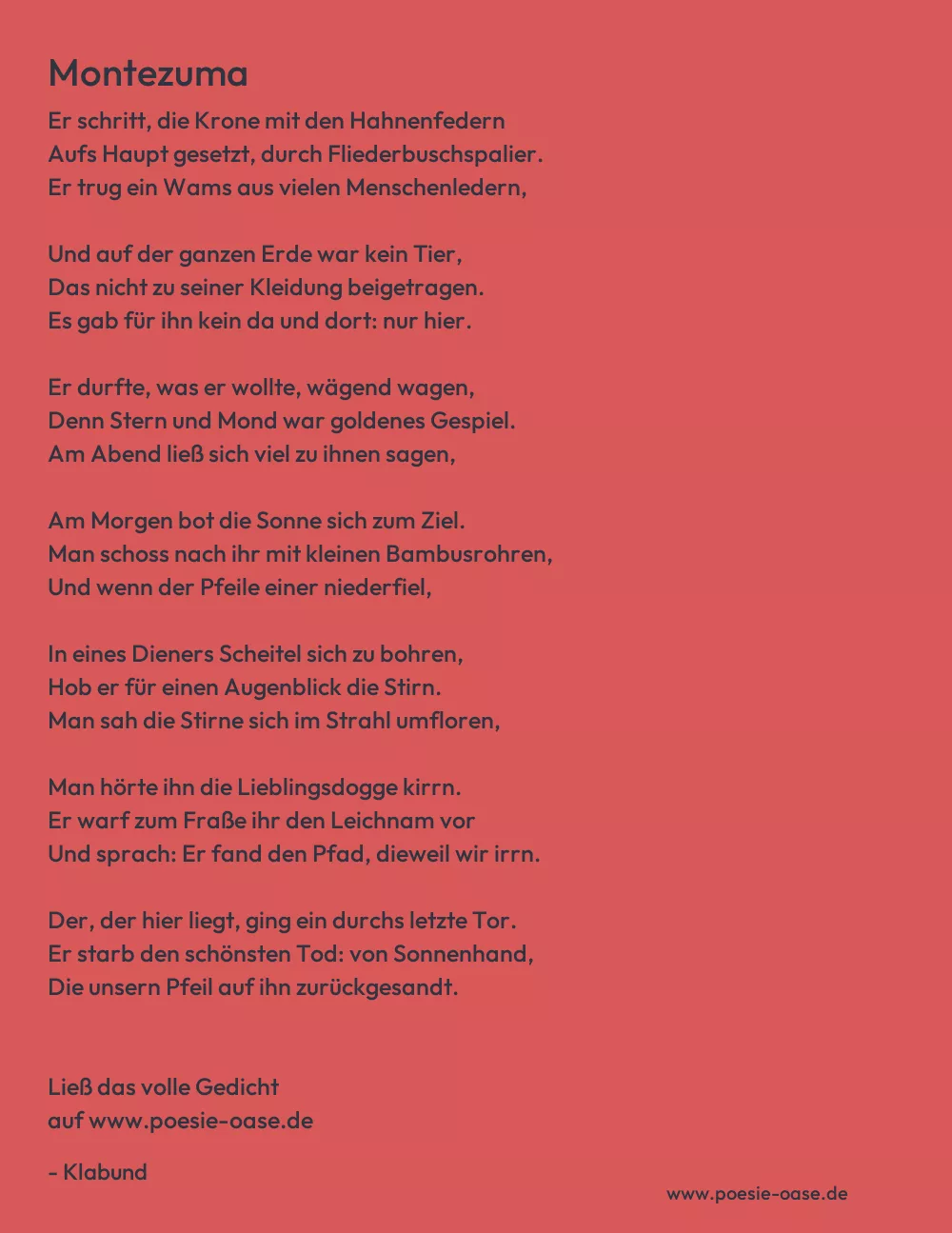Er schritt, die Krone mit den Hahnenfedern
Aufs Haupt gesetzt, durch Fliederbuschspalier.
Er trug ein Wams aus vielen Menschenledern,
Und auf der ganzen Erde war kein Tier,
Das nicht zu seiner Kleidung beigetragen.
Es gab für ihn kein da und dort: nur hier.
Er durfte, was er wollte, wägend wagen,
Denn Stern und Mond war goldenes Gespiel.
Am Abend ließ sich viel zu ihnen sagen,
Am Morgen bot die Sonne sich zum Ziel.
Man schoss nach ihr mit kleinen Bambusrohren,
Und wenn der Pfeile einer niederfiel,
In eines Dieners Scheitel sich zu bohren,
Hob er für einen Augenblick die Stirn.
Man sah die Stirne sich im Strahl umfloren,
Man hörte ihn die Lieblingsdogge kirrn.
Er warf zum Fraße ihr den Leichnam vor
Und sprach: Er fand den Pfad, dieweil wir irrn.
Der, der hier liegt, ging ein durchs letzte Tor.
Er starb den schönsten Tod: von Sonnenhand,
Die unsern Pfeil auf ihn zurückgesandt.
Er aber wusste nichts von Gut und Böse,
Denn die Erscheinung war ihm lieb und wert.
Er schluchzte tief in eines Hunds Gekröse,
Er weinte tagelang mit einem Pferd,
Dass ihn sein Wiehern von dem Wort erlöse:
Zu wissen nichts, dass eines Wissens wert.
Er hätte täglich lächelnd sterben können,
Denn Tod war ihm ein Wort wie andre auch.
Ob bei den Kinderopfern Tränen rönnen:
Das war nur Zeremonie und ein Brauch.
Wenn sie zu lachen über sich gewönnen
Im Tode und im Todeskrampf der Bauch
Sich im Gelächter der Vernichtung wände:
Wärs nicht ein Gott gefälligeres Ende?
Und als man ihm das weiße Mädchen brachte,
War er erstaunt wie ein Geburtstagskind.
Er lobte ihre Weiße, und er lachte
Und rief zur Schau das schämige Gesind.
Und runzelte die schöne Stirn und dachte
An einen Goldfasan, den als Gebind
Er gern dem wunderlichen Wahn vermachte,
Und wie die Weißen in der Liebe sind,
Dies wars, was ihn zu sachter Glut entfachte.
Er führte sie in ein Gemach, und lind
Erlöst er ihre Haut von hänfner Kette,
Indes ihr Blut vor Angst und Qual gerinnt.
Denn an den Wänden stehen viel Skelette,
Gepflastert ist der Boden mit Gebein.
Die Sockel auch am bunten Liebesbette:
Es müssen toter Menschen Knochen sein.
Sie will mit einem Fall ins Knie sich retten,
Er aber lächelt unerbittlich nein.
Er hebt mit einem Pfiffe wie von Ratten
Sie auf das Bett, sie tödlich zu begatten.
Und als den letzten Kuss von ihrem Munde,
Dem schon erkalteten, er gierig nahm,
Da fühlte er an seinem Leib die Wunde
Die ewig blutende. Und schritt und kam
Zu seines Adels innerlichstem Grunde,
Und fühlte seines Lebens Schuld und Scham.
Darf hoffen, wer so krank, dass er gesunde?
Er hinkte durch die Kammer, lendenlahm,
Und zählte zitternd jede neue Stunde.
Warum bin ich verdammt, ach ohn Erröten
Die Wesen, die ich lieben muss, zu töten?
Indem er sich aus seinen Kissen hob,
Verfiel sein Blick auf einen goldnen Affen,
Um den die Morgensonne Strahlen stob.
Und als er näher trat, ihn zu begaffen
Noch zweifelnd, ob mit Tadel oder Lob
Er ihn bedenke: sah er ihn entraffen
Im Teppich sich, den seine Amme wob.
Er stand im Morgenlicht vor dem Gewebe:
Der Affe glänzt. Ich spüre, dass ich lebe.
Der fremde Ritter in der schwarzen Rüstung
Begegnete dem Gruß des Kaisers streng.
Der lehnte schwach und schwächlich an der Brüstung,
Als risse seiner Adern blau Gesträng,
Als wär er nur ein Schachtelhalm im Winde
Vor jenem, dem er seine Demut säng.
Als trüg er vor den Augen eine Binde
Und sähe nun nach innen. Und darin
War nichts als Eitelkeit und eitle Sünde,
Und war nur Sinnlichkeit und war kein Sinn
Und war kein edles Ziel, kein zarter Zweck.
Und ginge er an diesem Tag dahin,
Es bliebe nichts als eine Handvoll Dreck. –
Der Ritter sprach: Ich bin der Abgesandte
Des großen weißen Herrschers überm Meer.
Ich kam, weil deine Dunkelheit ich kannte,
Mit hunderttausend hellen Helden her.
So unterwirf dich, eh er dich berannte
Mit seinem unbesiegten Engelheer.
Du bist vor seinen Augen ganz geringe,
So neig dich, eh ich dich zur Neigung zwinge.
Du hast die reinste Schwester uns geschändet,
Weil du nur Wunschgewalt, nicht Liebe kennst.
Wie bald hast du dein Pfauensein geendet,
Wenn du dir selbst als Totenfackel brennst.
Das Schicksal hat zur Schickung sich gewendet.
Und ob du in Gebeten flammst und flennst:
Es darf von dir auf Erden nicht ein Hauch sein.
Du wirst verbrannt. Dein Letztes wird dein Rauch sein.
Und jener zitterte und brach ins Knie
Und wusste nichts, als dass er seines Hortes
Hüter nun nicht mehr sei, und wie ein Vieh
Ein ganz vom Hunger und vom Durst verdorrtes
Er bis zur Kuppel des Palastes schrie.
Er sträubte seine Haare wie ein Puma.
Der andre sprach: So huldige, Montezuma,
Des weißen Kaisers Abgesandtem: Cortez!