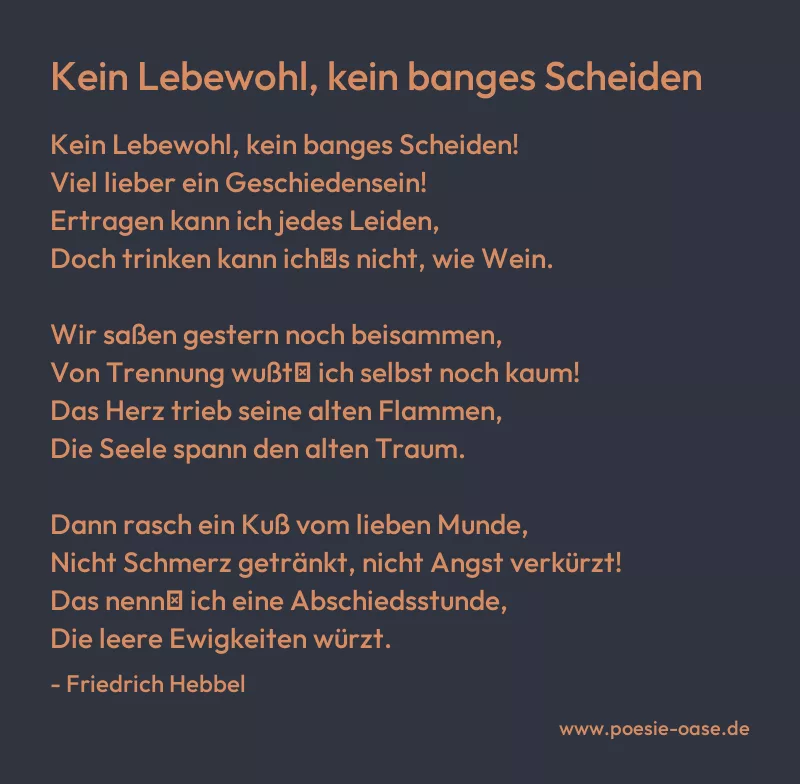Kein Lebewohl, kein banges Scheiden
Kein Lebewohl, kein banges Scheiden!
Viel lieber ein Geschiedensein!
Ertragen kann ich jedes Leiden,
Doch trinken kann ich′s nicht, wie Wein.
Wir saßen gestern noch beisammen,
Von Trennung wußt′ ich selbst noch kaum!
Das Herz trieb seine alten Flammen,
Die Seele spann den alten Traum.
Dann rasch ein Kuß vom lieben Munde,
Nicht Schmerz getränkt, nicht Angst verkürzt!
Das nenn′ ich eine Abschiedsstunde,
Die leere Ewigkeiten würzt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
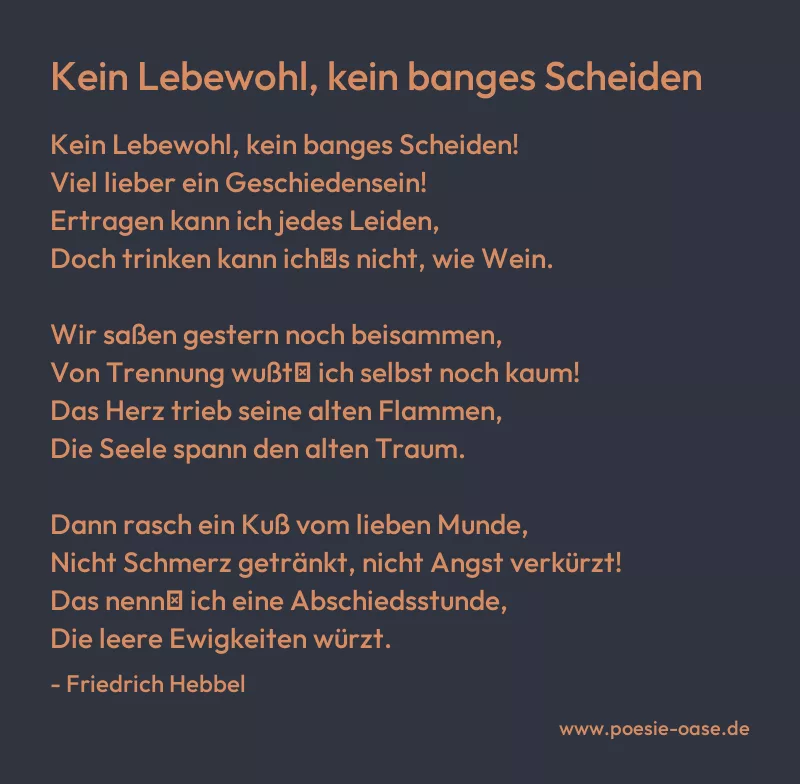
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Kein Lebewohl, kein banges Scheiden“ von Friedrich Hebbel thematisiert die Sehnsucht nach einem unkomplizierten Abschied und die Unfähigkeit, schmerzhafte Trennungen vollständig zu verarbeiten. Der Titel selbst deutet bereits die Präferenz des lyrischen Ichs an: kein pathetischer Abschied, sondern eine nüchterne Akzeptanz des Getrenntseins. Diese Haltung wird durch die rhetorische Frage im ersten Vers unterstrichen, die die Ablehnung von Abschiedszeremonien zugunsten des eigentlichen Getrenntseins betont. Die gewählte Formulierung „Viel lieber ein Geschiedensein!“ drückt eine bewusste Entscheidung für die Realität der Trennung aus, frei von theatralischen Abschiedsgesten.
Die darauffolgenden Verse veranschaulichen das Dilemma des lyrischen Ichs. Es kann jedes Leid ertragen, aber nicht „trinken“, also nicht vollständig verarbeiten, wie Wein. Diese Metapher verdeutlicht die tiefe Sehnsucht nach einem klaren Bruch, der die Möglichkeit des Loslassens und des Neuanfangs bietet. Die Erinnerung an das gestrige Zusammensein, als die Trennung noch unvorstellbar schien, steigert die Intensität der Gefühle. Das Herz, das „seine alten Flammen“ antrieb, und die Seele, die „den alten Traum“ spann, zeugen von der Vergangenheit und der damit verbundenen Nostalgie, die das lyrische Ich überwinden muss.
Der dritte Abschnitt beschreibt den Abschied als eine plötzliche, nahezu unvorbereitete Geste: ein Kuss vom „lieben Munde“. Dieser Kuss ist weder von Schmerz getränkt noch durch Angst verkürzt, was auf eine gewisse Leichtigkeit und Unbekümmertheit hindeutet. Diese Abschiedsstunde wird als etwas Besonderes hervorgehoben, das „leere Ewigkeiten würzt“. Dies impliziert, dass der Abschied, so kurz er auch sein mag, die Leere des Daseins mit einer intensiven Erfahrung füllt, selbst wenn diese Erfahrung von Trennung und Schmerz geprägt ist. Der Kuss steht somit für eine Momentaufnahme, die das Gefühl der Trennung gleichzeitig verstärkt und mildert.
Insgesamt reflektiert das Gedicht die Ambivalenz des lyrischen Ichs gegenüber Abschieden. Es sehnt sich nach einem schmerzfreien Getrenntsein, wird aber mit der Unfähigkeit konfrontiert, das Leid vollständig zu bewältigen. Die knappe Beschreibung des Abschieds, der Kuss als Symbol, und die Betonung des „Geschiedenseins“ anstelle des Lebewohls unterstreichen die Sehnsucht nach einer einfachen, weniger emotional aufgeladenen Art des Abschieds. Hebbel gelingt es, in wenigen Versen eine komplexe Gefühlswelt darzustellen, die von Sehnsucht, Akzeptanz und der Suche nach dem wahren Verarbeiten des Leids geprägt ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.