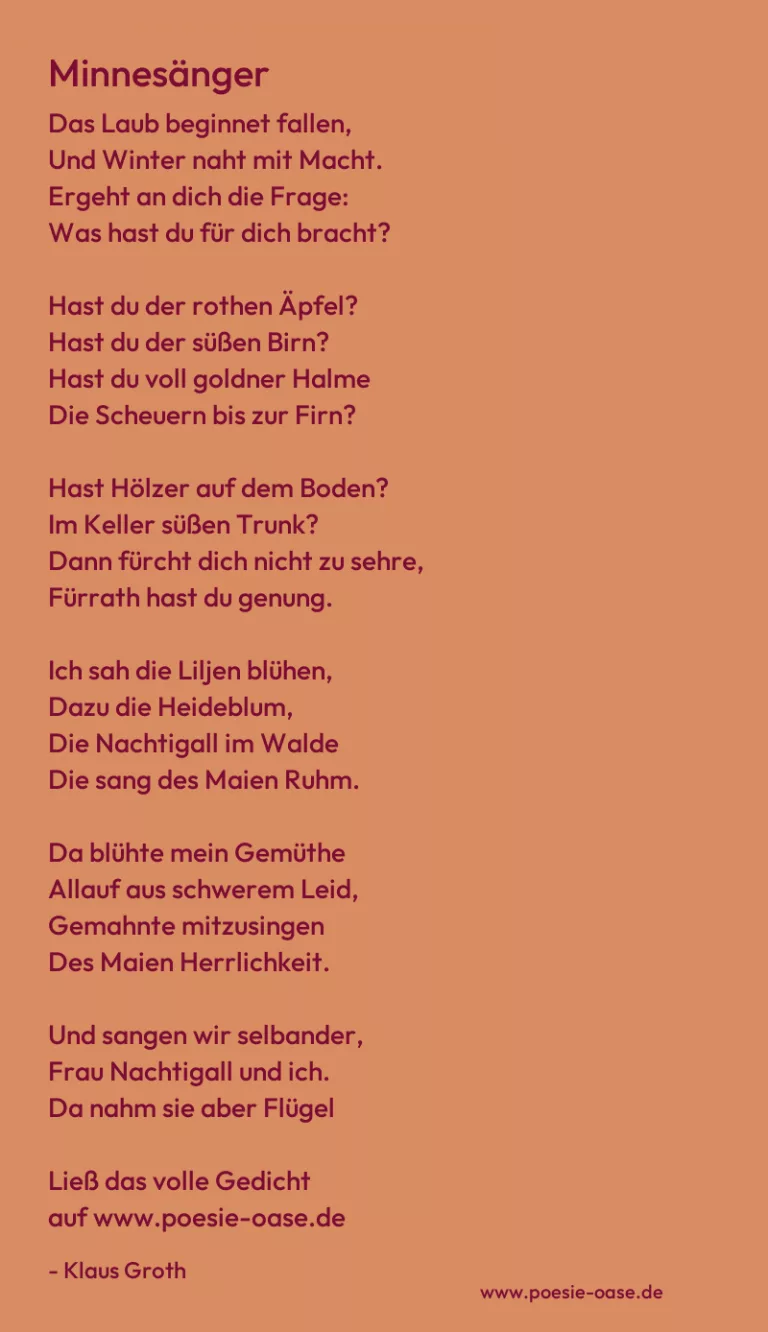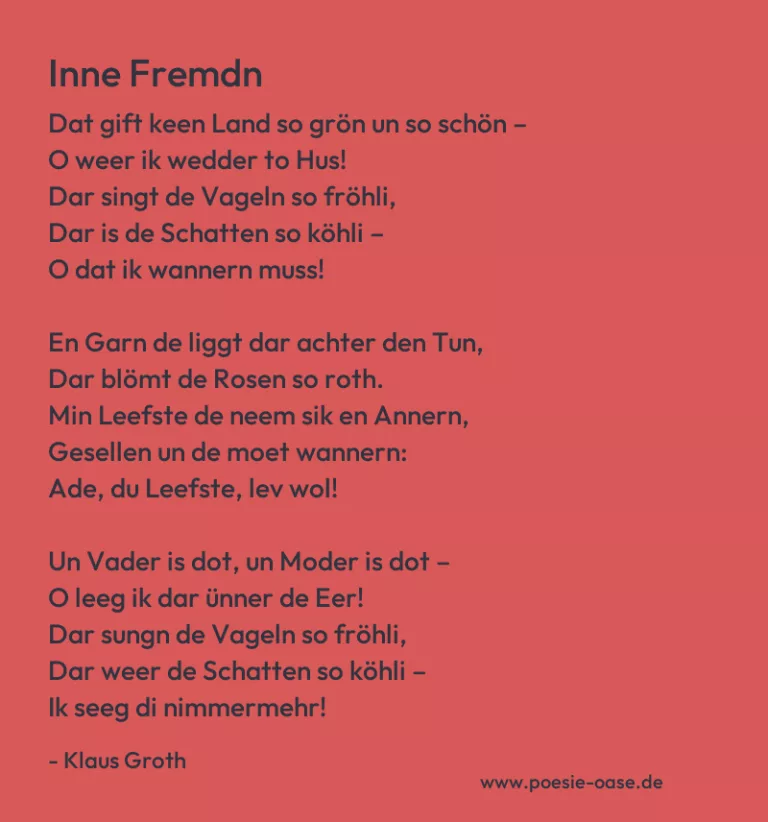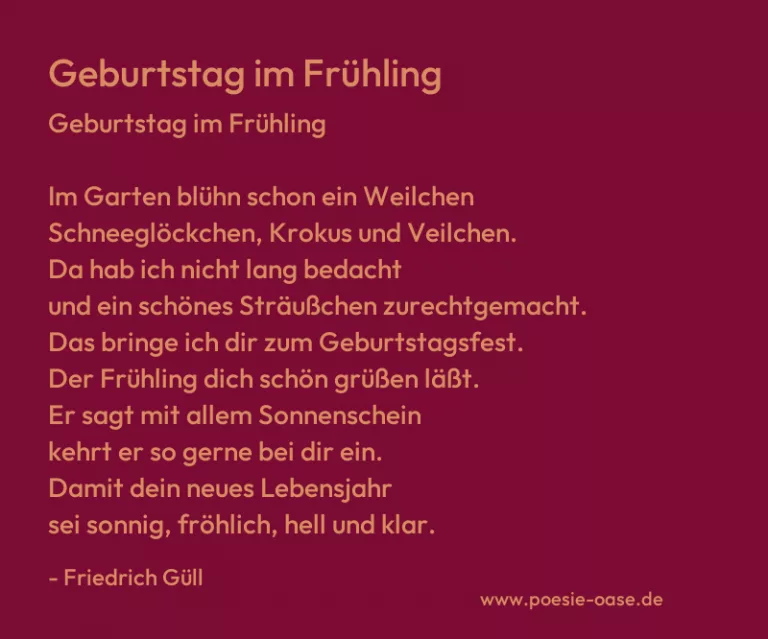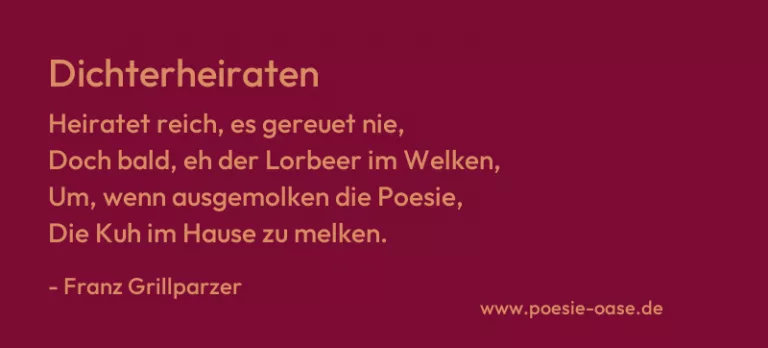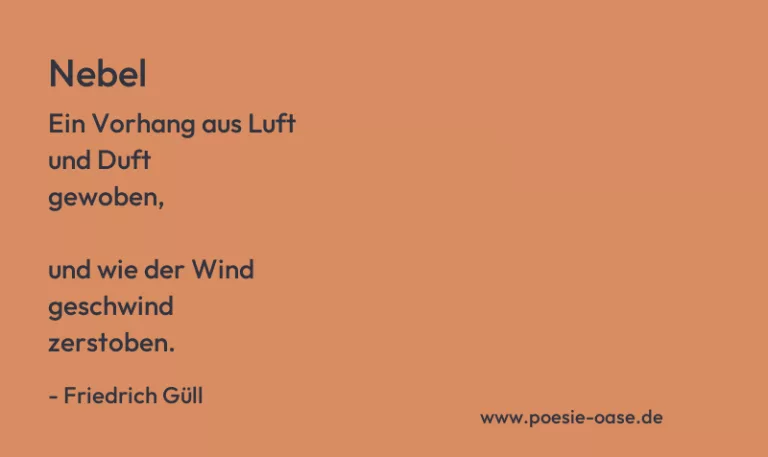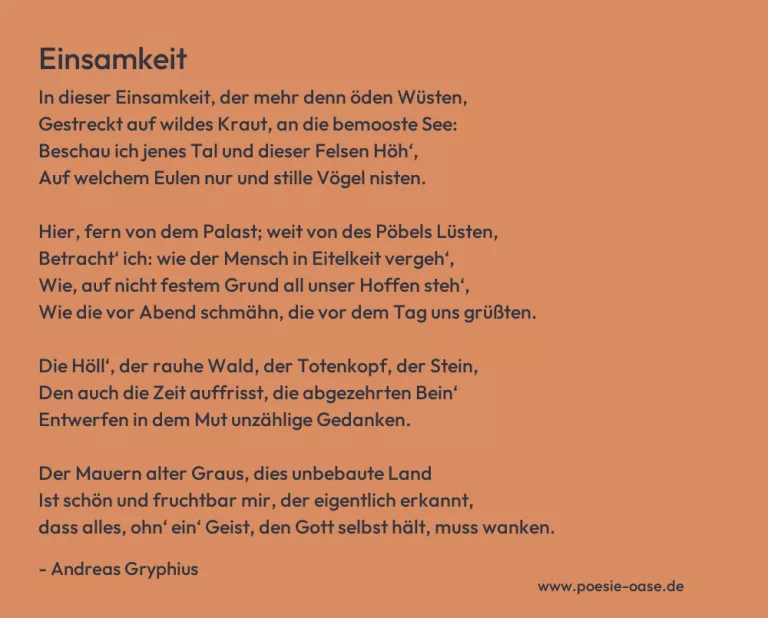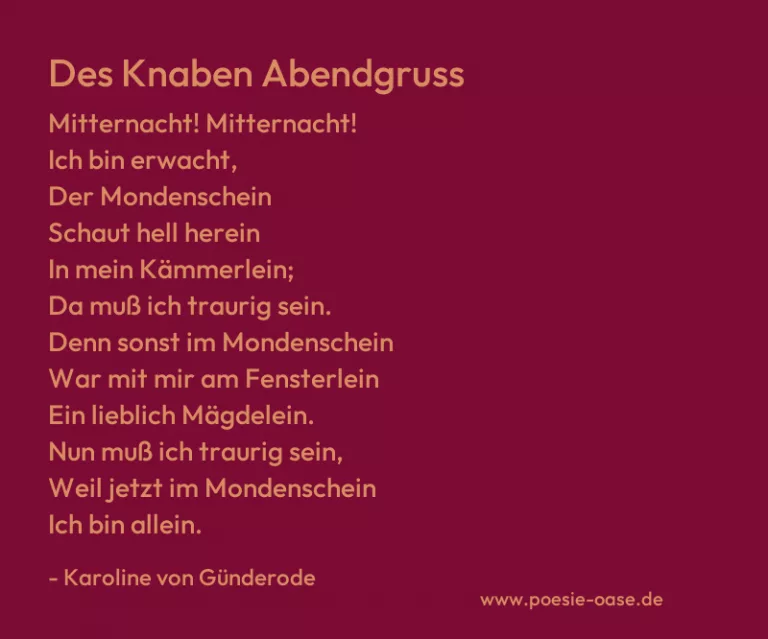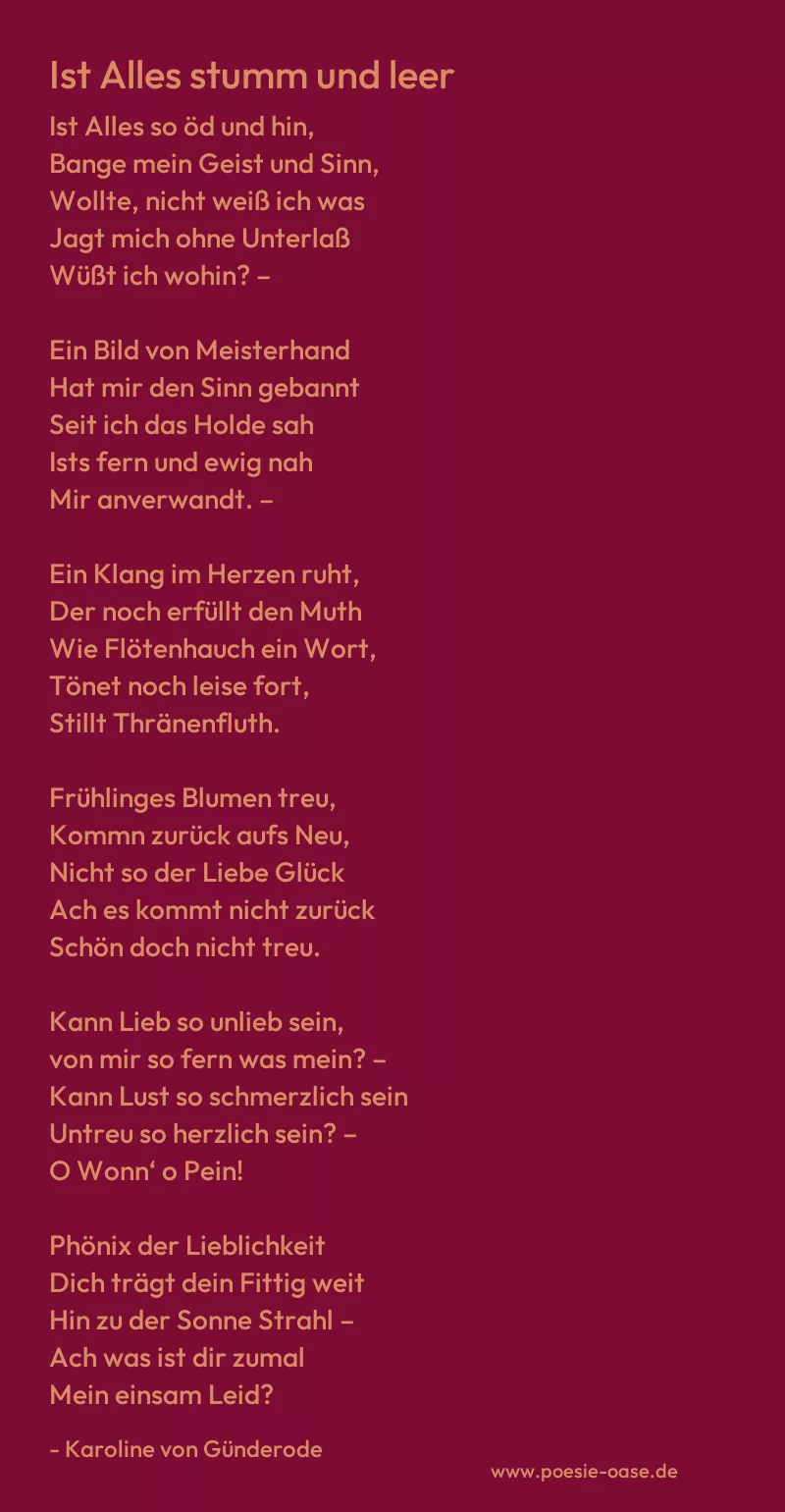Ist Alles so öd und hin,
Bange mein Geist und Sinn,
Wollte, nicht weiß ich was
Jagt mich ohne Unterlaß
Wüßt ich wohin? –
Ein Bild von Meisterhand
Hat mir den Sinn gebannt
Seit ich das Holde sah
Ists fern und ewig nah
Mir anverwandt. –
Ein Klang im Herzen ruht,
Der noch erfüllt den Muth
Wie Flötenhauch ein Wort,
Tönet noch leise fort,
Stillt Thränenfluth.
Frühlinges Blumen treu,
Kommn zurück aufs Neu,
Nicht so der Liebe Glück
Ach es kommt nicht zurück
Schön doch nicht treu.
Kann Lieb so unlieb sein,
von mir so fern was mein? –
Kann Lust so schmerzlich sein
Untreu so herzlich sein? –
O Wonn‘ o Pein!
Phönix der Lieblichkeit
Dich trägt dein Fittig weit
Hin zu der Sonne Strahl –
Ach was ist dir zumal
Mein einsam Leid?