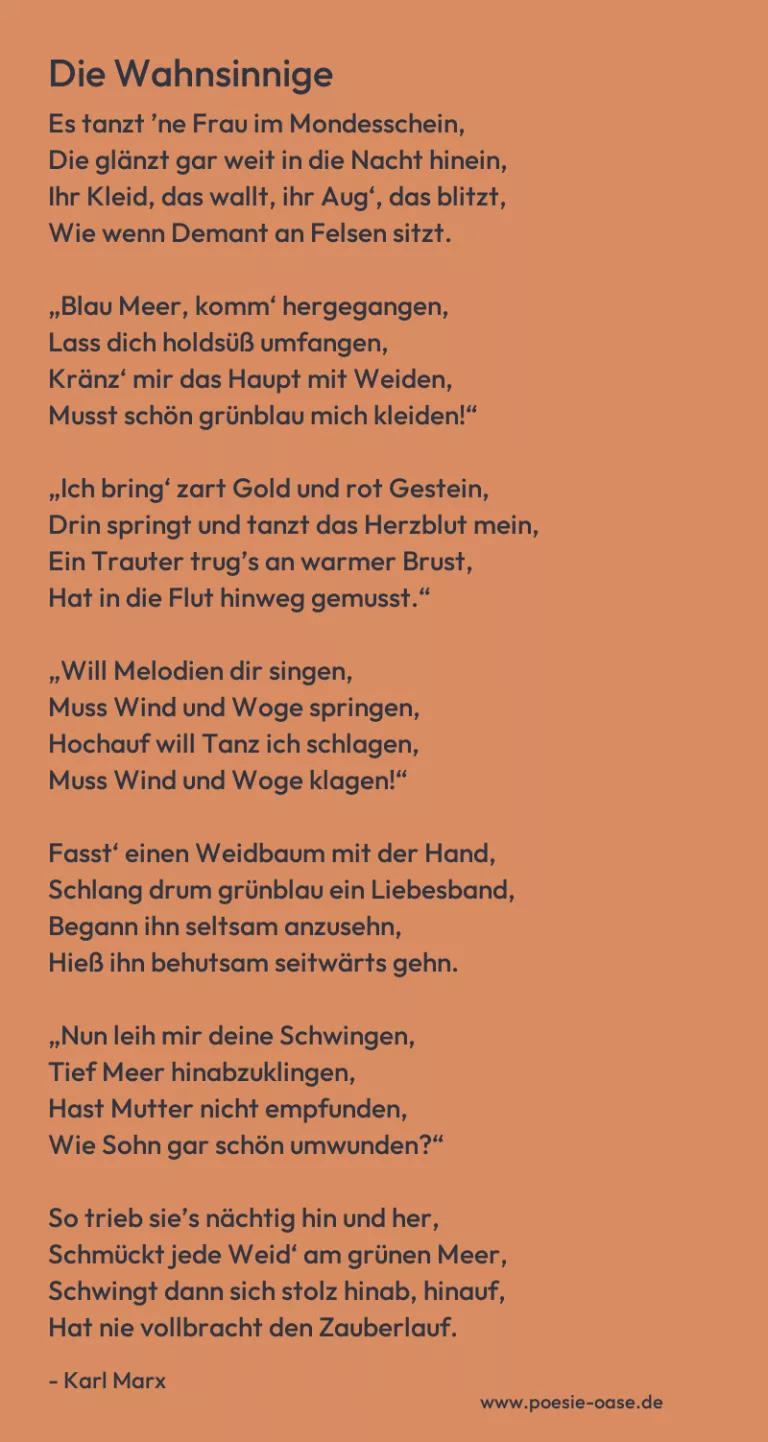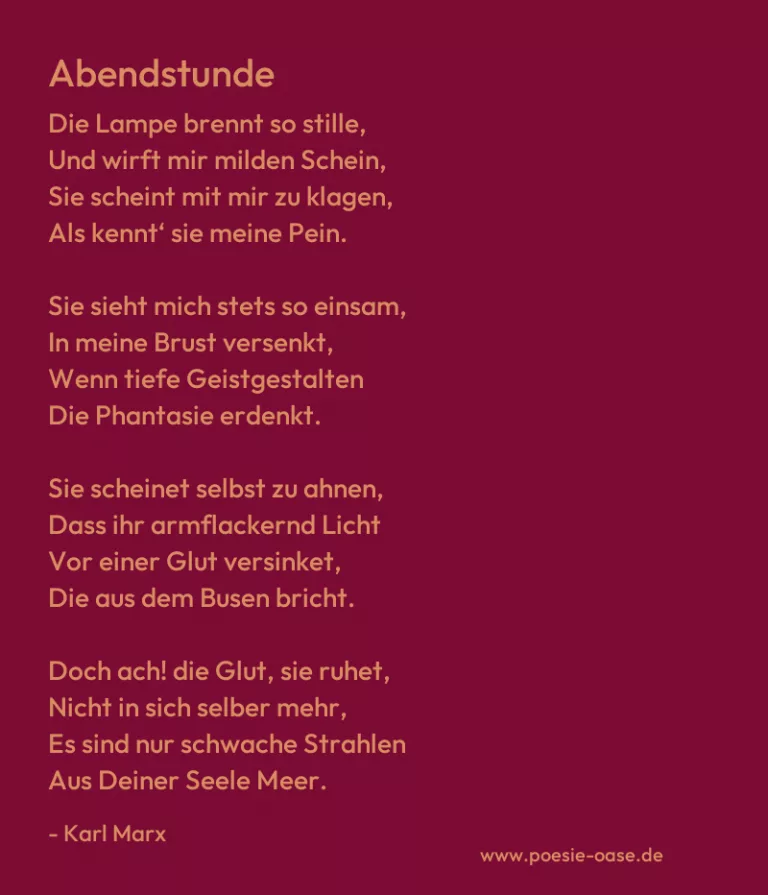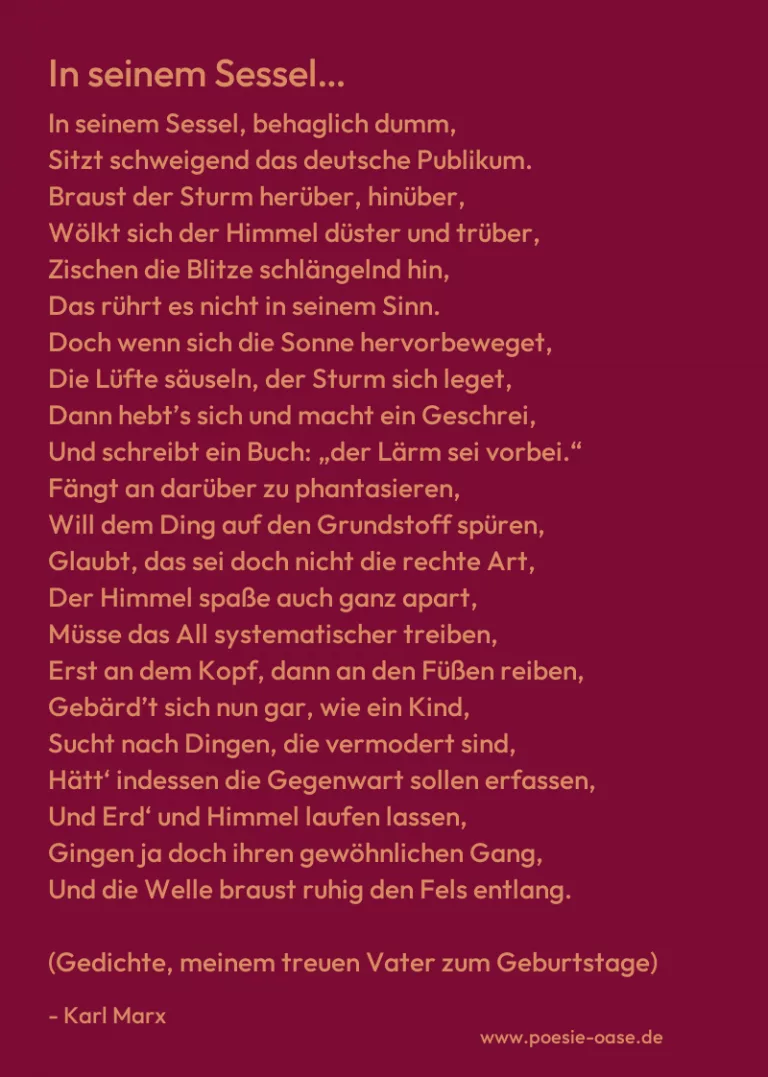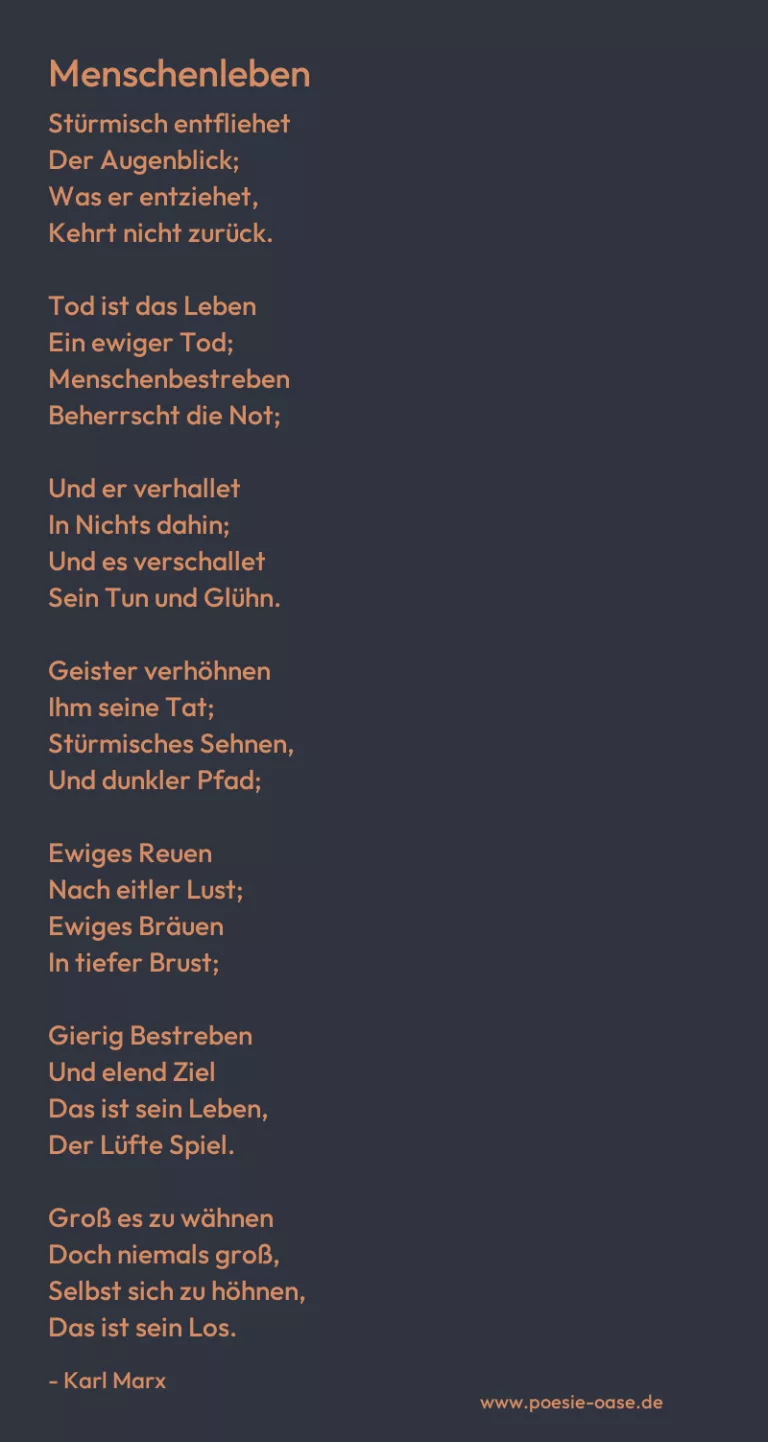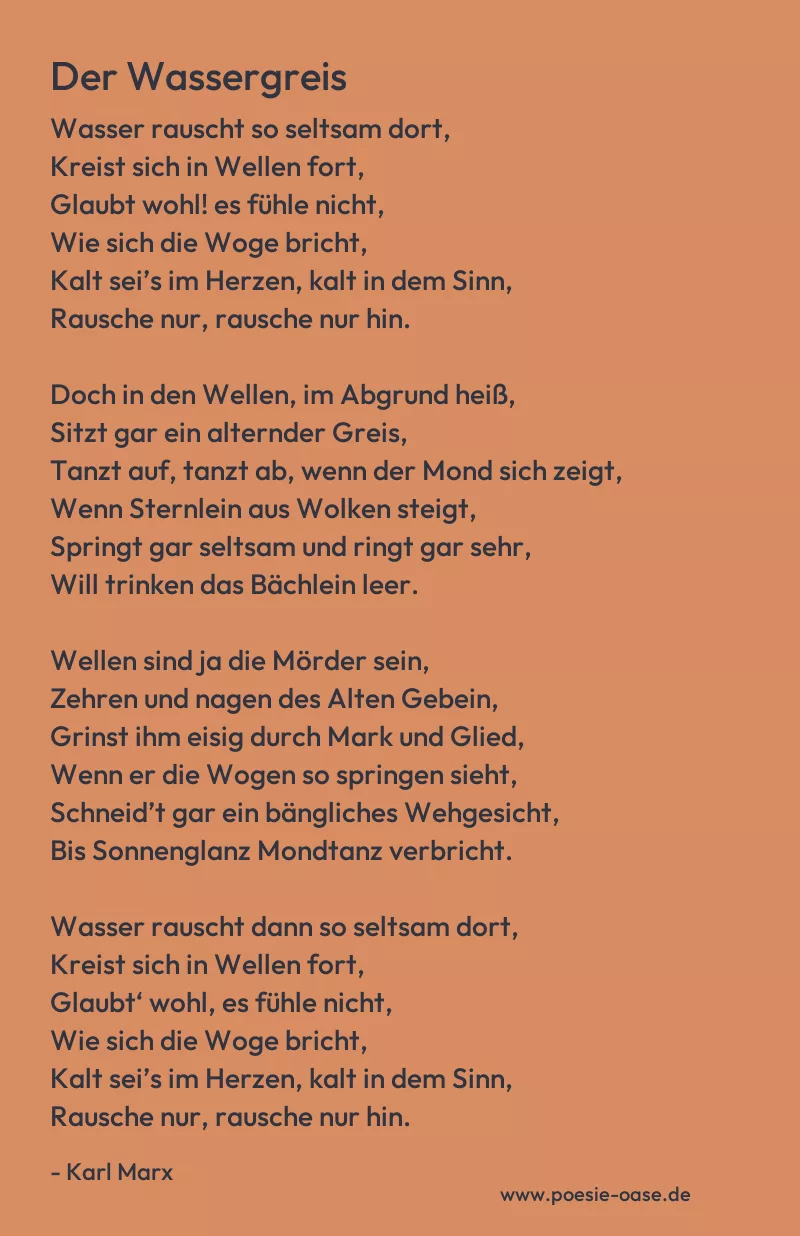Der Wassergreis
Wasser rauscht so seltsam dort,
Kreist sich in Wellen fort,
Glaubt wohl! es fühle nicht,
Wie sich die Woge bricht,
Kalt sei’s im Herzen, kalt in dem Sinn,
Rausche nur, rausche nur hin.
Doch in den Wellen, im Abgrund heiß,
Sitzt gar ein alternder Greis,
Tanzt auf, tanzt ab, wenn der Mond sich zeigt,
Wenn Sternlein aus Wolken steigt,
Springt gar seltsam und ringt gar sehr,
Will trinken das Bächlein leer.
Wellen sind ja die Mörder sein,
Zehren und nagen des Alten Gebein,
Grinst ihm eisig durch Mark und Glied,
Wenn er die Wogen so springen sieht,
Schneid’t gar ein bängliches Wehgesicht,
Bis Sonnenglanz Mondtanz verbricht.
Wasser rauscht dann so seltsam dort,
Kreist sich in Wellen fort,
Glaubt‘ wohl, es fühle nicht,
Wie sich die Woge bricht,
Kalt sei’s im Herzen, kalt in dem Sinn,
Rausche nur, rausche nur hin.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
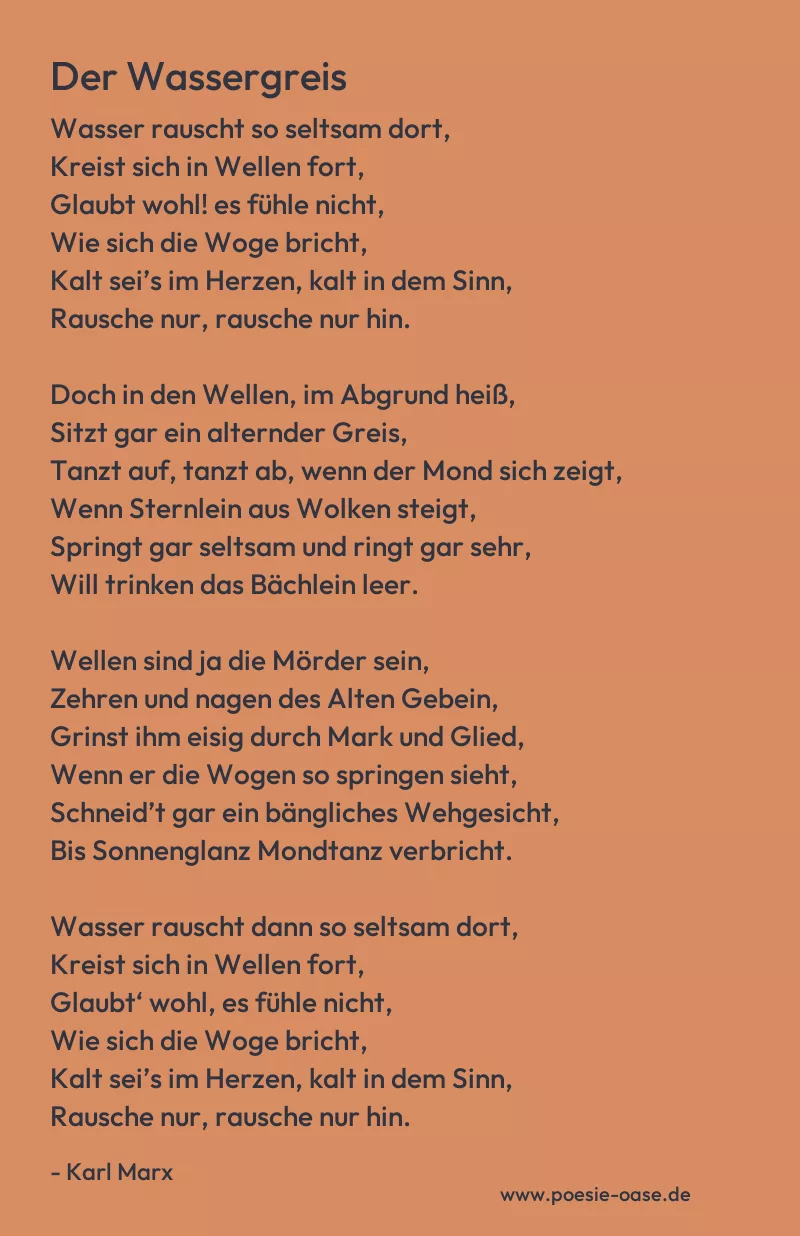
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Wassergreis“ von Karl Marx ist eine düstere, symbolisch aufgeladene Darstellung innerer Qual und existenzieller Ausweglosigkeit. In einer fast märchenhaften Szenerie verbindet Marx Naturbild, Allegorie und psychologischen Ausdruck, um das Leiden eines alten Mannes zu schildern, der im unaufhörlichen Kreislauf der Wellen seine eigene Verlorenheit und Vergeblichkeit spiegelt.
Die wiederkehrende Bewegung des Wassers – das „seltsame Rauschen“, das „Kreisen in Wellen“ – wirkt auf den ersten Blick gleichgültig, beinahe gefühllos. Die Natur erscheint als kalte, sich ständig wiederholende Macht, die nicht empfindet, wie „sich die Woge bricht“. Diese Gleichgültigkeit der Natur gegenüber menschlichem Leid wird im Gedicht mehrmals betont und kontrastiert mit dem inneren Schmerz des Wassergreises.
Im Zentrum steht die Figur des Greises, der im Wasser lebt oder vom Wasser umfangen ist. Er „tanzt“, „springt“, „ringt“, doch all diese Bewegungen erscheinen verzweifelt und sinnlos. Das Bild des Trinkens – er will das Bächlein leertrinken – kann als symbolischer Ausdruck eines verzweifelten Versuchs verstanden werden, die Quelle des eigenen Schmerzes auszulöschen oder die Leere zu stillen. Die Darstellung changiert zwischen Groteske und Tragik: Der Greis wird von den Wellen zugleich verspottet und zerstört.
Besonders eindrücklich ist die Beschreibung des Wassers als „Mörder“, das „zehrt und nagt“ am „Gebein“ des Alten. Die Kälte dringt bis ins „Mark und Glied“, die Natur wird zur grausamen, fast dämonischen Kraft, die nicht nur passiv, sondern aktiv zerstört. Der „bängliche Wehgesicht“ suggeriert eine fast wahnsinnige Verzweiflung, die nur durch das Aufbrechen des Tageslichts – der „Sonnenglanz“ – kurzzeitig gestoppt wird. Doch auch dieser Trost scheint vorübergehend.
Das Gedicht endet mit der Wiederaufnahme der ersten Strophe und schließt den Kreis – genau wie das Wasser selbst, das sich „in Wellen fortkreist“. Diese Struktur betont den Zyklus von Schmerz, Erinnerung und Vergeblichkeit. Der Wassergreis bleibt gefangen in einem elementaren, seelischen Strom, der kein Ziel kennt. In diesem Gedicht zeigt sich eine frühe, fast romantisch gefärbte Reflexion Karl Marx’ über das Verhältnis von Mensch und Natur – als Konfrontation von fühlendem, leidendem Subjekt mit einer kalten, unbarmherzigen Welt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.