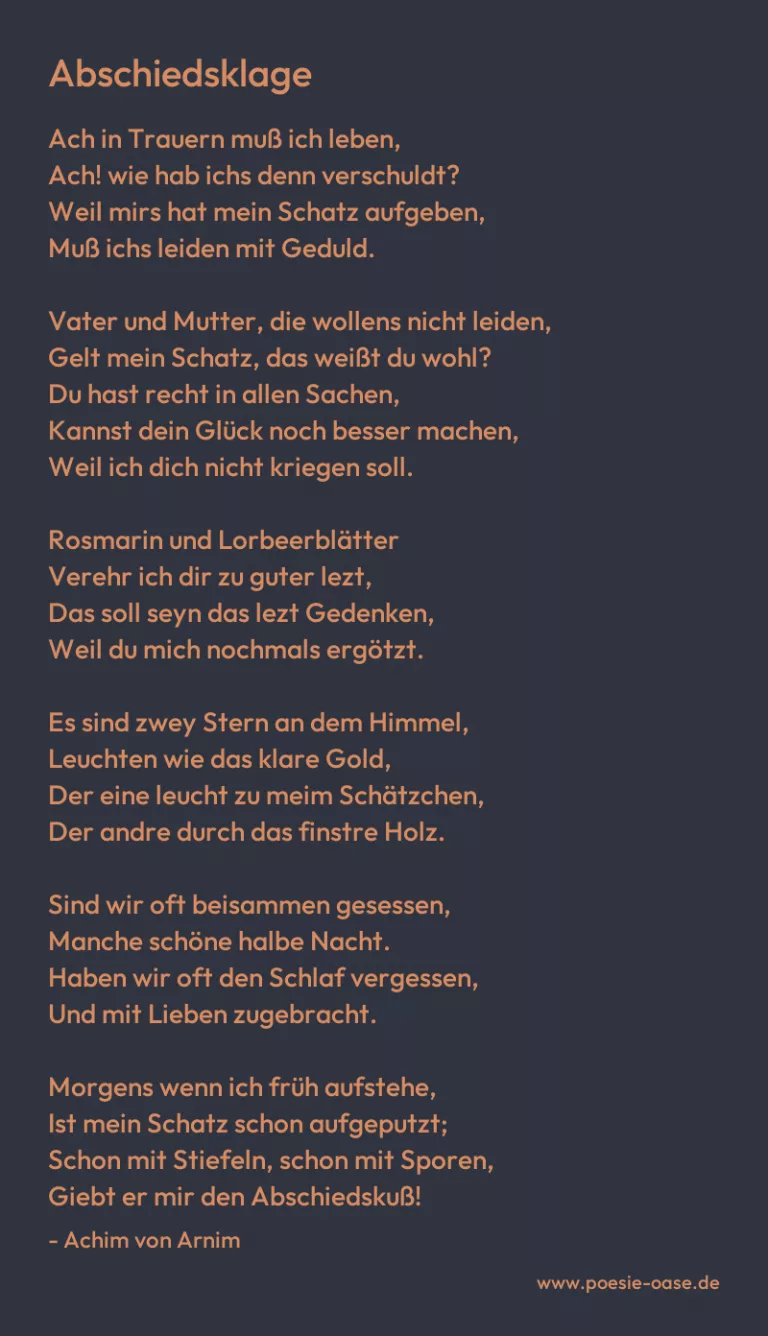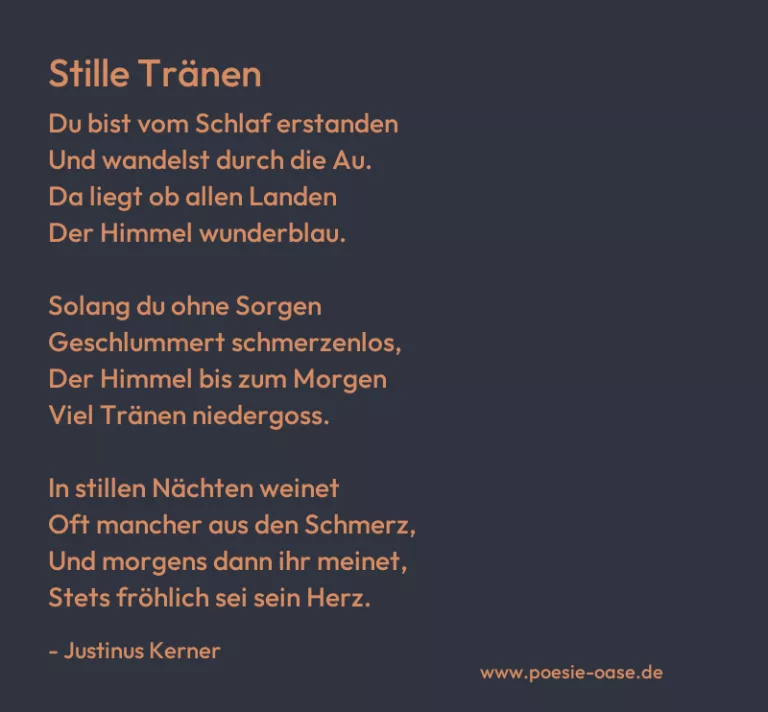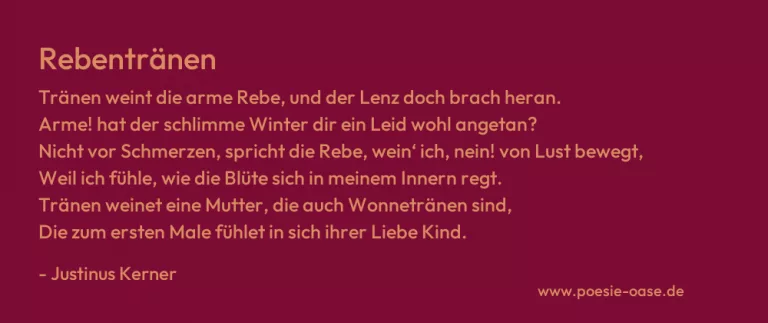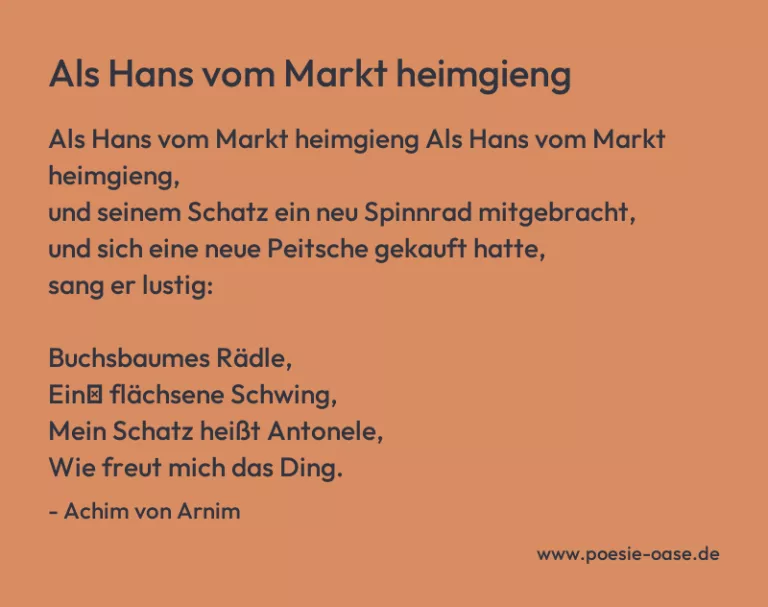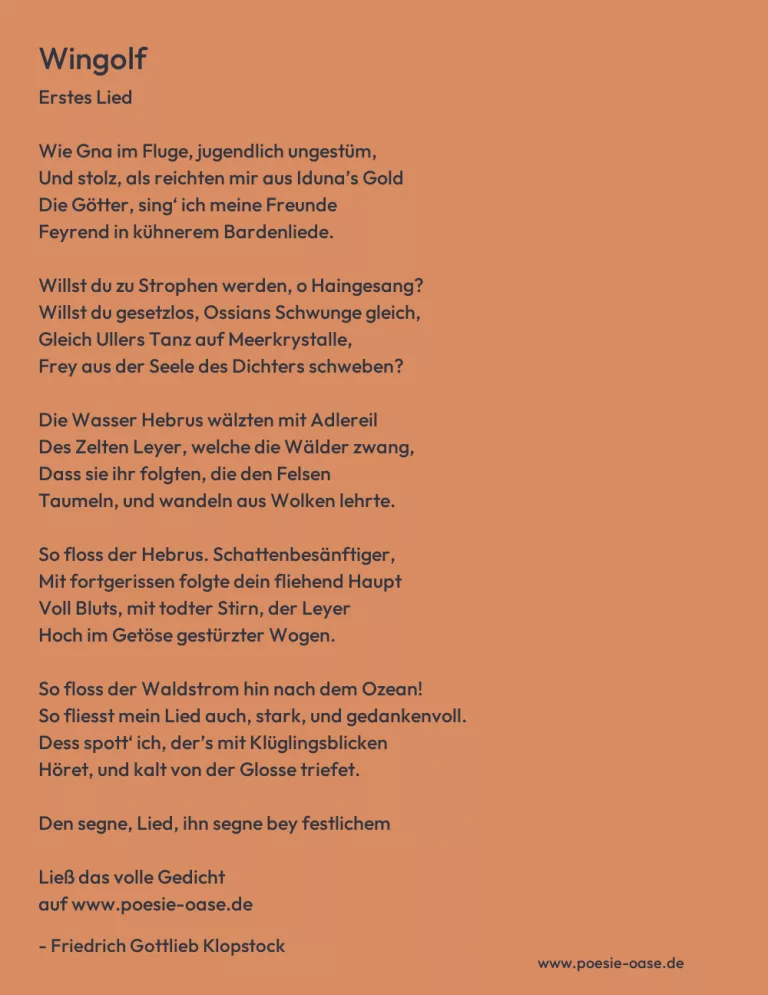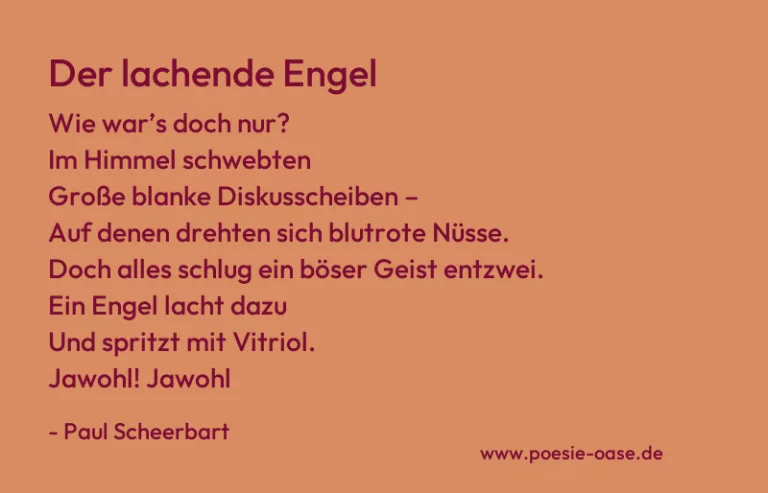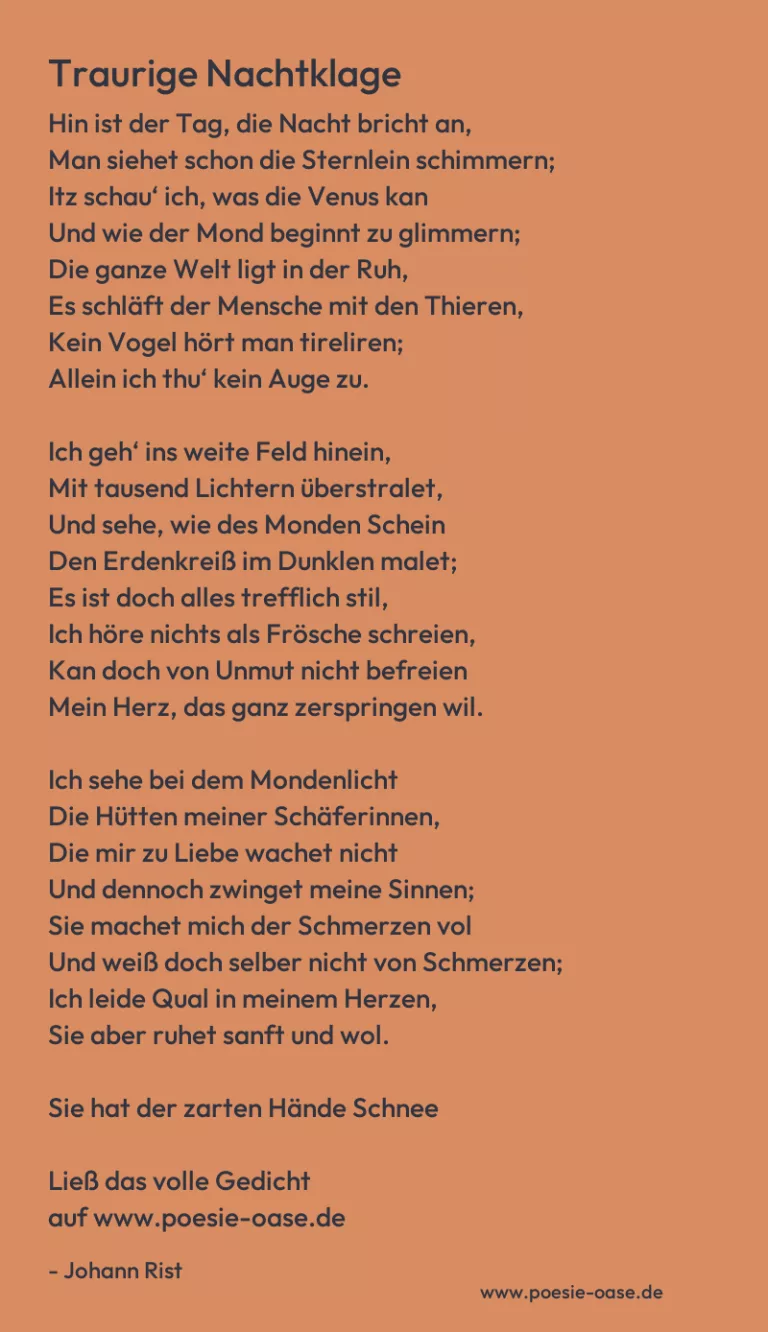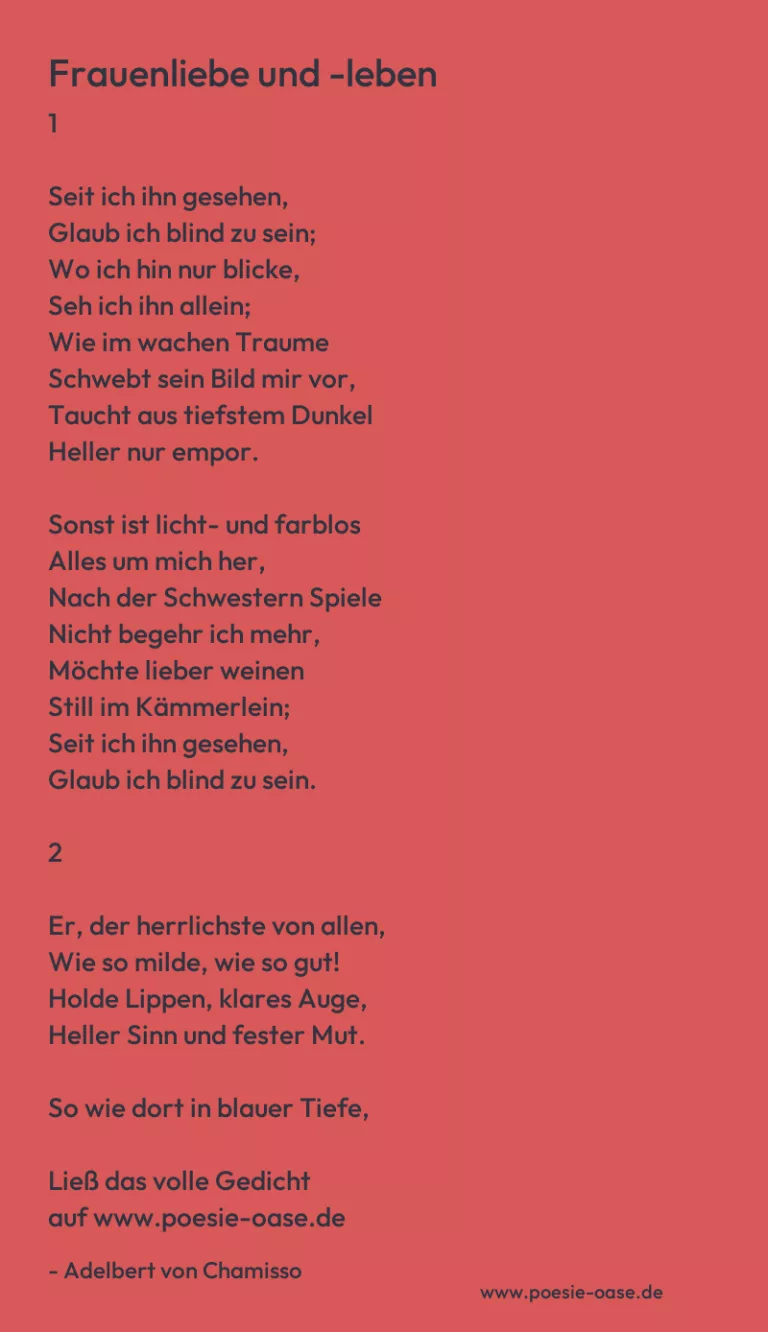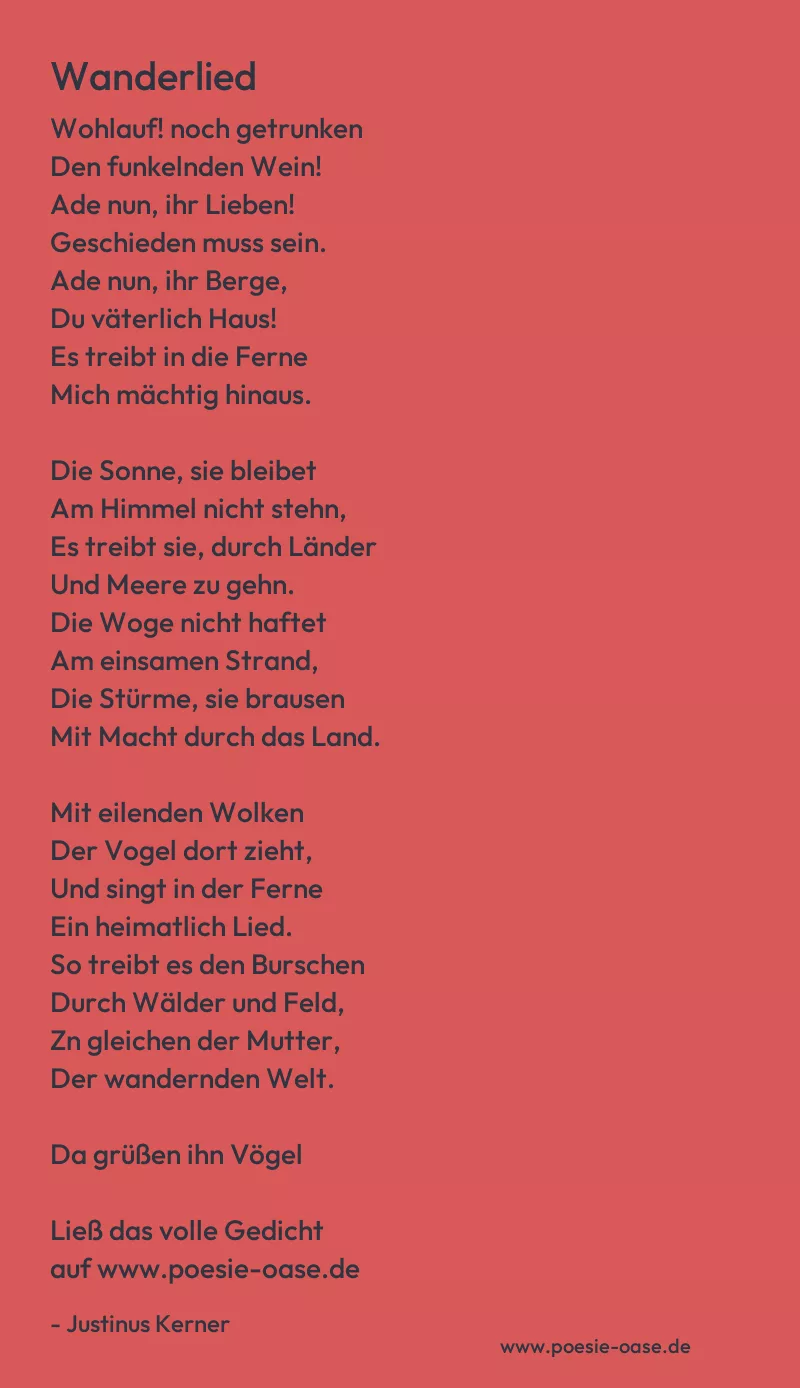Wanderlied
Wohlauf! noch getrunken
Den funkelnden Wein!
Ade nun, ihr Lieben!
Geschieden muss sein.
Ade nun, ihr Berge,
Du väterlich Haus!
Es treibt in die Ferne
Mich mächtig hinaus.
Die Sonne, sie bleibet
Am Himmel nicht stehn,
Es treibt sie, durch Länder
Und Meere zu gehn.
Die Woge nicht haftet
Am einsamen Strand,
Die Stürme, sie brausen
Mit Macht durch das Land.
Mit eilenden Wolken
Der Vogel dort zieht,
Und singt in der Ferne
Ein heimatlich Lied.
So treibt es den Burschen
Durch Wälder und Feld,
Zn gleichen der Mutter,
Der wandernden Welt.
Da grüßen ihn Vögel
Bekannt überm Meer,
Sie flogen von Fluren
Der Heimat hieher;
Da duften die Blumen
Vertraulich um ihn,
Sie trieben vom Lande
Die Lüfte dahin.
Die Vögel, die kennen
Sein väterlich Haus,
Die Blumen einst pflanzt‘ er
Der Liebe zum Strauß,
Und Liebe, die folgt ihm,
Sie geht ihm zur Hand:
So wird ihm zur Heimat
Das ferneste Land.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
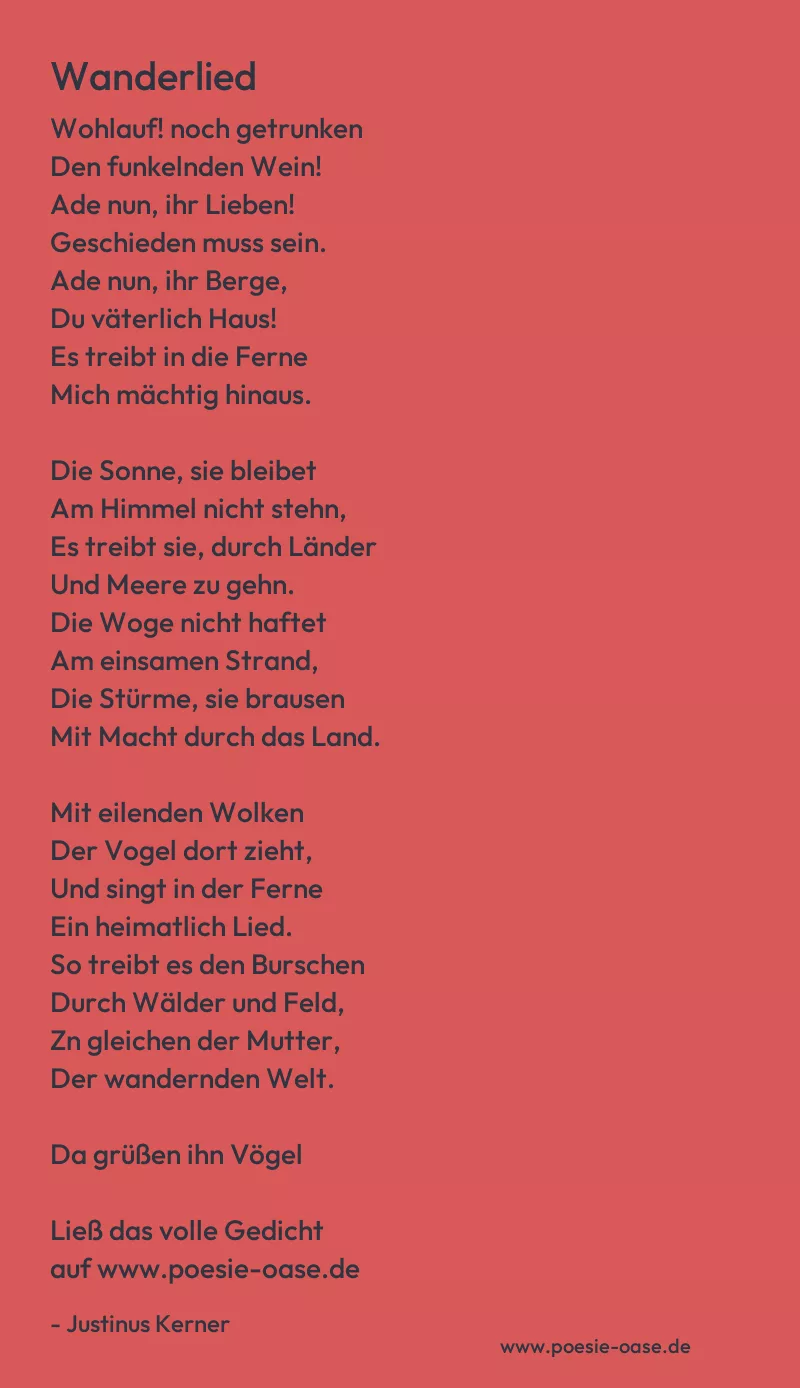
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wanderlied“ von Justinus Kerner schildert in romantisch-bewegter Sprache das Bild des wandernden Menschen, der sich von Heimat, Haus und Geliebten löst, um sich dem Ruf der weiten Welt hinzugeben. Es ist ein klassisches Wanderlied der Romantik, das Naturbeobachtung, Lebensphilosophie und emotionale Tiefe miteinander verbindet. Der wandernde Bursche wird dabei zu einer Symbolfigur des inneren Drangs nach Freiheit, Entwicklung und Zugehörigkeit zur Natur.
Bereits in der ersten Strophe beginnt die Bewegung: Mit dem Trinkspruch auf den „funkelnden Wein“ verabschiedet sich das lyrische Ich von den „Lieben“ und der Heimat. Es ist ein Abschied, der nicht ohne Wehmut geschieht, aber von einem mächtigen inneren Antrieb getragen wird – „es treibt in die Ferne / Mich mächtig hinaus“. Dieser Drang zur Bewegung wird im gesamten Gedicht als etwas Natürliches und Unvermeidbares dargestellt.
Kerner stellt diesen Impuls in Verbindung mit den großen Bewegungen der Natur: Die Sonne bleibt nicht stehen, die Woge haftet nicht am Ufer, die Stürme brausen unaufhaltsam. So wird das Wandern nicht nur zur Lebensentscheidung des Einzelnen, sondern zur Teilhabe an einem größeren, kosmischen Rhythmus. Der Mensch steht nicht außerhalb der Natur, sondern in ihrer Bewegung – er folgt, wie die Sonne und der Vogel, einem natürlichen Gesetz.
In den folgenden Strophen wird das scheinbar Fremde durch die Erinnerung an die Heimat durchwirkt: Vögel und Düfte begleiten den Wanderer, als kämen sie von „Fluren der Heimat“. Die Natur wird so zur Trägerin von Erinnerung und Vertrautheit. Selbst in der Ferne fühlt sich das lyrische Ich nicht allein – es erkennt Spuren des Vertrauten wieder, sei es in Blumen, die einst verschenkt wurden, oder in Gesängen der Vögel.
Die letzte Strophe bringt die zentrale Botschaft des Gedichts auf den Punkt: Die Liebe folgt dem Wanderer, sie ist die bleibende Kraft, die ihn begleitet und die Ferne zur Heimat macht. In diesem Gedanken liegt eine tiefe romantische Hoffnung: dass der Mensch nicht nur unterwegs ist, sondern überall, wo Liebe und Erinnerung ihn begleiten, ein Zuhause finden kann. Damit wird „Wanderlied“ zu einer Hymne auf das Unterwegssein – nicht als Verlust, sondern als schöpferische Verbindung zwischen innerer Freiheit, Natur und Gefühl.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.