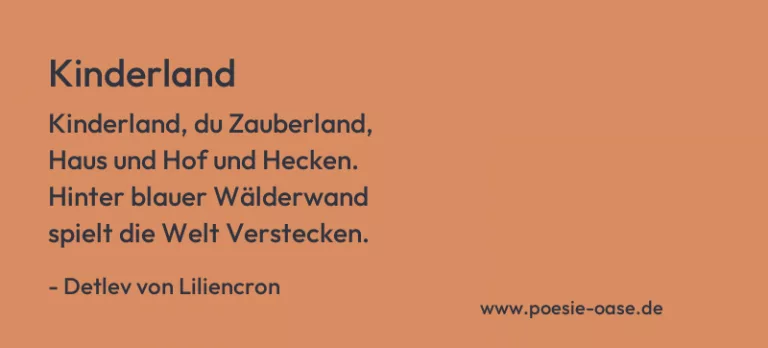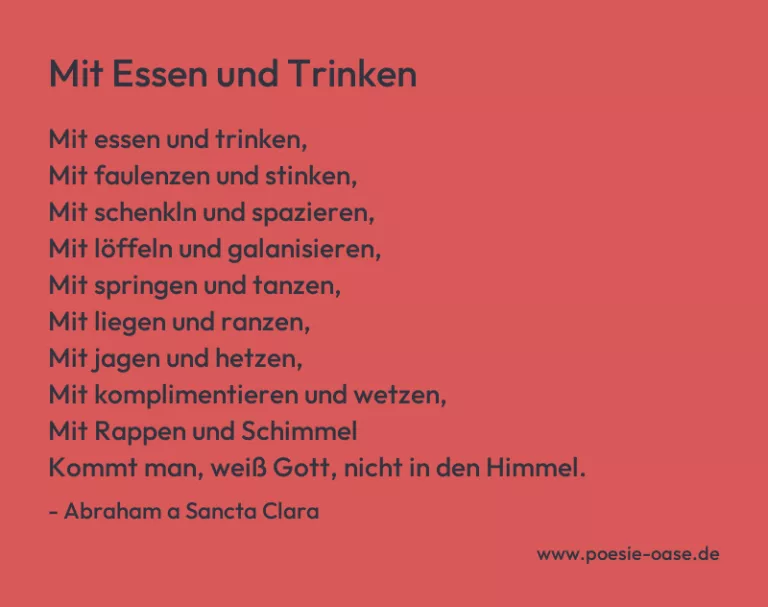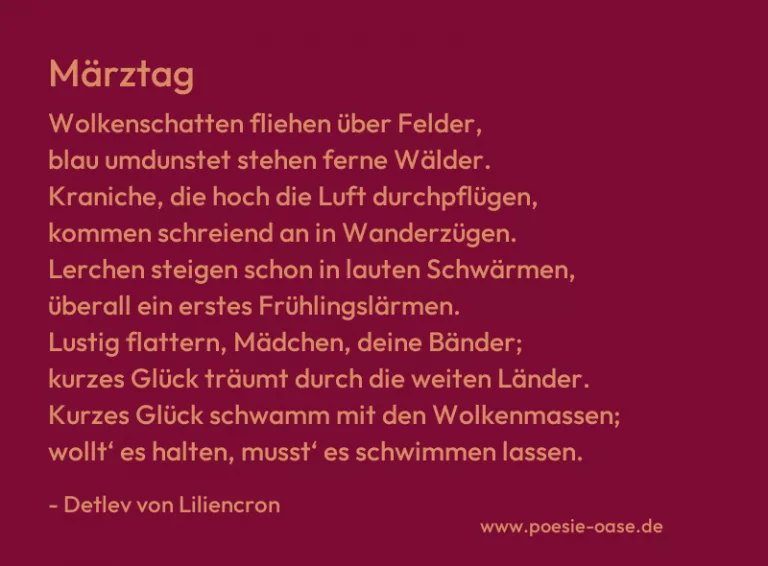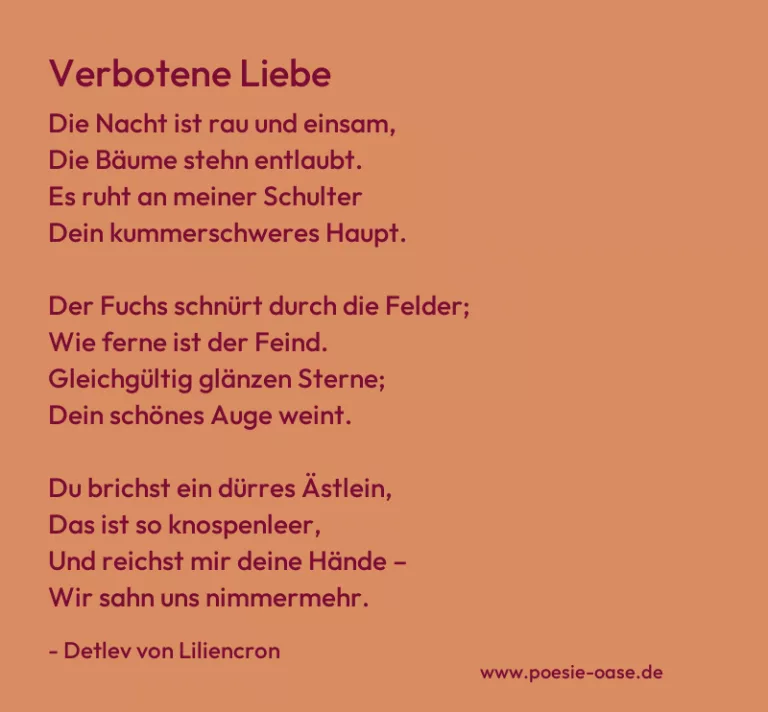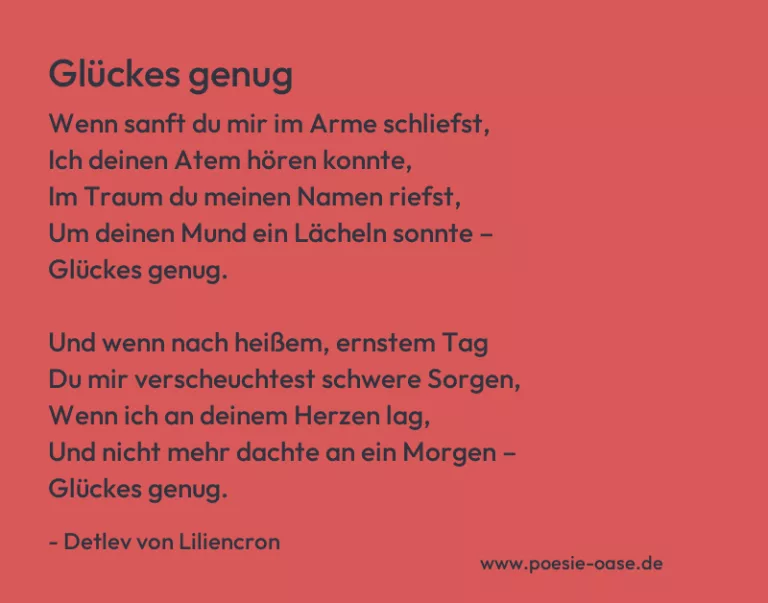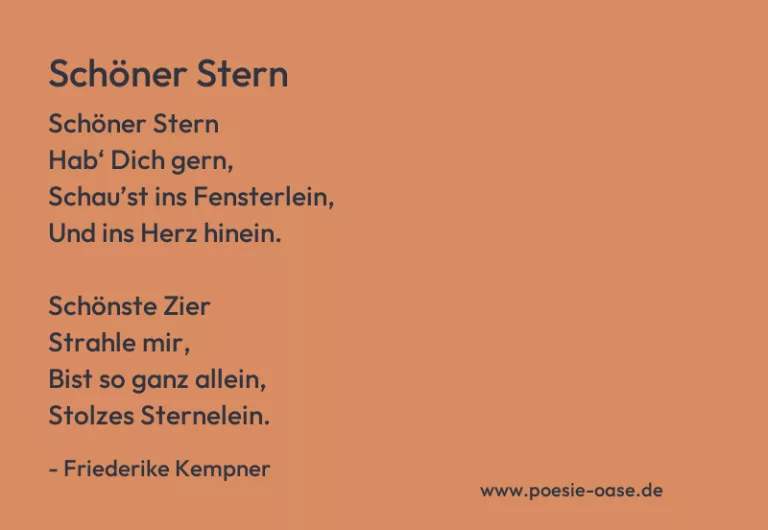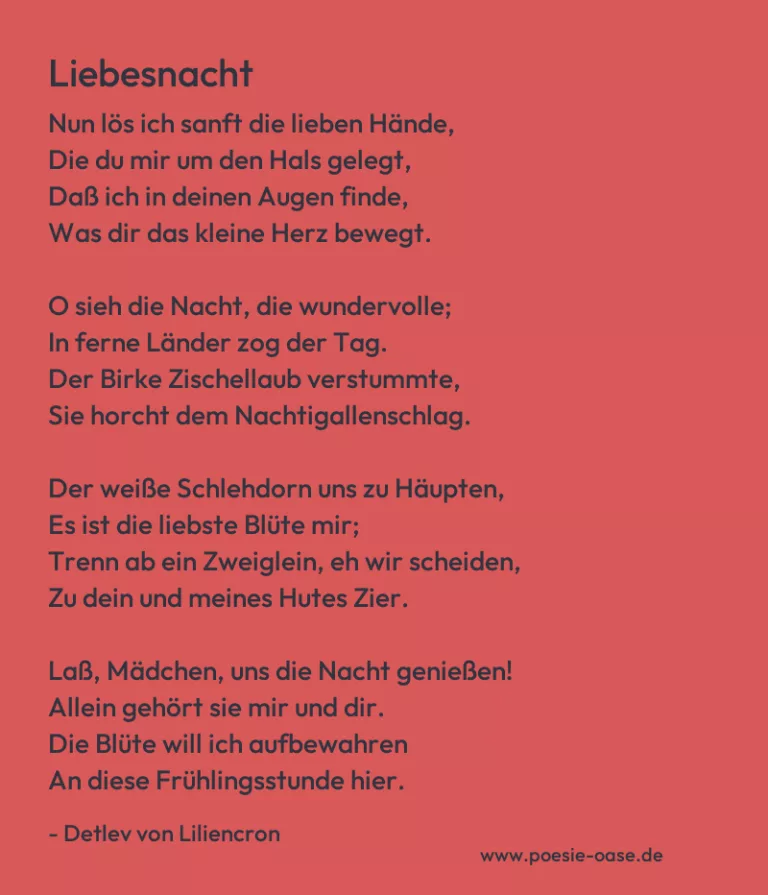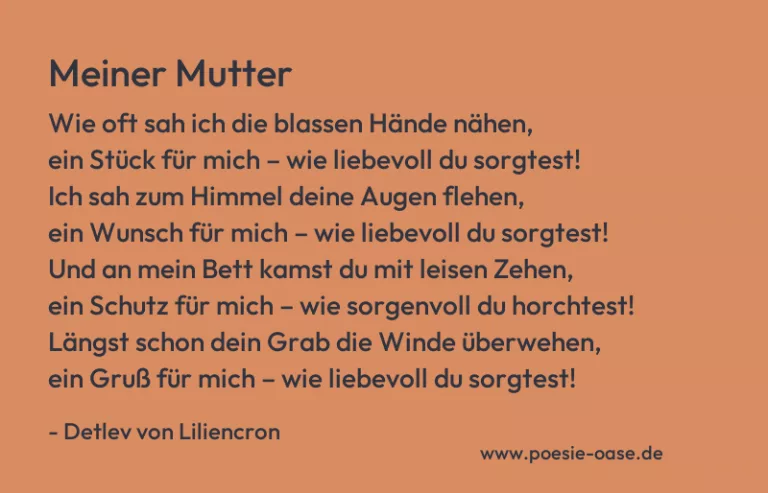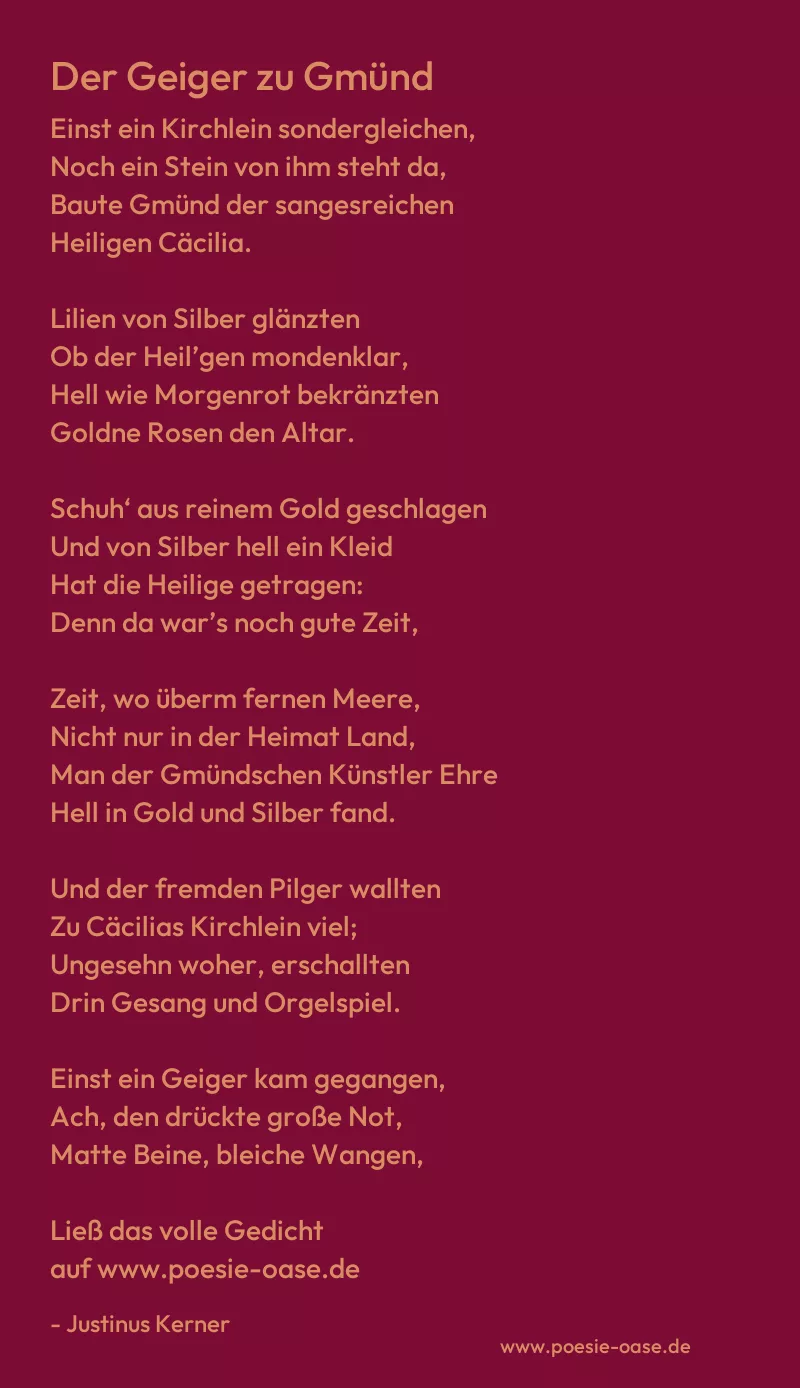Einst ein Kirchlein sondergleichen,
Noch ein Stein von ihm steht da,
Baute Gmünd der sangesreichen
Heiligen Cäcilia.
Lilien von Silber glänzten
Ob der Heil’gen mondenklar,
Hell wie Morgenrot bekränzten
Goldne Rosen den Altar.
Schuh‘ aus reinem Gold geschlagen
Und von Silber hell ein Kleid
Hat die Heilige getragen:
Denn da war’s noch gute Zeit,
Zeit, wo überm fernen Meere,
Nicht nur in der Heimat Land,
Man der Gmündschen Künstler Ehre
Hell in Gold und Silber fand.
Und der fremden Pilger wallten
Zu Cäcilias Kirchlein viel;
Ungesehn woher, erschallten
Drin Gesang und Orgelspiel.
Einst ein Geiger kam gegangen,
Ach, den drückte große Not,
Matte Beine, bleiche Wangen,
Und im Sack kein Geld, kein Brot.
Vor dem Bild hat er gesungen
Und gespielet all sein Leid,
Hat der Heil’gen Herz durchdrungen:
Horch! melodisch rauscht ihr Kleid!
Lächelnd bückt das Bild sich nieder
Aus der lebenlosen Ruh‘,
Wirft dem armen Sohn der Lieder
Hin den rechten goldnen Schuh.
Nach des nächsten Goldschmieds Hause
Eilt er, ganz vom Glück berauscht,
Singt und träumt vom besten Schmause,
Wenn der Schuh um Geld vertauscht.
Aber kaum den Schuh ersehen,
Führt der Goldschmied rauen Ton,
Und zum Richter wird mit Schmähen
Wild geschleppt des Liedes Sohn.
Bald ist der Prozess geschlichtet,
Allen ist es offenbar,
Dass das Wunder nur erdichtet,
Er der frechste Räuber war.
Weh! du armer Sohn der Lieder
Sangest wohl den letzten Sang!
An dem Galgen auf und nieder
Sollst, ein Vogel, fliegen bang.
Hell ein Glöcklein hört man schallen,
Und man sieht den schwarzen Zug
Mit dir zu der Stätte wallen,
Wo beginnen soll dein Flug.
Bußgesänge hört man singen,
Nonnen und der Mönche Chor,
Aber hell auch hört man dringen
Geigentöne draus hervor.
Seine Geige mitzuführen,
War des Geigers letzte Bitt‘.
„Wo so viele musizieren,
Musizier‘ ich Geiger mit!“
An Cäcilias Kapelle
Jetzt der Zug vorüberkam,
Nach des offnen Kirchleins Schwelle
Geigt er recht in tiefem Gram.
Und wer kurz ihn noch gehasset,
Seufzt: „Das arme Geigerlein“ –
„Eins noch bitt‘ ich,“ – singt er, „lasset
Mich zur Heil’gen noch hinein!“
Man gewährt ihm; vor dem Bilde
Geigt er abermals sein Leid,
Und er rührt die Himmlischmilde:
Horch! melodisch rauscht ihr Kleid!
Lächelnd bückt das Bild sich nieder
Aus der lebenlosen Ruh‘,
Wirft dem armen Sohn der Lieder
Hin den zweiten goldnen Schuh.
Voll Erstaunen steht die Menge,
Und es sieht nun jeder Christ,
Wie der Mann der Volksgesänge
Selbst der Heil’gen teuer ist.
Schön geschmückt mit Bändern, Kränzen,
Wohl gestärkt mit Geld und Wein,
Führen sie zu Sang und Tänzen
In das Rathaus ihn hinein.