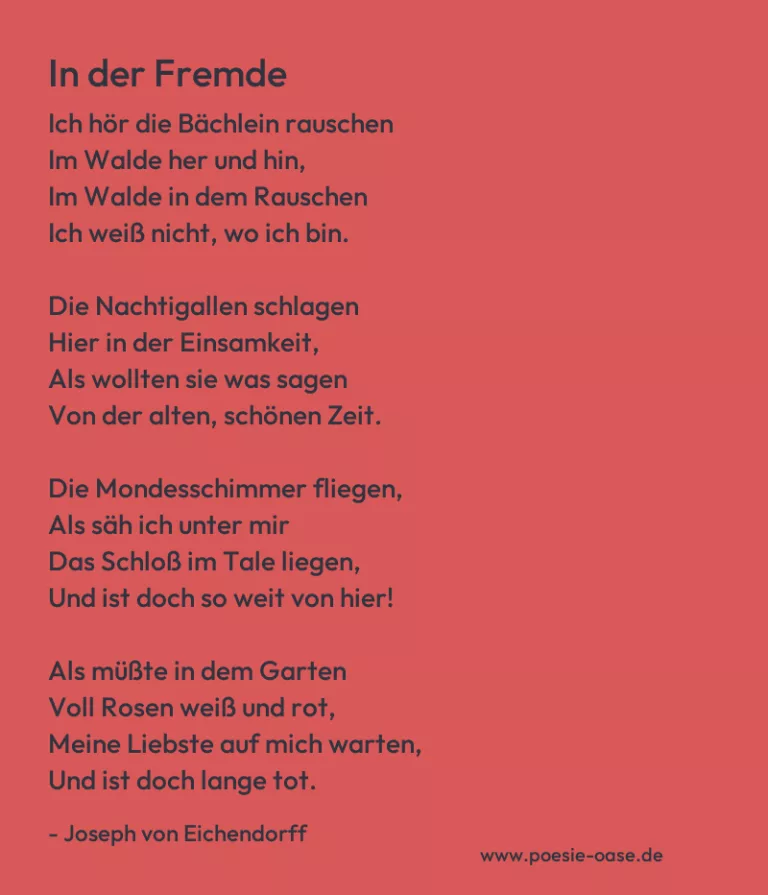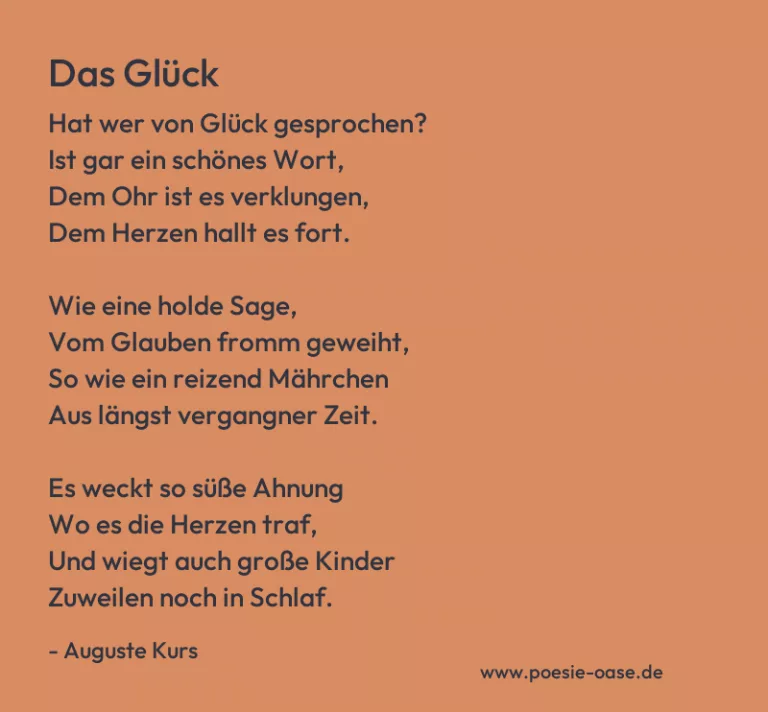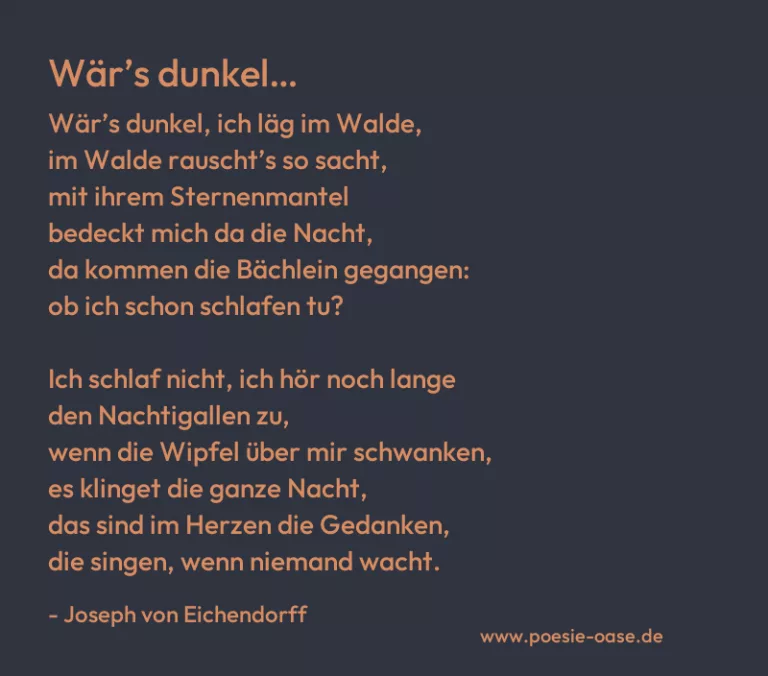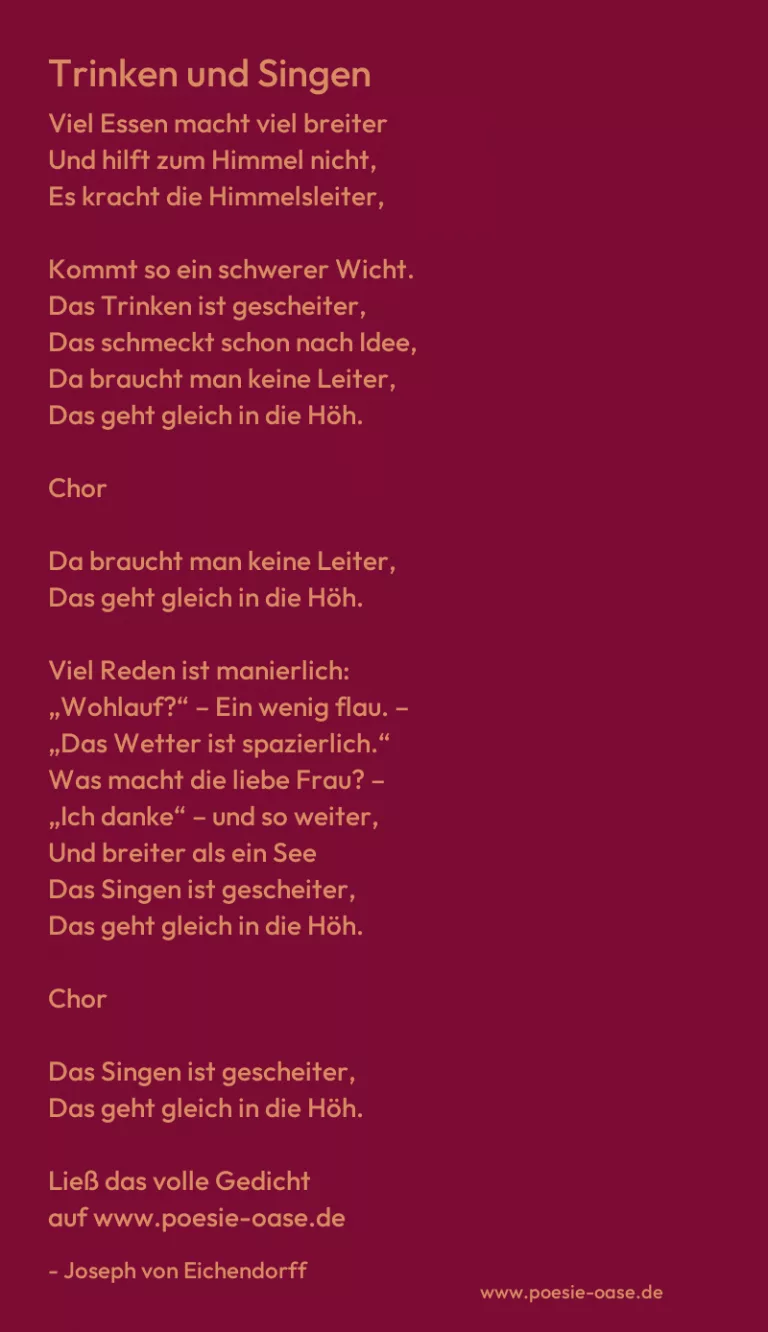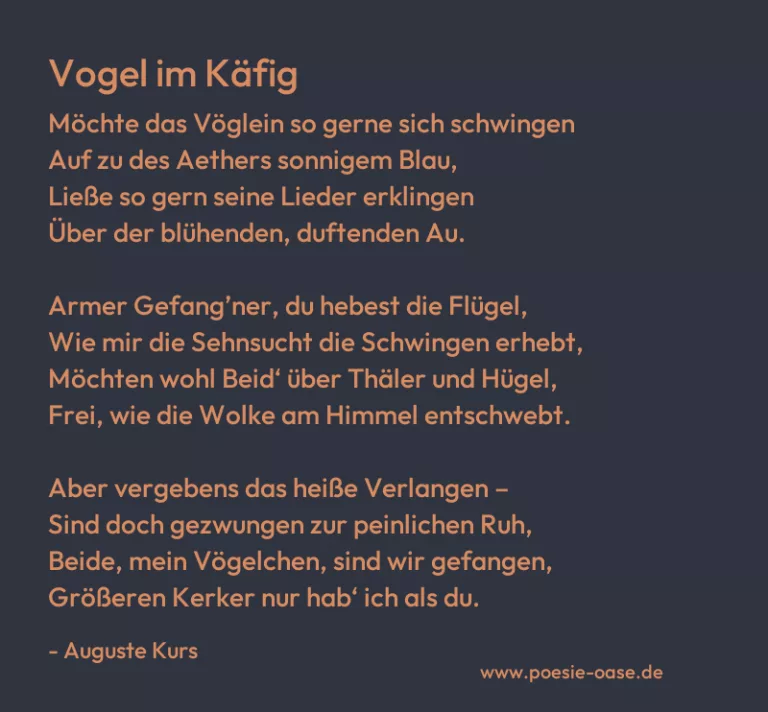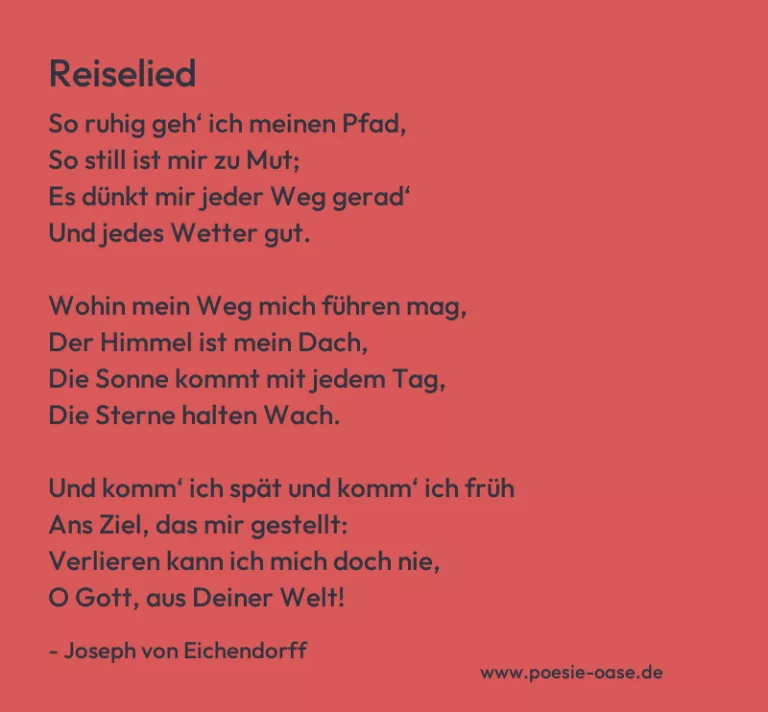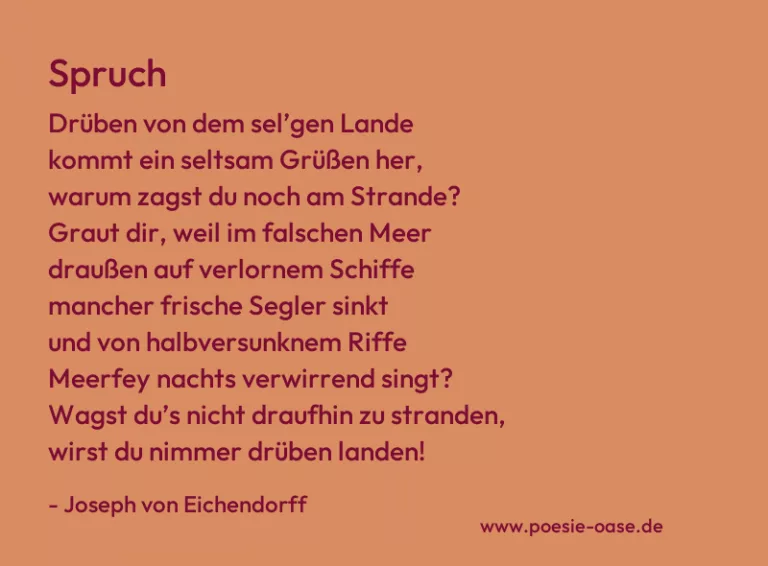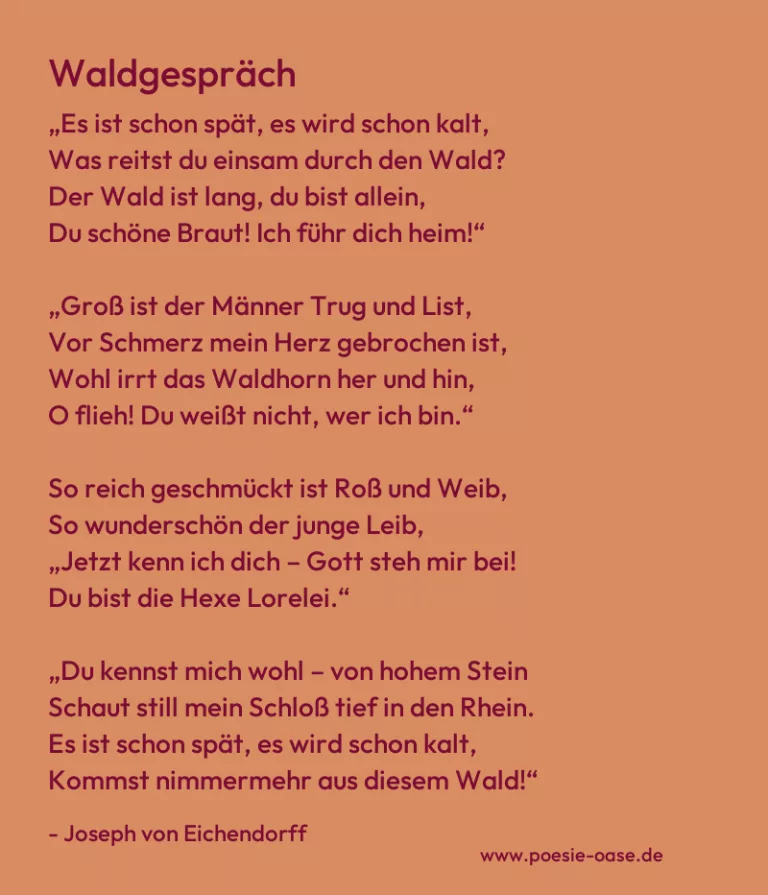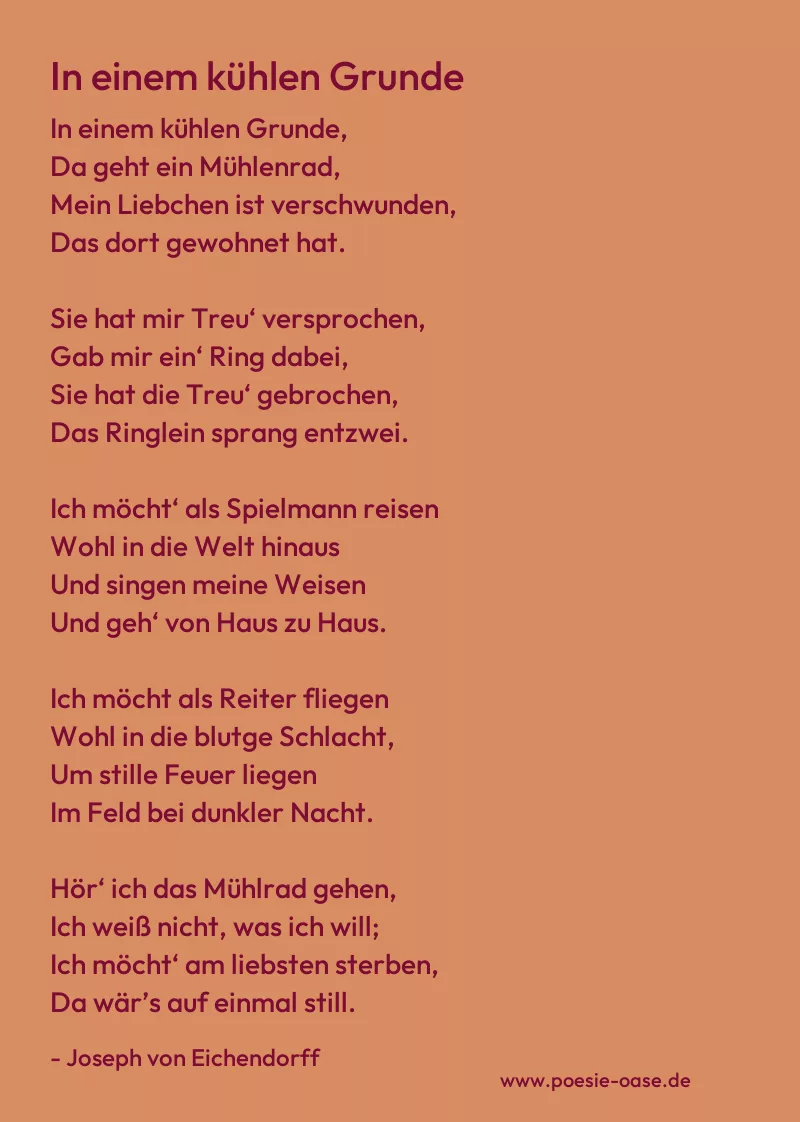In einem kühlen Grunde
In einem kühlen Grunde,
Da geht ein Mühlenrad,
Mein Liebchen ist verschwunden,
Das dort gewohnet hat.
Sie hat mir Treu‘ versprochen,
Gab mir ein‘ Ring dabei,
Sie hat die Treu‘ gebrochen,
Das Ringlein sprang entzwei.
Ich möcht‘ als Spielmann reisen
Wohl in die Welt hinaus
Und singen meine Weisen
Und geh‘ von Haus zu Haus.
Ich möcht als Reiter fliegen
Wohl in die blutge Schlacht,
Um stille Feuer liegen
Im Feld bei dunkler Nacht.
Hör‘ ich das Mühlrad gehen,
Ich weiß nicht, was ich will;
Ich möcht‘ am liebsten sterben,
Da wär’s auf einmal still.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
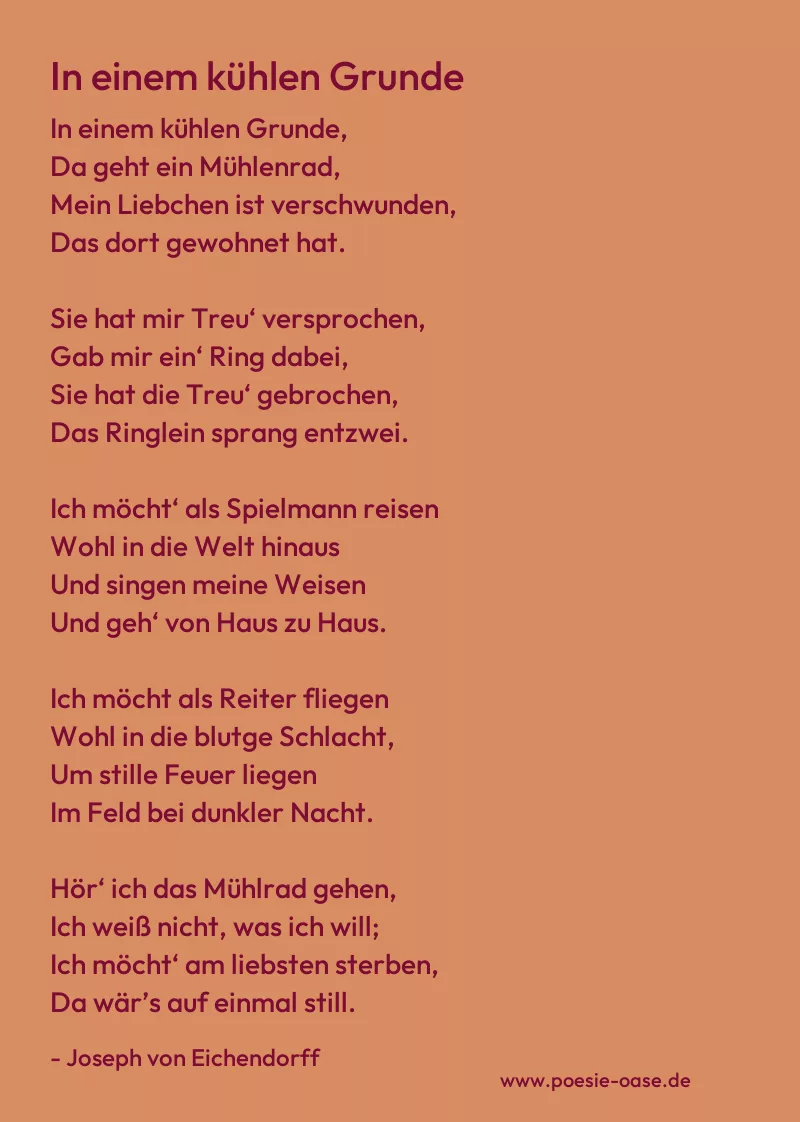
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „In einem kühlen Grunde“ von Joseph von Eichendorff erzählt von der tiefen Enttäuschung und Verzweiflung eines Liebenden, dessen Vertrauen von seiner Geliebten betrogen wurde. Zu Beginn wird eine ruhige, idyllische Landschaft beschrieben, in der ein „Mühlenrad“ im „kühlen Grunde“ dahin dreht. Diese Bildwelt steht für eine vergangene Zeit des Friedens und der Geborgenheit, die nun von der Abwesenheit des „Liebchens“ überschattet wird. Die geliebte Person hat das Versprechen der Treue gebrochen, und der „Ring“, der als Symbol dieser Treue galt, zerbrach, was das Ende einer Verbindung markiert und den Sprecher mit Trauer und Verlust zurücklässt.
Der zweite Teil des Gedichts offenbart die Reaktion des Sprechers auf diesen Verlust. Zunächst träumt er davon, als „Spielmann“ durch die Welt zu reisen und mit seinen „Weisen“ von Haus zu Haus zu gehen. Dieser Gedanke symbolisiert das Bedürfnis nach Flucht und Ablenkung, weg von der schmerzhaften Erinnerung an die zerbrochene Liebe. Doch der Gedanke an das Reisen allein bietet keine wirkliche Heilung; der Sprecher denkt weiter an andere, dramatischere Wege der Ablenkung und des Entkommens. Der Wunsch, als „Reiter“ in die „blutge Schlacht“ zu ziehen, steht für den Wunsch nach einer existenziellen Auseinandersetzung, die den Schmerz des Herzens möglicherweise durch körperliche Gefahr oder Selbstaufopferung vertreiben könnte.
In der letzten Strophe offenbart sich die Verwirrung und innere Zerrissenheit des Sprechers. Das stetige „Gehen des Mühlrads“ erinnert ihn an die vergangene Zeit und weckt eine unbestimmte Sehnsucht in ihm. Der Wunsch nach dem „Stirbens“ am Ende zeigt eine tiefe Verzweiflung und das Gefühl der Sinnlosigkeit, das die zerbrochene Liebe in ihm hervorruft. In diesem Moment erscheint der Tod als eine Art Erlösung, ein Zustand der „Stille“, der die unerträgliche Lautlosigkeit und Leere des Verlusts beenden würde. Der Gedanke an das Mühlrad als stetig drehendes Symbol für das Leben und den Kreislauf, der nicht aufhören kann, spiegelt die Unfähigkeit des Sprechers wider, sich von seiner inneren Qual zu befreien.
Eichendorff beschreibt hier eine existenzielle Krise, in der Liebe, Verlust und Schmerz auf intensive Weise miteinander verbunden sind. Die Landschaft und die Symbole wie das Mühlrad und der Ring verstärken die Tragik des Gedichts, indem sie einen Kontrast zwischen der Schönheit der Natur und der inneren Zerrissenheit des Sprechers schaffen. Das Gedicht wird durch seinen melancholischen Ton und die tief empfundenen Emotionen zu einer kraftvollen Darstellung menschlicher Verzweiflung und des Wunsches nach innerem Frieden.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.