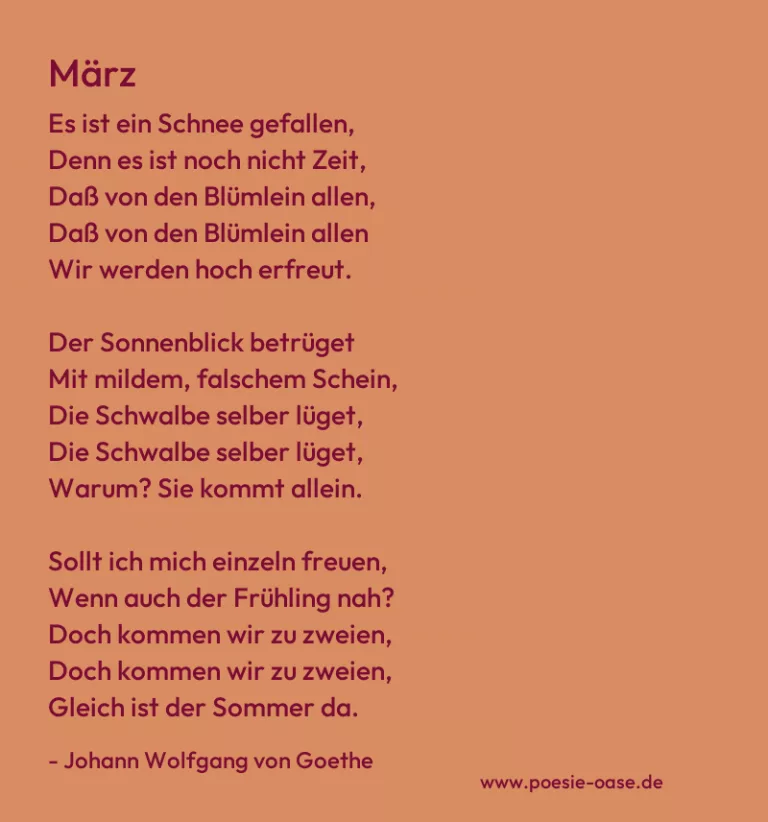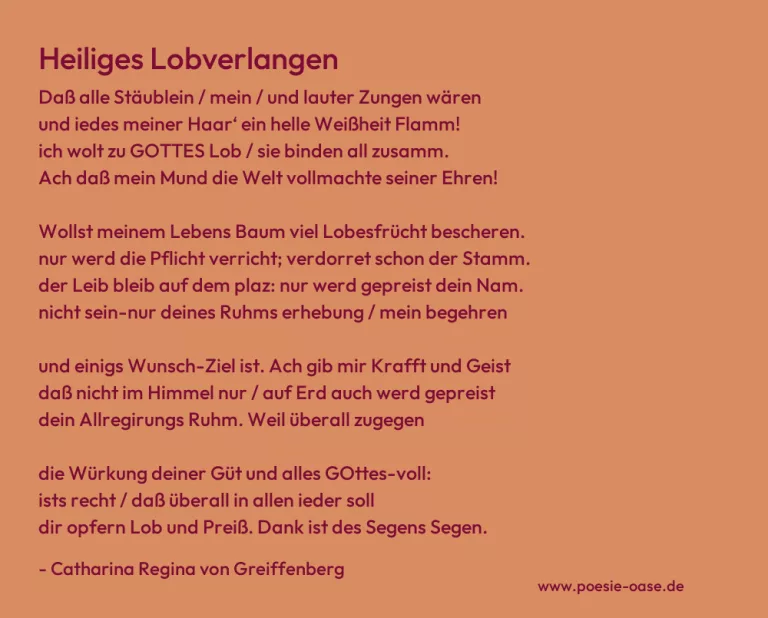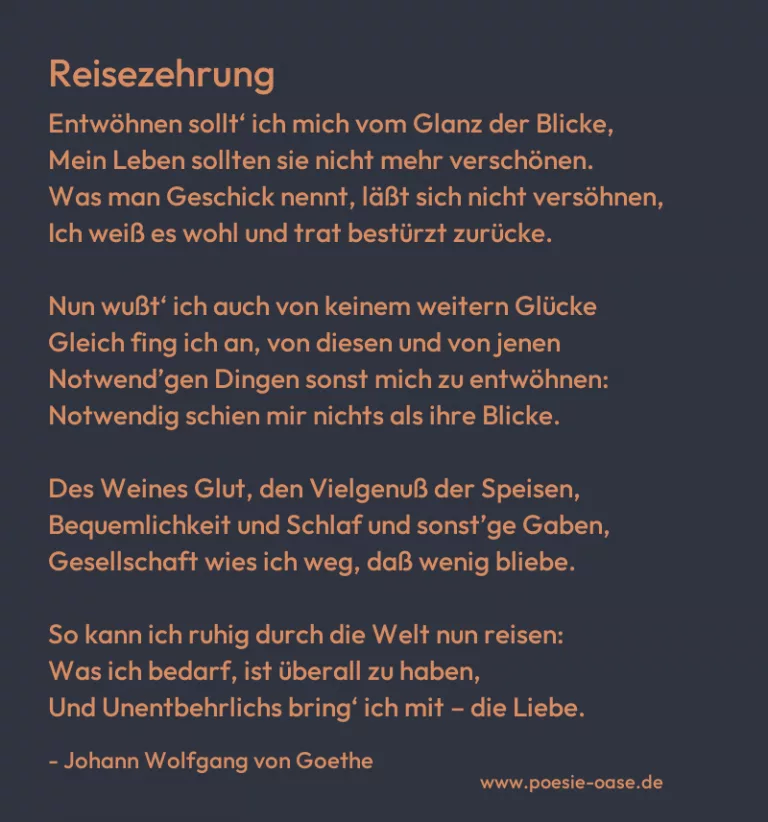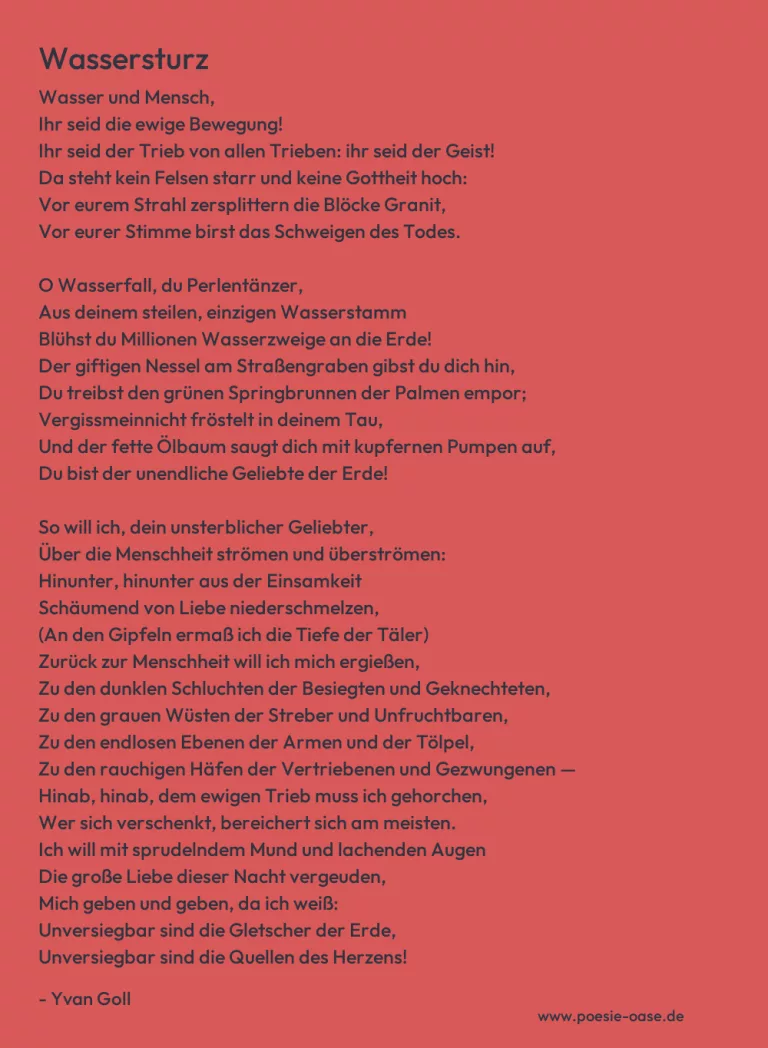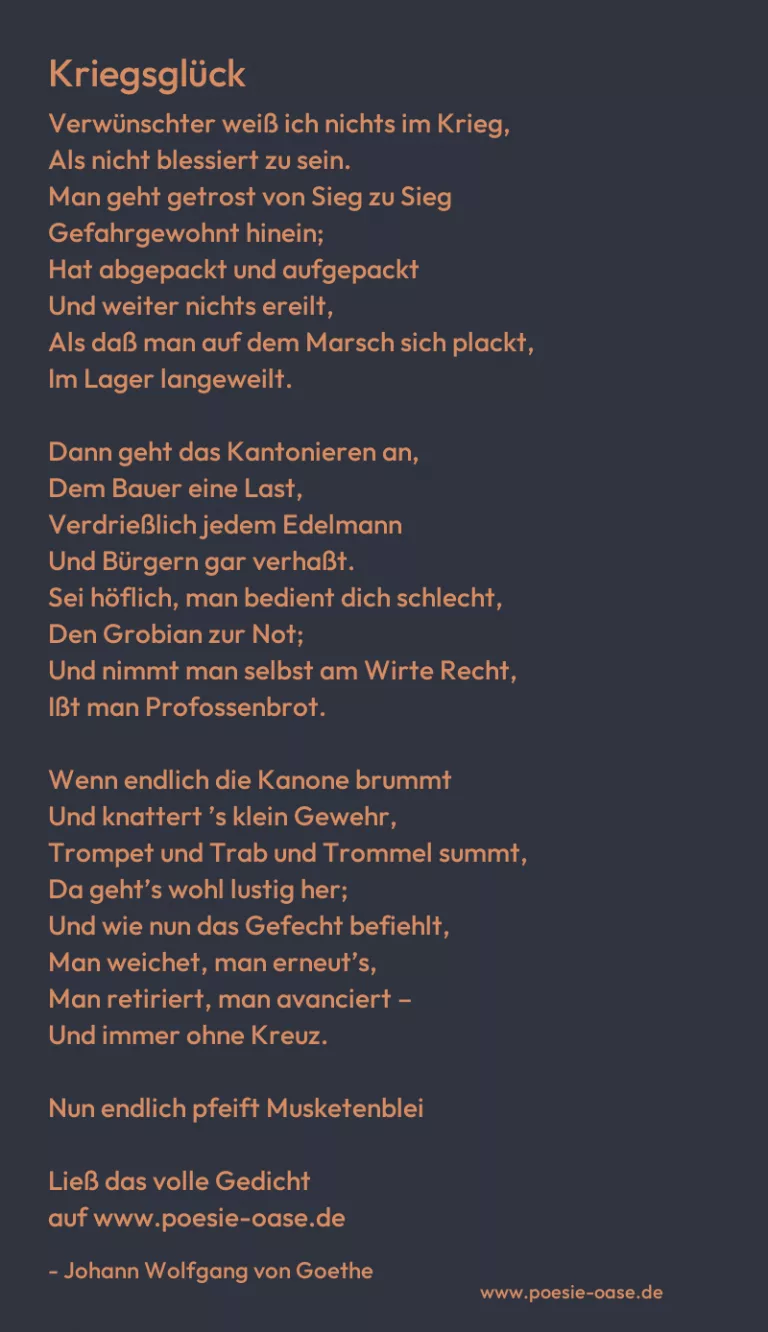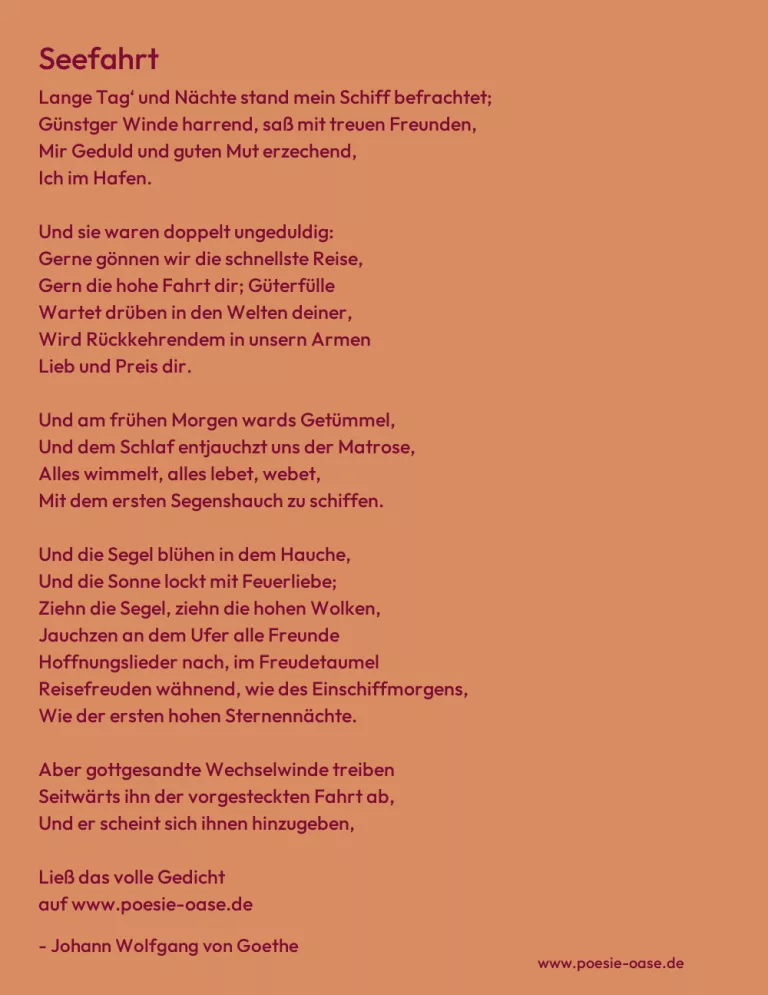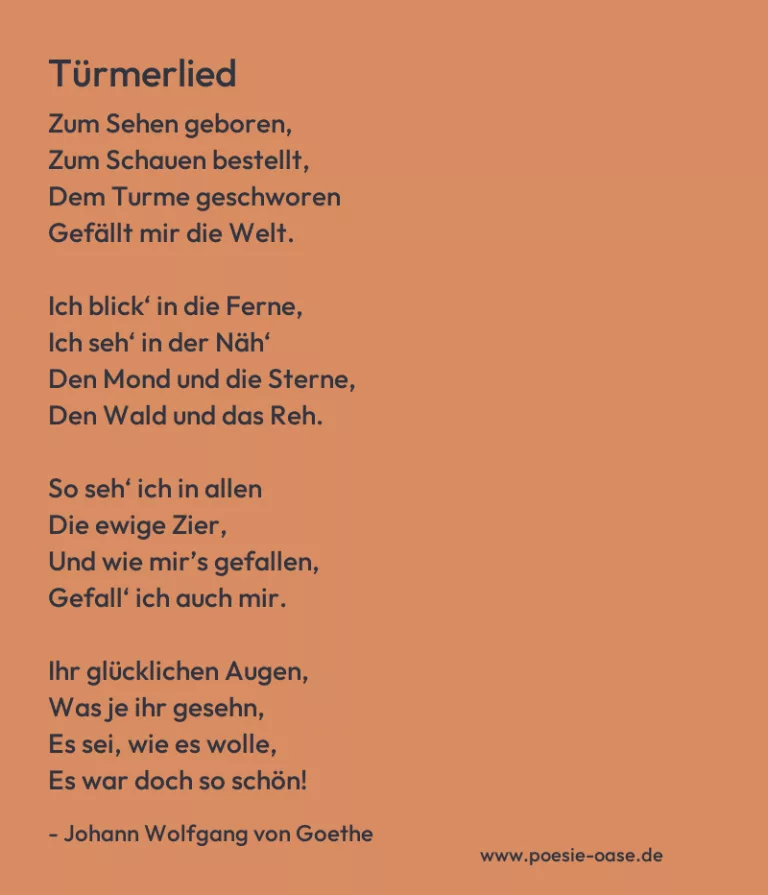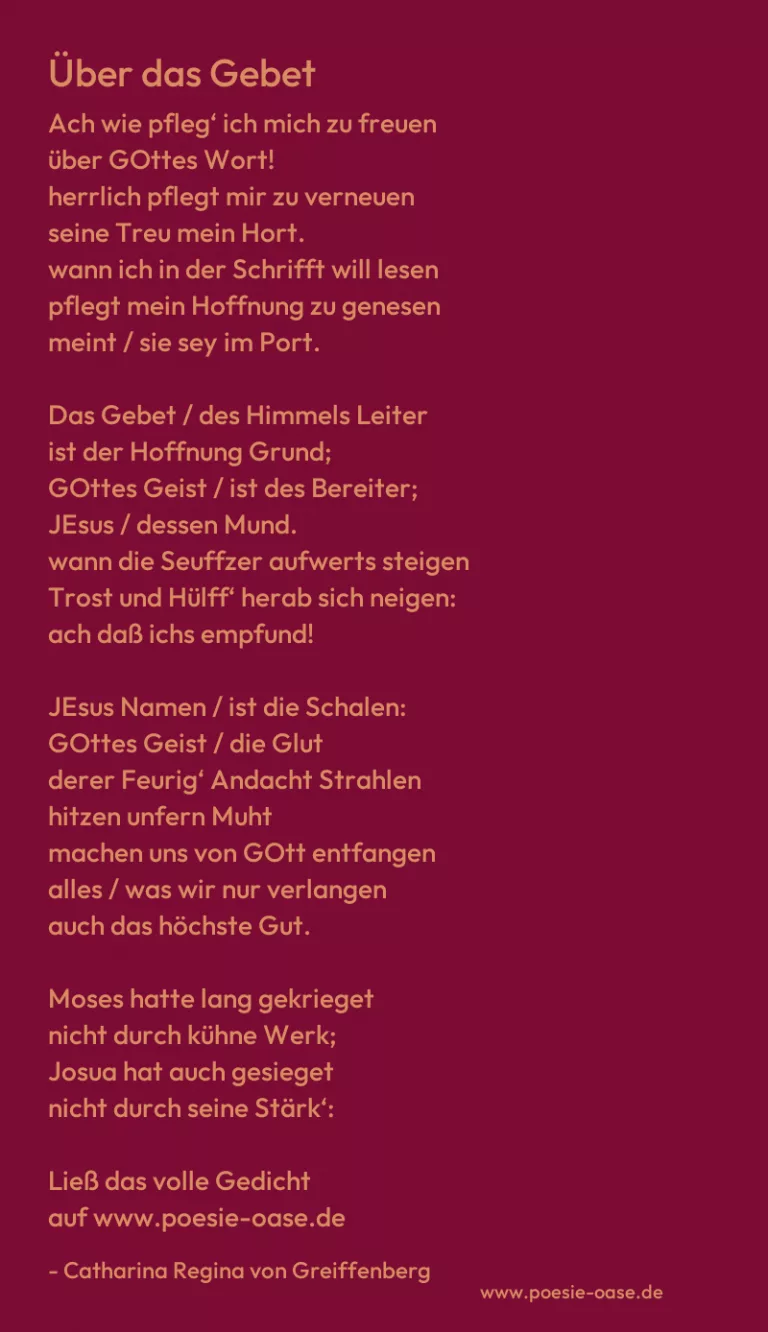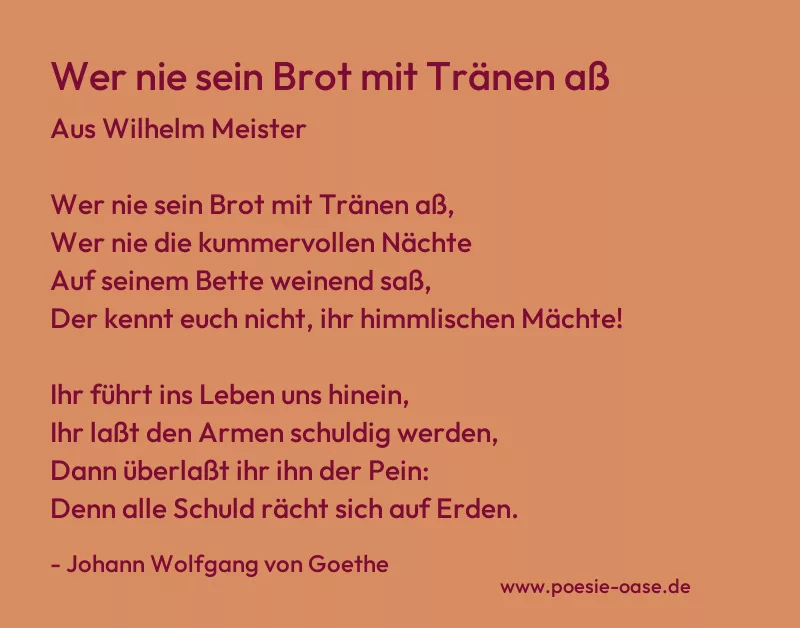Wer nie sein Brot mit Tränen aß
Aus Wilhelm Meister
Wer nie sein Brot mit Tränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte!
Ihr führt ins Leben uns hinein,
Ihr laßt den Armen schuldig werden,
Dann überlaßt ihr ihn der Pein:
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
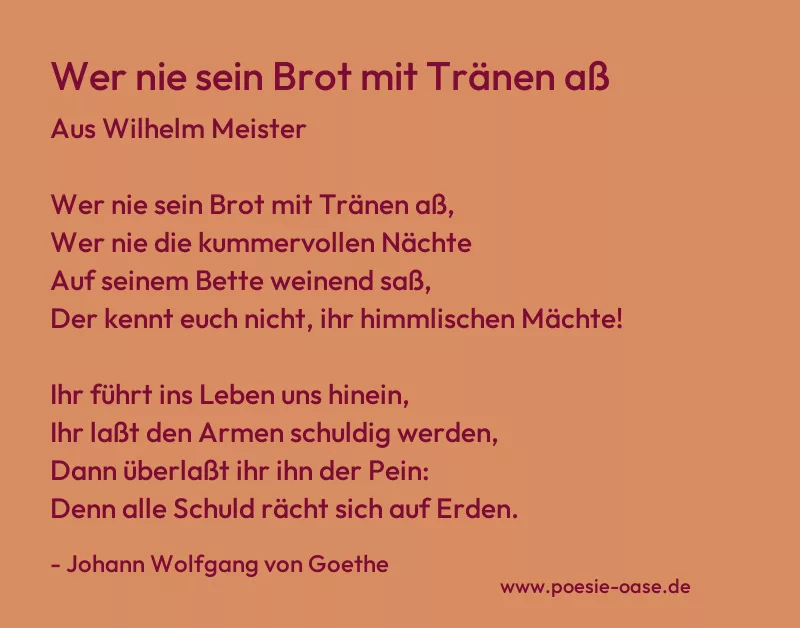
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wer nie sein Brot mit Tränen aß“ von Johann Wolfgang von Goethe thematisiert tiefes Leid und menschliche Schuld. Es stammt aus „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ und drückt die existenzielle Erfahrung von Schmerz und Reue aus. Das lyrische Ich beschreibt Kummer als eine unausweichliche Prüfung des Lebens, die nur derjenige wirklich versteht, der selbst leidvolle Nächte durchlitten hat.
In der ersten Strophe steht das Motiv der Trauer im Zentrum. Die Bilder des mit Tränen verzehrten Brotes und der schlaflosen, weinenden Nächte verdeutlichen tiefen seelischen Schmerz. Diese Erfahrung wird als Voraussetzung dargestellt, um die „himmlischen Mächte“ wirklich zu begreifen – eine Anspielung darauf, dass Leid eine tiefere Erkenntnis ermöglicht oder gar notwendig ist, um das Leben in seiner ganzen Tragweite zu verstehen.
Die zweite Strophe beschäftigt sich mit der Rolle des Schicksals. Die himmlischen Mächte bringen den Menschen ins Leben, doch sie lassen ihn in Schuld geraten und überlassen ihn dann der daraus resultierenden Pein. Die letzte Zeile betont, dass jede Schuld auf Erden ihre Konsequenzen hat, was auf eine moralische Gesetzmäßigkeit hinweist, die Leiden als unausweichliche Folge menschlicher Verfehlungen darstellt.
Insgesamt drückt das Gedicht eine bittere Weltsicht aus, in der Schmerz und Schuld untrennbar mit dem Leben verbunden sind. Es spiegelt die innere Zerrissenheit des lyrischen Ichs wider und verweist auf eine tiefe, fast schon resignierte Einsicht in die Härten der menschlichen Existenz.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.