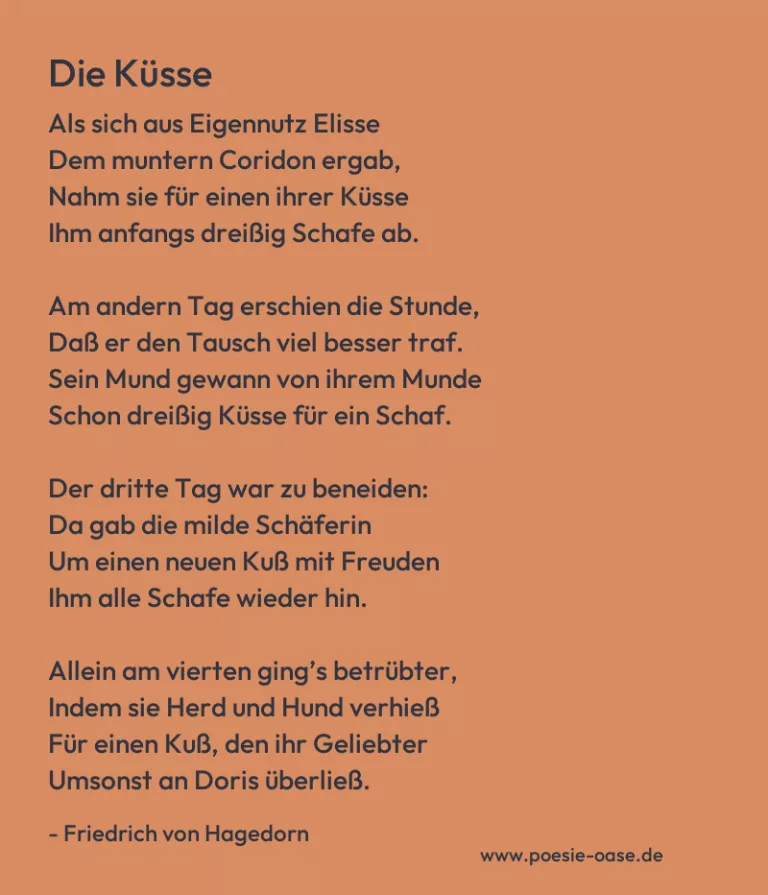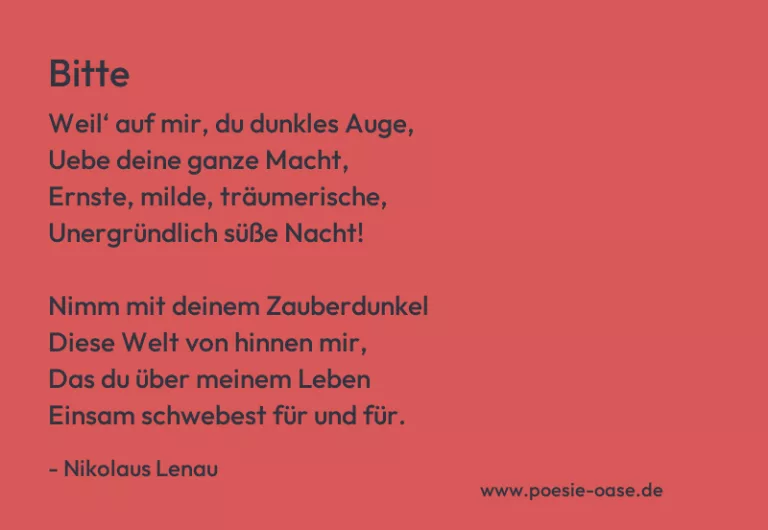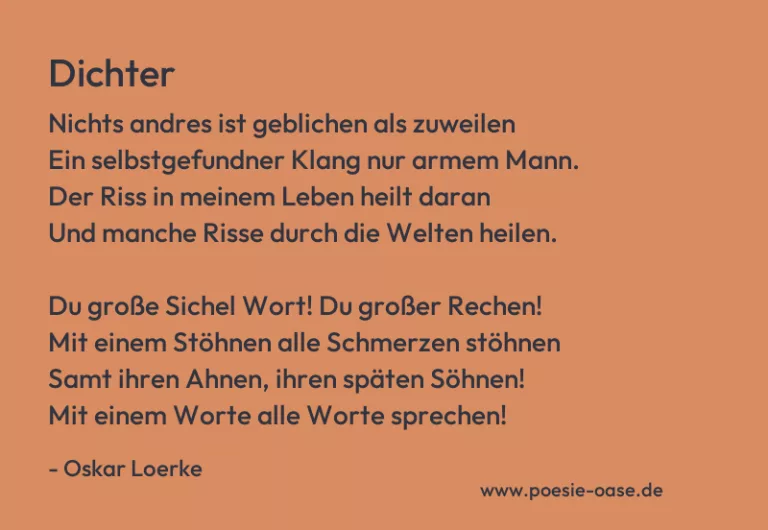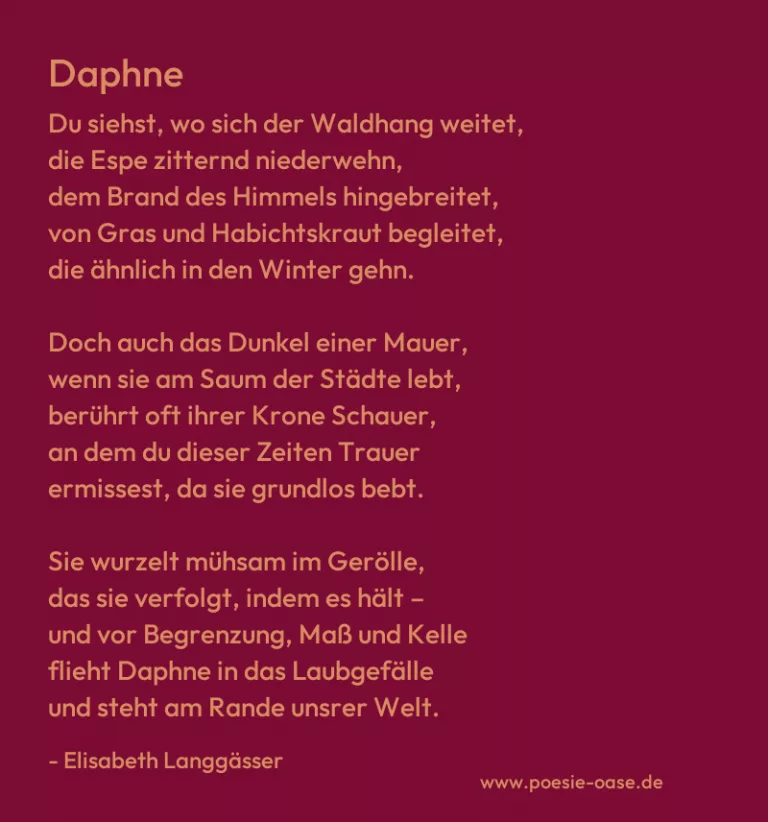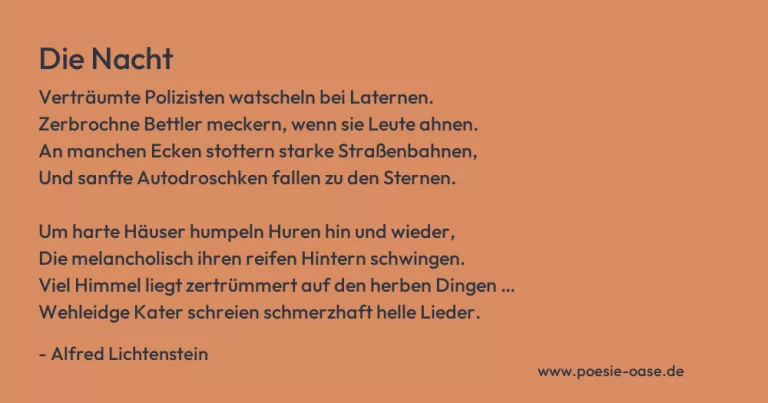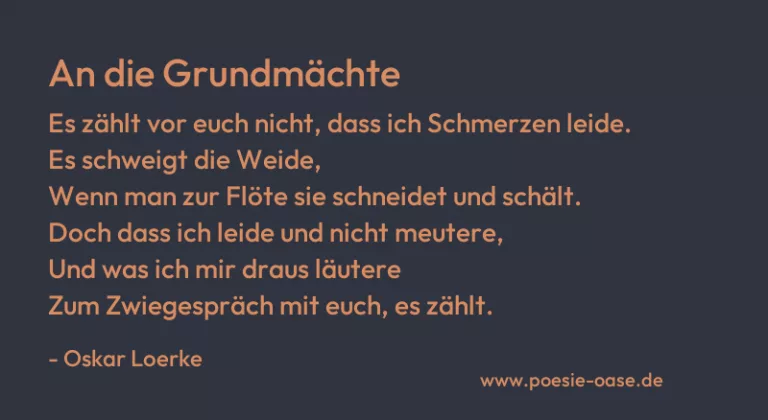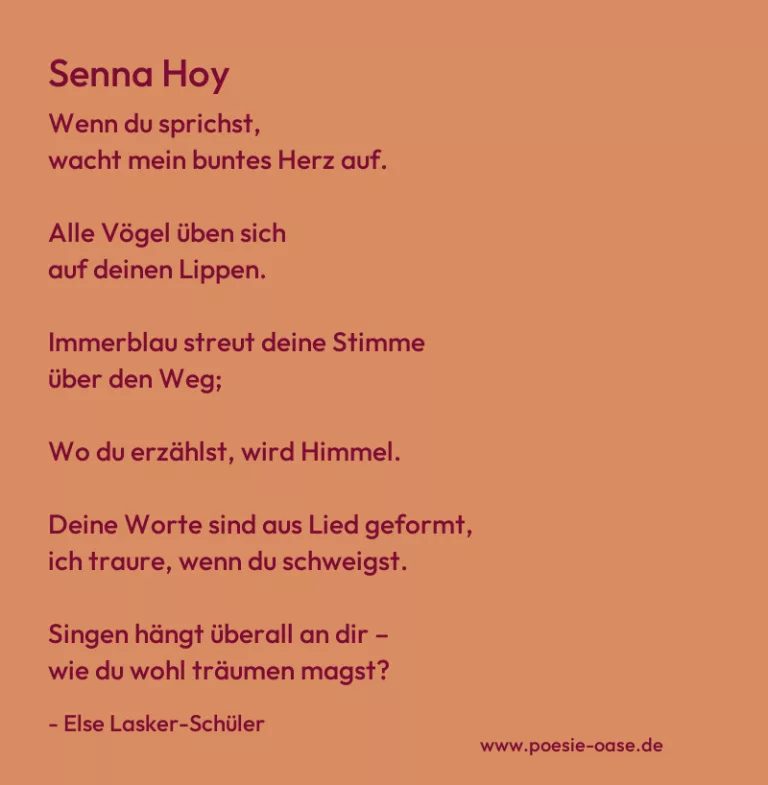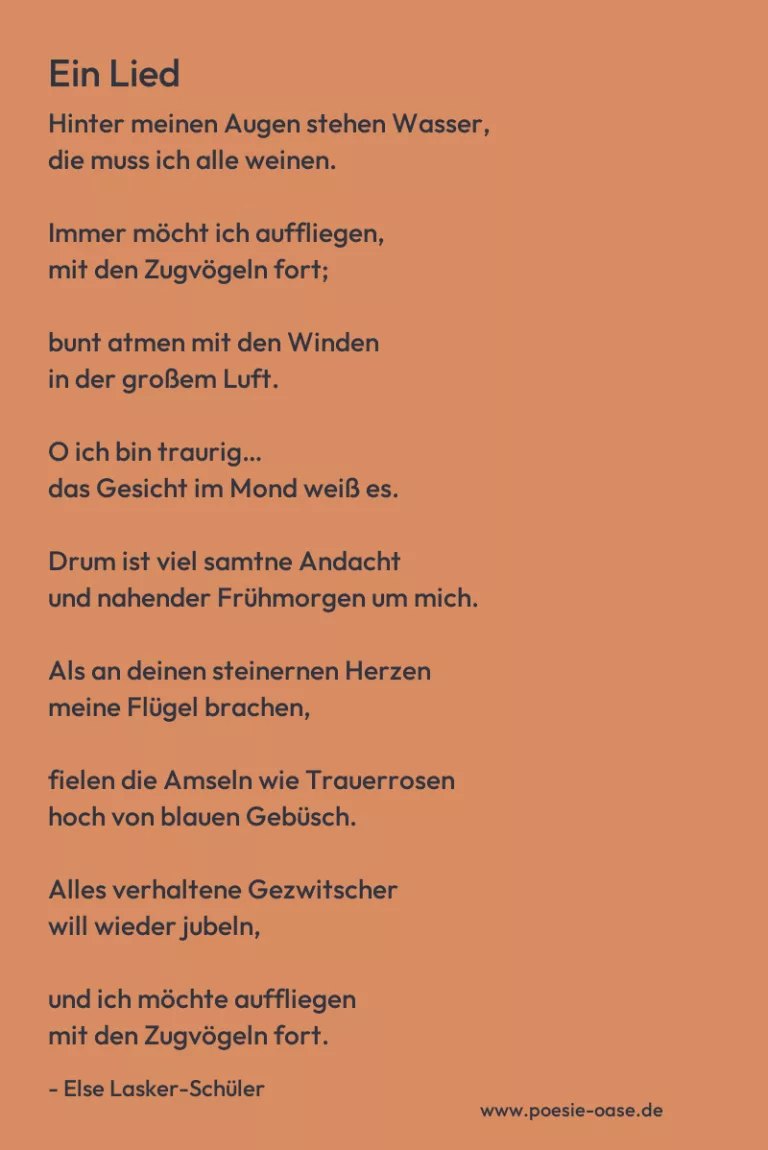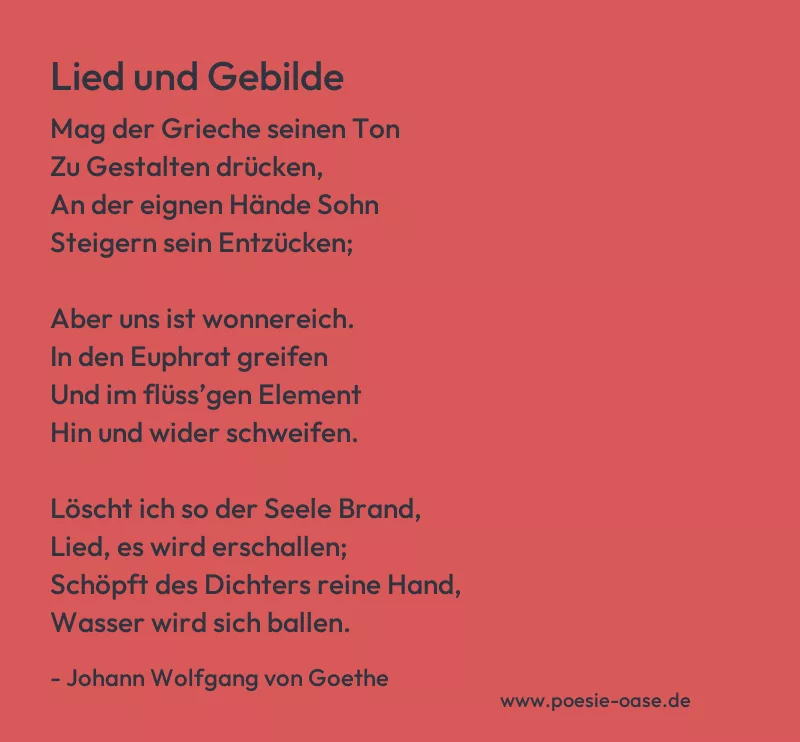Lied und Gebilde
Mag der Grieche seinen Ton
Zu Gestalten drücken,
An der eignen Hände Sohn
Steigern sein Entzücken;
Aber uns ist wonnereich.
In den Euphrat greifen
Und im flüss’gen Element
Hin und wider schweifen.
Löscht ich so der Seele Brand,
Lied, es wird erschallen;
Schöpft des Dichters reine Hand,
Wasser wird sich ballen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
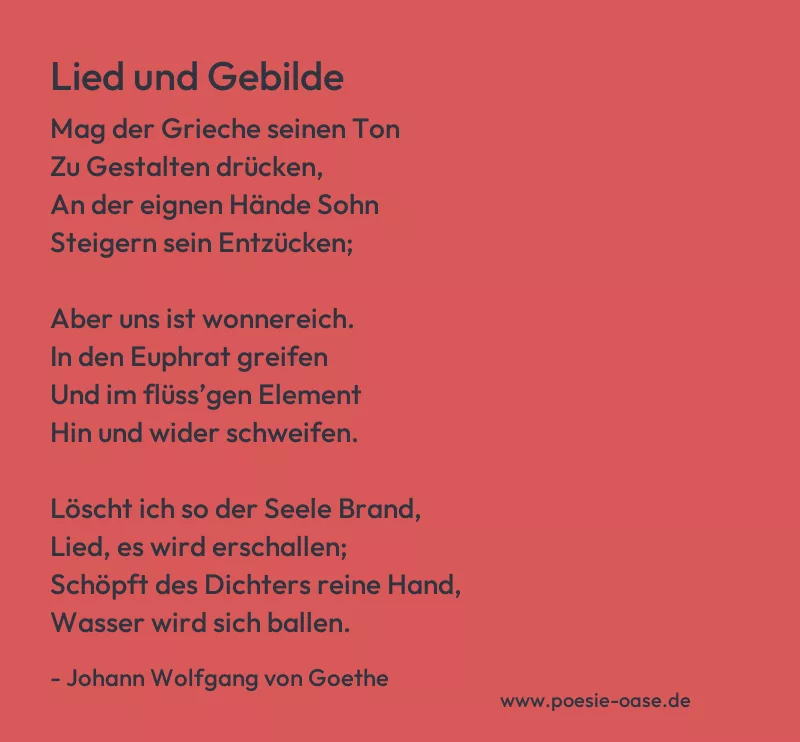
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Lied und Gebilde“ von Johann Wolfgang von Goethe stellt einen Gegensatz zwischen zwei künstlerischen Ausdrucksformen dar: der bildenden Kunst und der Dichtung. Während der „Grieche“ seine Kunst durch feste Formen und Gestalten ausdrückt, bevorzugt das lyrische Ich eine fluidere, weniger greifbare Kunstform – das Lied. Diese Gegenüberstellung symbolisiert den Unterschied zwischen bildhafter und musikalisch-poetischer Kunst.
Die erste Strophe beschreibt die klassische Bildhauerkunst: Der Künstler formt mit seinen eigenen Händen Gestalten und steigert dabei seine Freude an der geschaffenen Materie. Demgegenüber steht die zweite Strophe, in der das lyrische Ich die Dynamik und Flüchtigkeit der Dichtung betont. Es vergleicht das eigene Schaffen mit dem Eintauchen in den Euphrat, einem Sinnbild für das Fließen und die Bewegung des poetischen Ausdrucks.
In der letzten Strophe wird die Dichtkunst mit einem schöpferischen Akt gleichgesetzt, der sowohl Ausdruck als auch Erfüllung innerer Sehnsucht ist. Das „Lied“ entspringt der lodernden Seele und wird unweigerlich erklingen. Ebenso wie das Wasser, das sich in der Hand des Dichters zu formen beginnt, gewinnt auch die Poesie Gestalt, bleibt aber zugleich in ihrer Bewegung und Fluidität bestehen. Damit feiert Goethe die Dichtung als eine Kunst, die nicht in festen Formen erstarrt, sondern lebendig und fließend bleibt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.