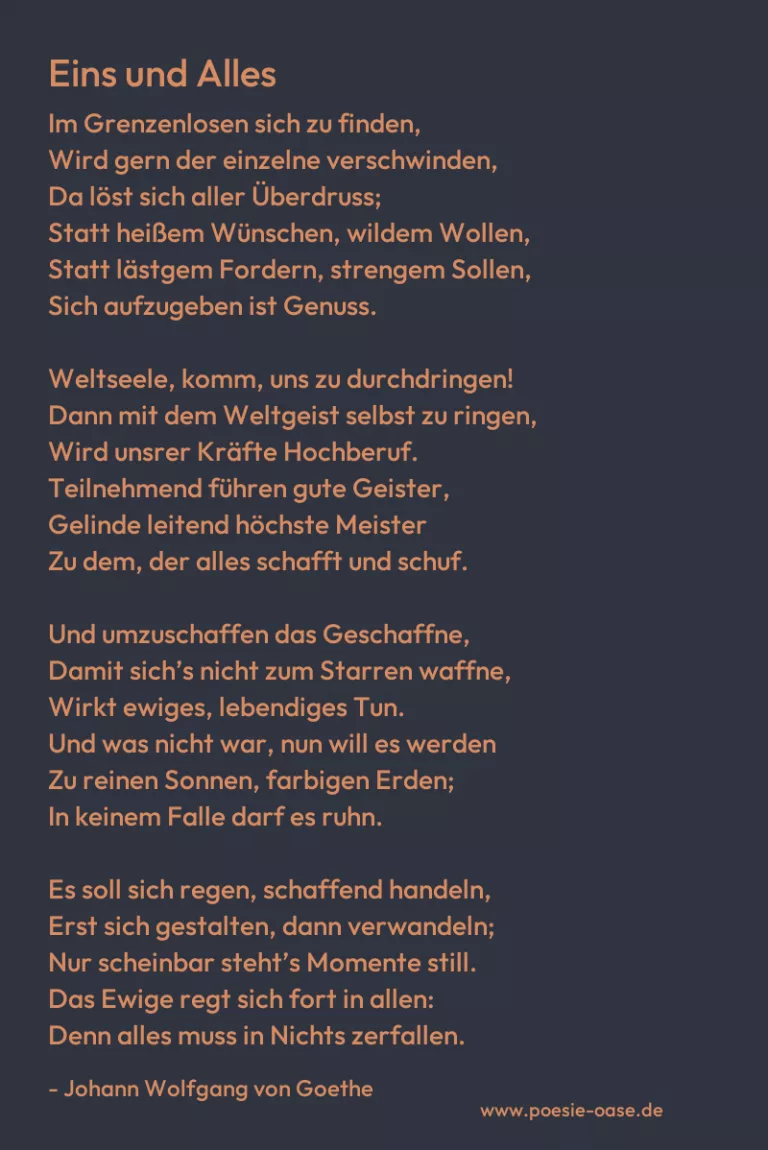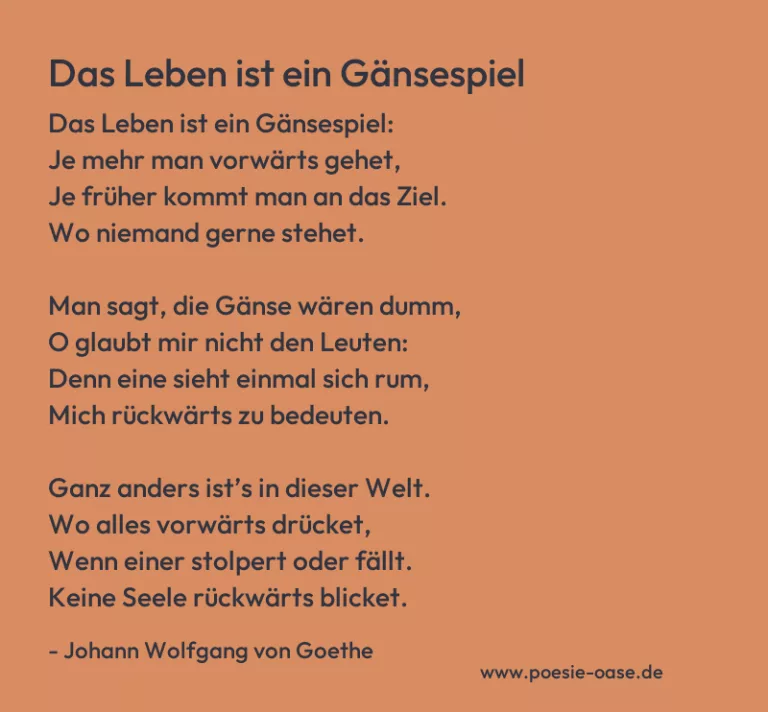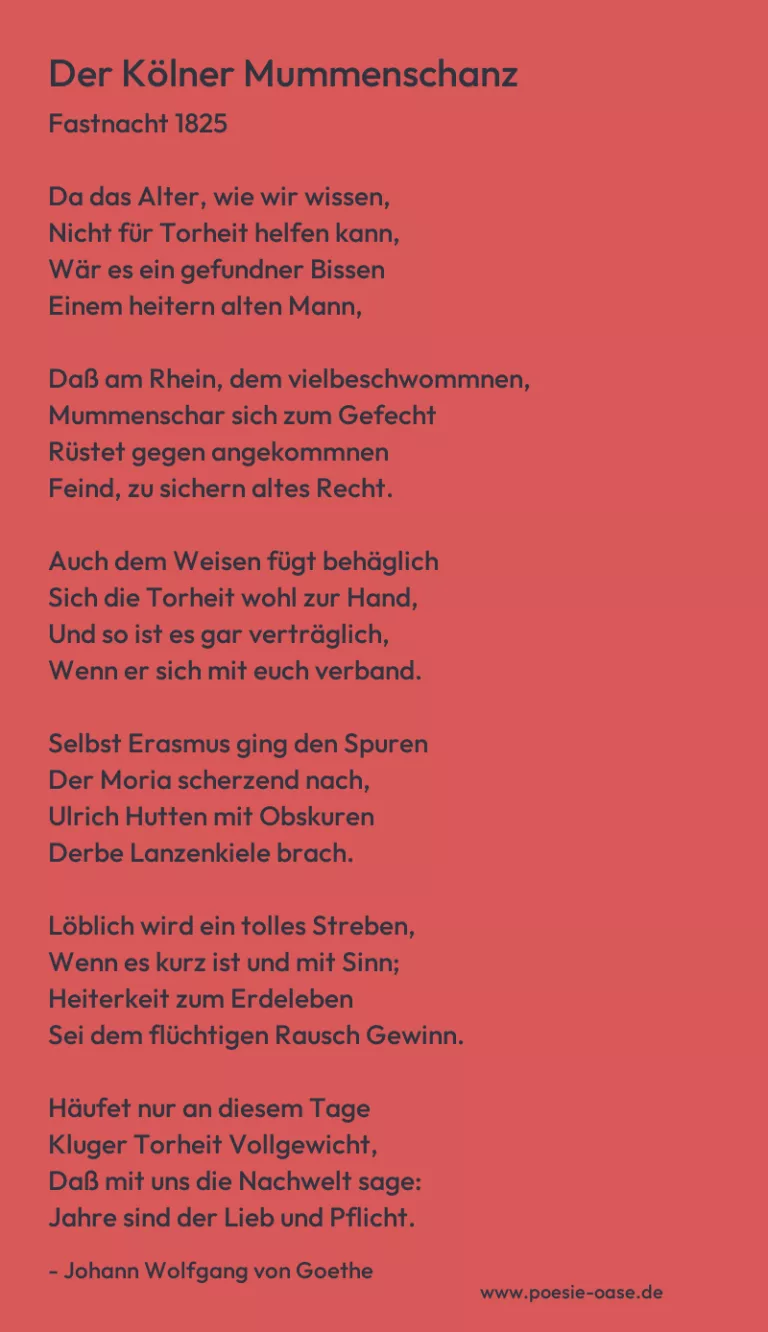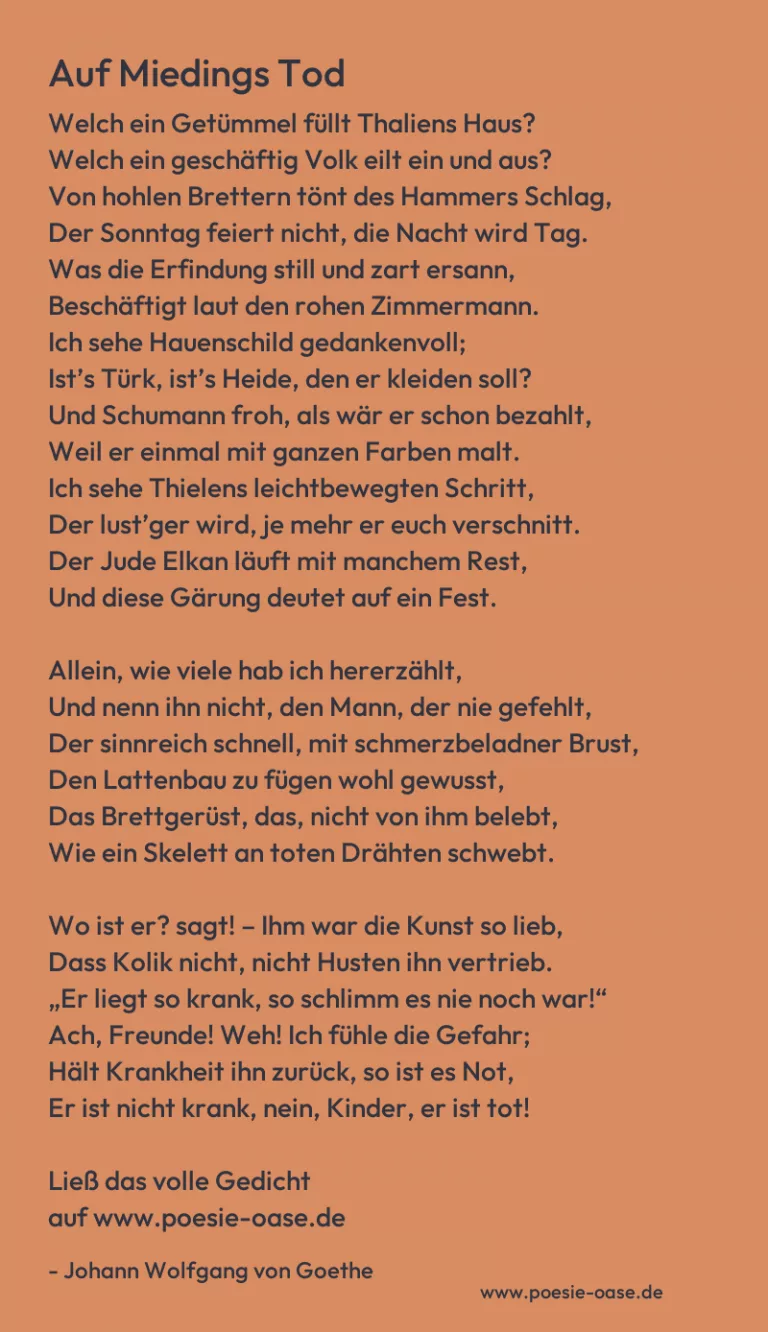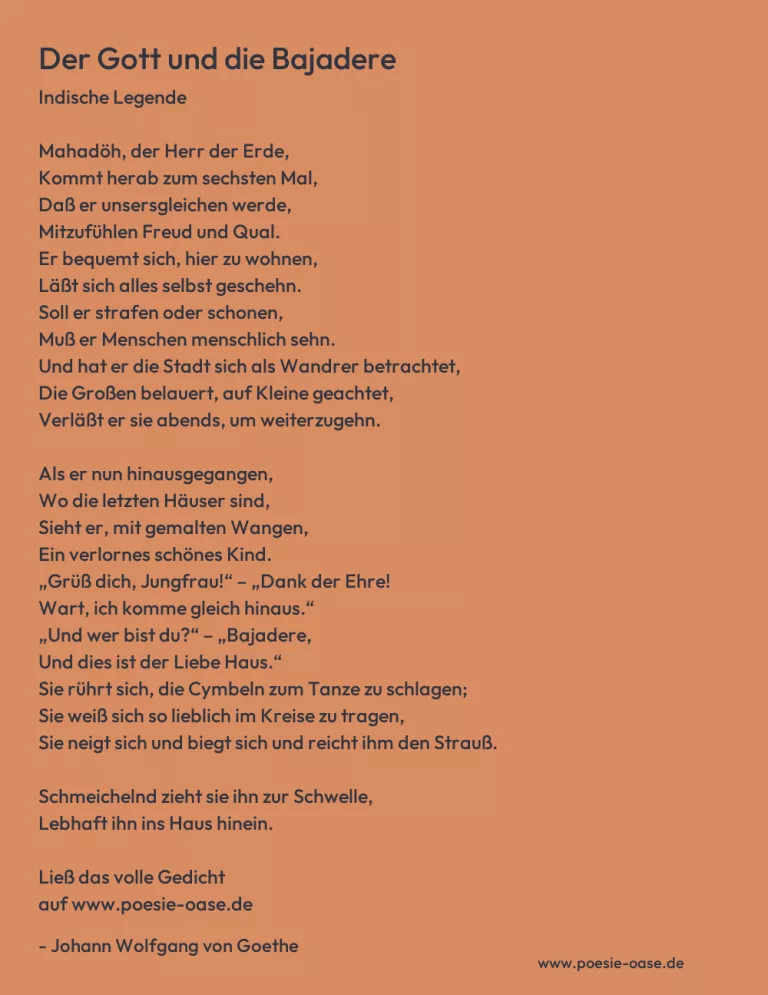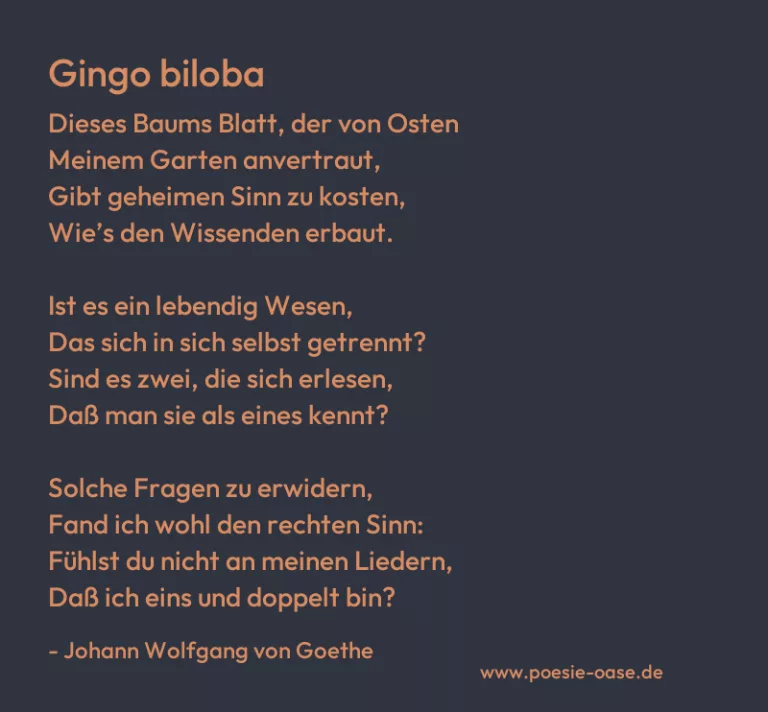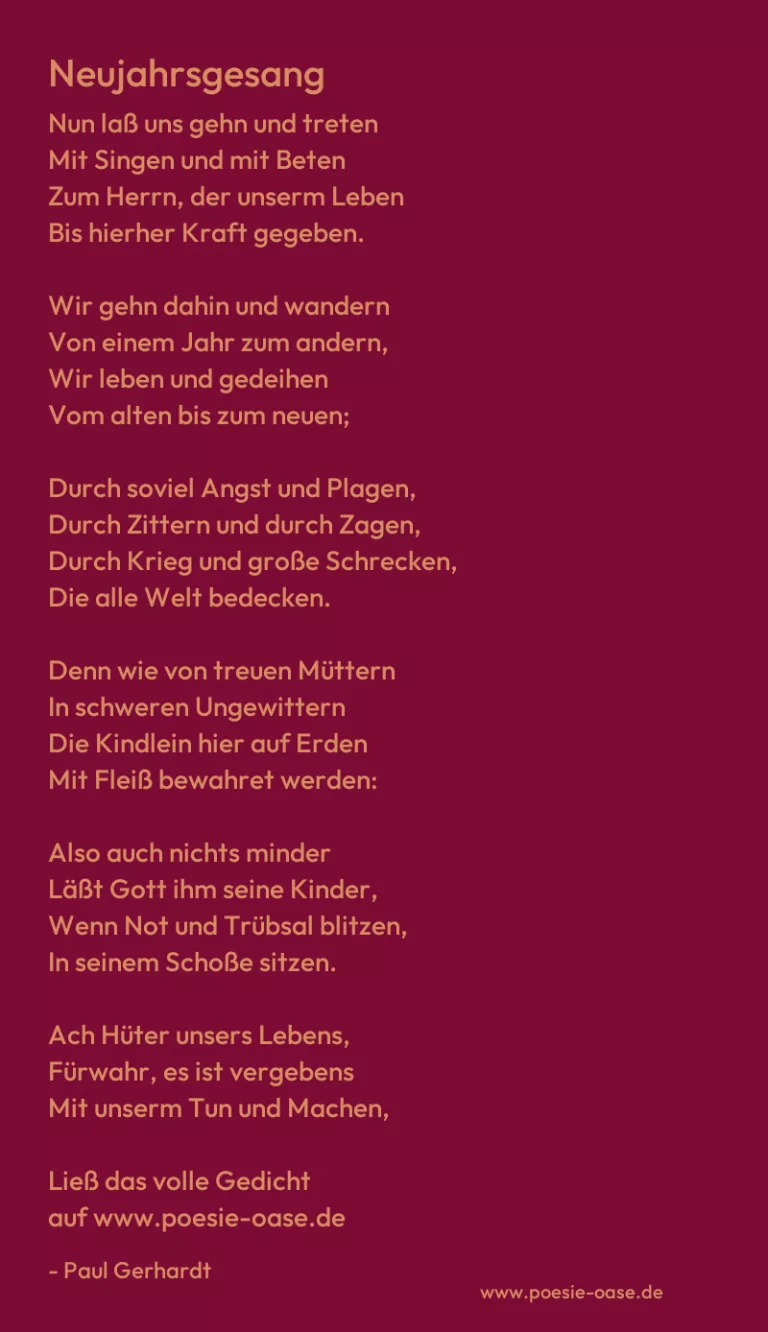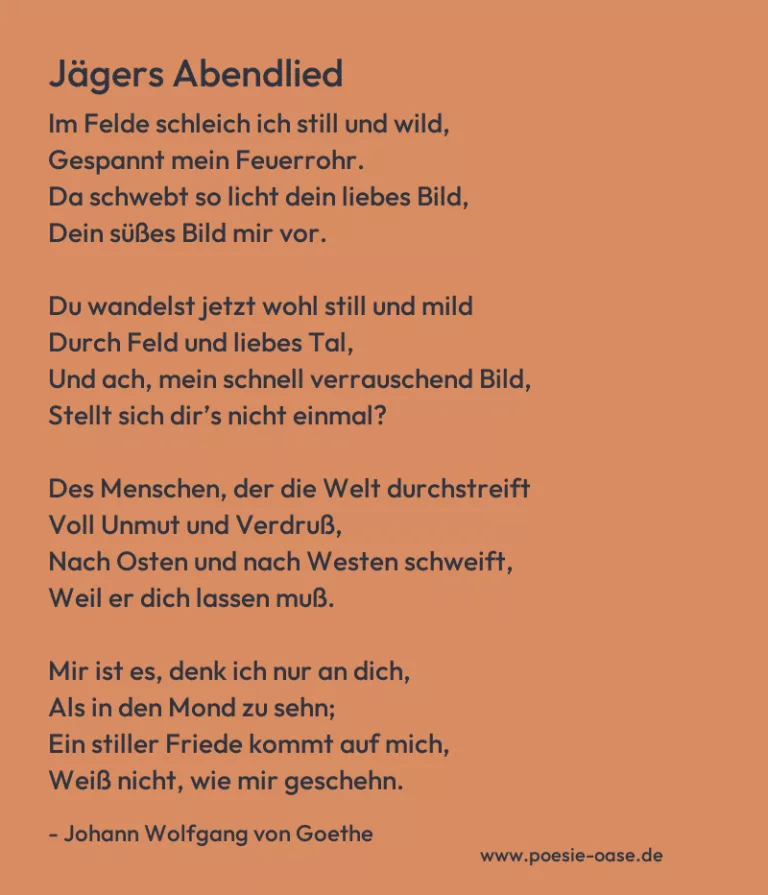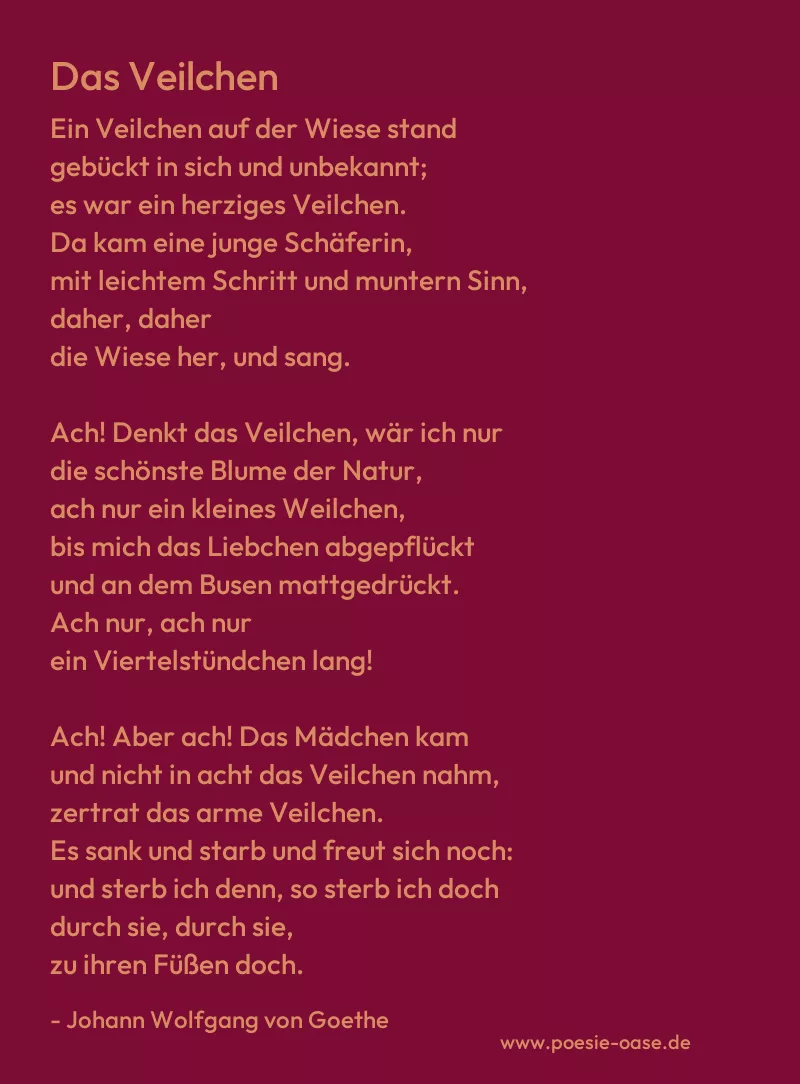Ein Veilchen auf der Wiese stand
gebückt in sich und unbekannt;
es war ein herziges Veilchen.
Da kam eine junge Schäferin,
mit leichtem Schritt und muntern Sinn,
daher, daher
die Wiese her, und sang.
Ach! Denkt das Veilchen, wär ich nur
die schönste Blume der Natur,
ach nur ein kleines Weilchen,
bis mich das Liebchen abgepflückt
und an dem Busen mattgedrückt.
Ach nur, ach nur
ein Viertelstündchen lang!
Ach! Aber ach! Das Mädchen kam
und nicht in acht das Veilchen nahm,
zertrat das arme Veilchen.
Es sank und starb und freut sich noch:
und sterb ich denn, so sterb ich doch
durch sie, durch sie,
zu ihren Füßen doch.