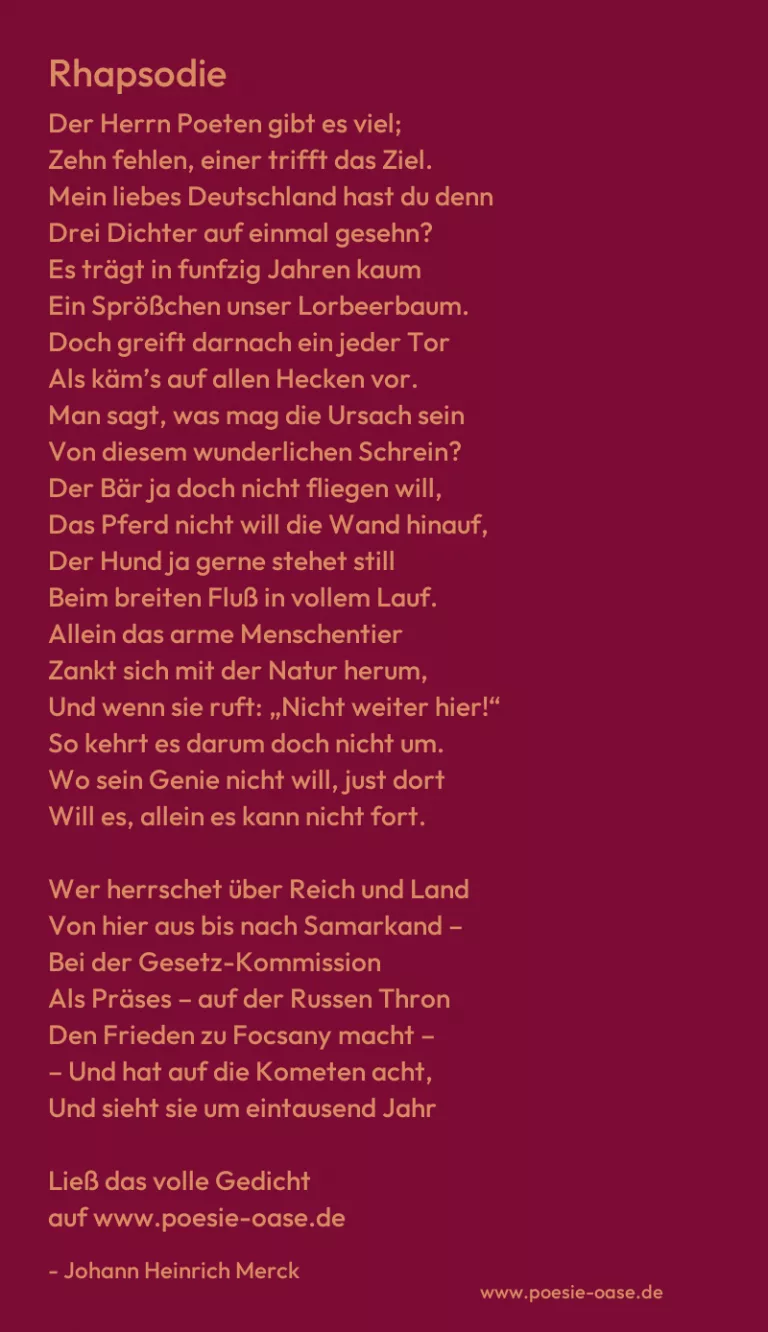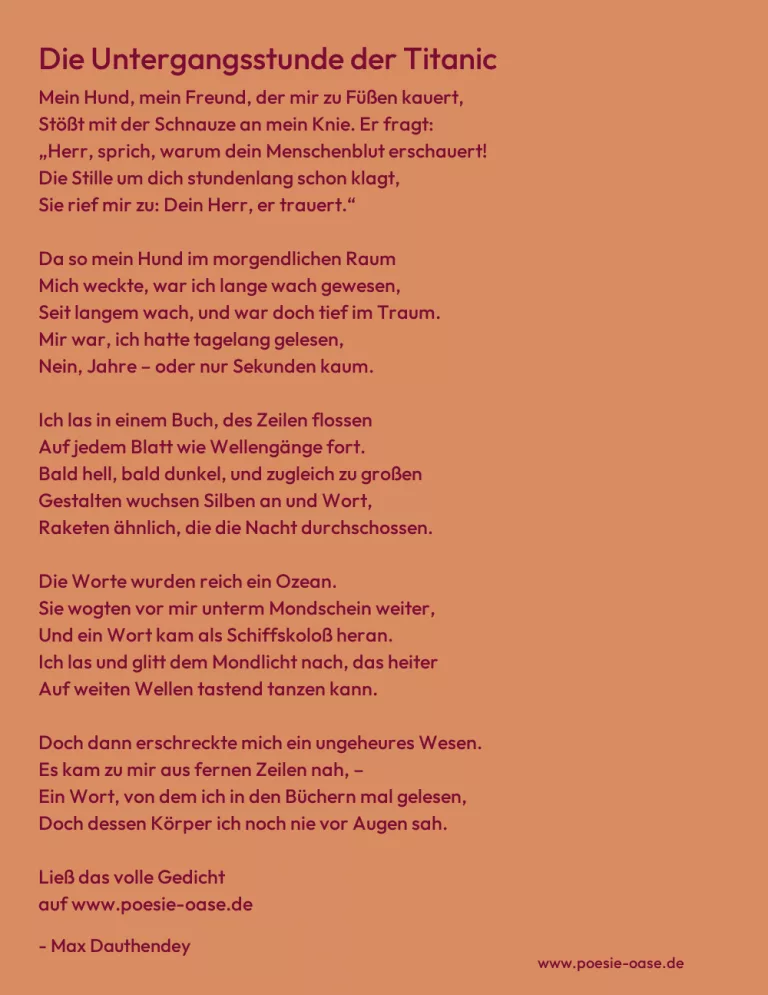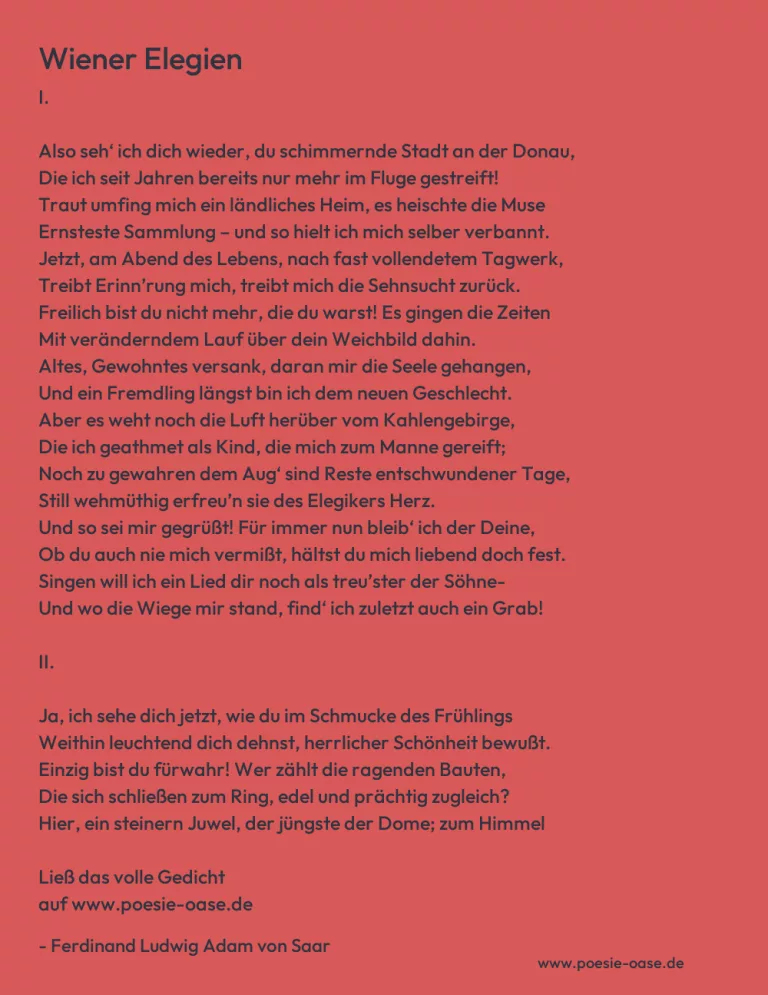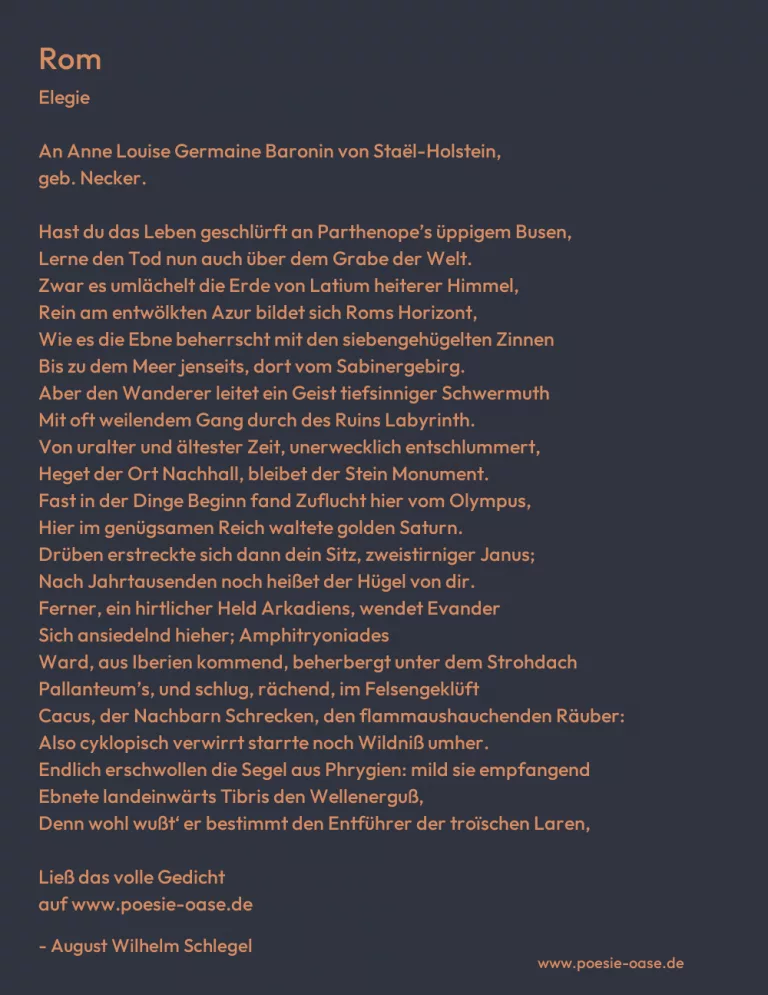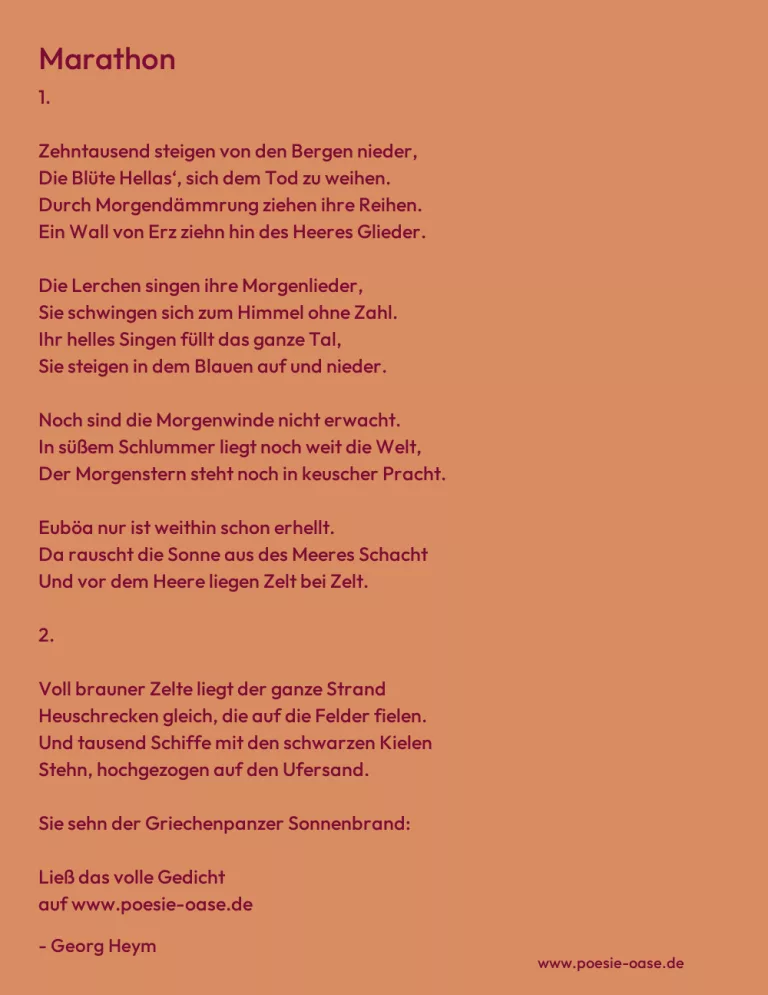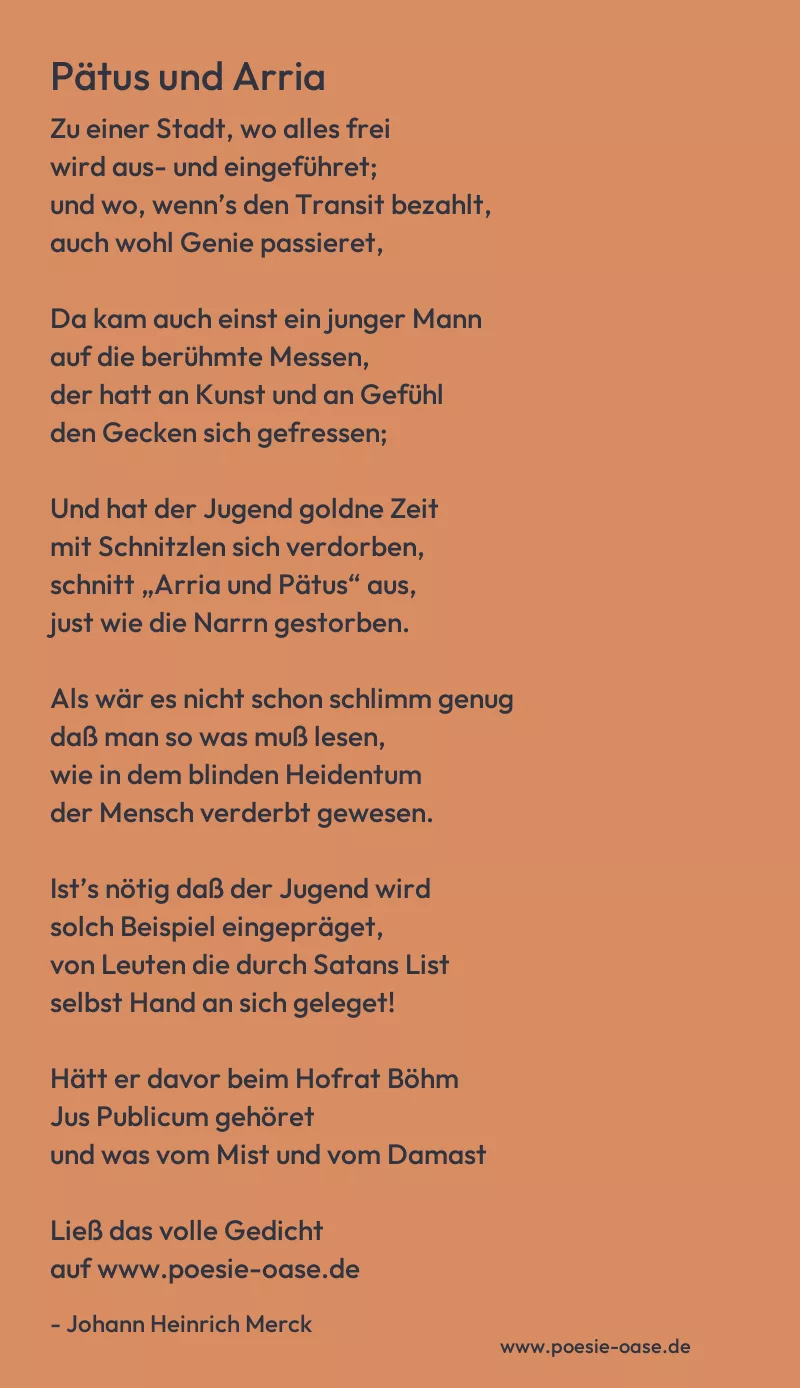Zu einer Stadt, wo alles frei
wird aus- und eingeführet;
und wo, wenn’s den Transit bezahlt,
auch wohl Genie passieret,
Da kam auch einst ein junger Mann
auf die berühmte Messen,
der hatt an Kunst und an Gefühl
den Gecken sich gefressen;
Und hat der Jugend goldne Zeit
mit Schnitzlen sich verdorben,
schnitt „Arria und Pätus“ aus,
just wie die Narrn gestorben.
Als wär es nicht schon schlimm genug
daß man so was muß lesen,
wie in dem blinden Heidentum
der Mensch verderbt gewesen.
Ist’s nötig daß der Jugend wird
solch Beispiel eingepräget,
von Leuten die durch Satans List
selbst Hand an sich geleget!
Hätt er davor beim Hofrat Böhm
Jus Publicum gehöret
und was vom Mist und vom Damast
Herr Schröder gründlich lehret.
So könnte man ihn irgendwo
in ein Kolleg’um setzen,
und er braucht nicht durch seine Kunst
die Sitten zu verletzen!
Und nun stellt er vor Weigands Tür
das Bild gar aus zum Schauen!
und alles läuft hin, jung und alt,
die Männer und die Frauen.
So schlimm der Gegenstand auch war,
so muß man doch gestehen,
viel Kunst und noch viel mehr Natur
war an dem Bild zu sehen.
Und denn, so ist die Jugend schwach,
setzt sich gleich an die Stelle
und überleget nicht genau
den Unterschied der Fälle.
So ging’s auch hier, sie weinten laut,
vergaßen Sehn und Hören,
und fieln einander um den Hals,
als ob sie’s selber wären.
Und als sie rief: „Es tut nicht weh“;
und er den Dolch nun zückte,
da ging der Dolch durch jedes Herz,
des Auge dahin blickte.
Doch Leute die bei Jahren warn
und die in Ämtern stunden,
die hatten bald das Ridikül
von dieser Tat empfunden.
Und strichen sich das Unterkinn
und schwurn bei ihrer Ehre,
man mache zu viel Lärm, daß nun
ein Narre wen’ger wäre.
Auch manchem steif honetten Mann,
den Gott und seine Gaben,
vor einer Sünde dieser Art
vorlängst bewahret haben;
Wünscht sich und seinem Weibe Glück
daß er in seinem Leben
durch kein gefährlich Ding wie dies
ein Ärgernis gegeben.
Das alles half dem Lärm nicht ab,
der mehrte sich indessen,
die Jungens und die Mädchen warn
gar auf das Ding versessen;
Und man befürchtete mit Recht,
das Herz möcht ihnen brechen,
und wenn sie sich einst satt geküßt,
sie möchten sich erstechen.
Da kam ein schöner Geist herbei
und zeigt durch seine Lehren,
„das Interesse dieses Werks
beruhte auf Schimären:
Sollt sich wohl die Ministersfrau,
weil man den Mann verwiesen,
gleich in der ersten Ungeduld,
erstechen und erschießen!
Denn stellt von tausend Fällen euch
nur einen in Gedanken,
wie’s anders gehen konnt! wie bald
wird das Intresse schwanken!
Gesetzt es hätte der Tyrann
das Urteil unterschrieben,
allein es reute ihn, und wünscht,
es wäre unterblieben:
Und er ließ nun den braven Mann
mit Ehr und Gut beschenken,
und dieser zög aufs Land, um fern
vom Hof und seinen Ränken,
Sein väterliches Gut zu baun,
die Kinder zu erziehen,
und dankt der Vorsicht in der Still
für das, so sie verliehen.
Ist das nicht besser, als wenn er
sogleich, der Welt verdrossen,
sich in der ersten Stunde hätt
erstochen und erschossen.“
Auch sorgt der Rektor jenes Orts
daß in dem Schulexamen,
zwei Knaben über diesen Text
zu disputieren kamen.
Die zeigten denn durch Mendelssohn
und die Empfindungsbriefe,
daß aller Selbstmord in der Welt
am Ende dahin liefe:
Daß man im Unglück sich so ließ
durch Sinnlichkeiten rühren,
die höh’re Seelenkräfte nicht
das Ruder ließe führen;
Dagegen sollt der Mensch, als Herr,
sich wissen zu regieren,
und eh er sich erschießen wollt,
sich lieber distrahieren.
In Leipzig ging’s derweile bunt!
mit Recht war zu besorgen,
die Leute die erstächen sich
am lieben hellen Morgen.
Es fürchteten am Ende gar
die feisten Sup’rindenten,
die Weiber präsentierten ihn’n
den Dolch in ihren Händen,
Und riefen: „Herr, es tut nicht weh!“
Da hätten sie sich schämen,
und gar vielleicht in eigne Hand
den Degen müssen nehmen.
Drum setzten sie sich an den Tisch
in ihren großen Krägen,
und fingen an mit Gott und Mut
die Sach zu überlegen.
Und wurden eins, daß man sogleich
den Männern und den Frauen,
bei hundert Taler Straf verbot
das Bildchen anzuschauen.
Der Fremdling der sich unterstünd
dergleichen einzuführen,
soll künftig auf der Stelle gleich
den Kopf dafür verlieren.
Den Künstlern in dem Lande sei’s
doch unverwehrt indessen,
von Bildern dieser Art hinfür
auf allen ihren Messen,
Zu schnitzeln, zu behaun, und auch
im Lande zu verfahren!
weil nie ein solches Ärgernis
von ihnen zu befahren.