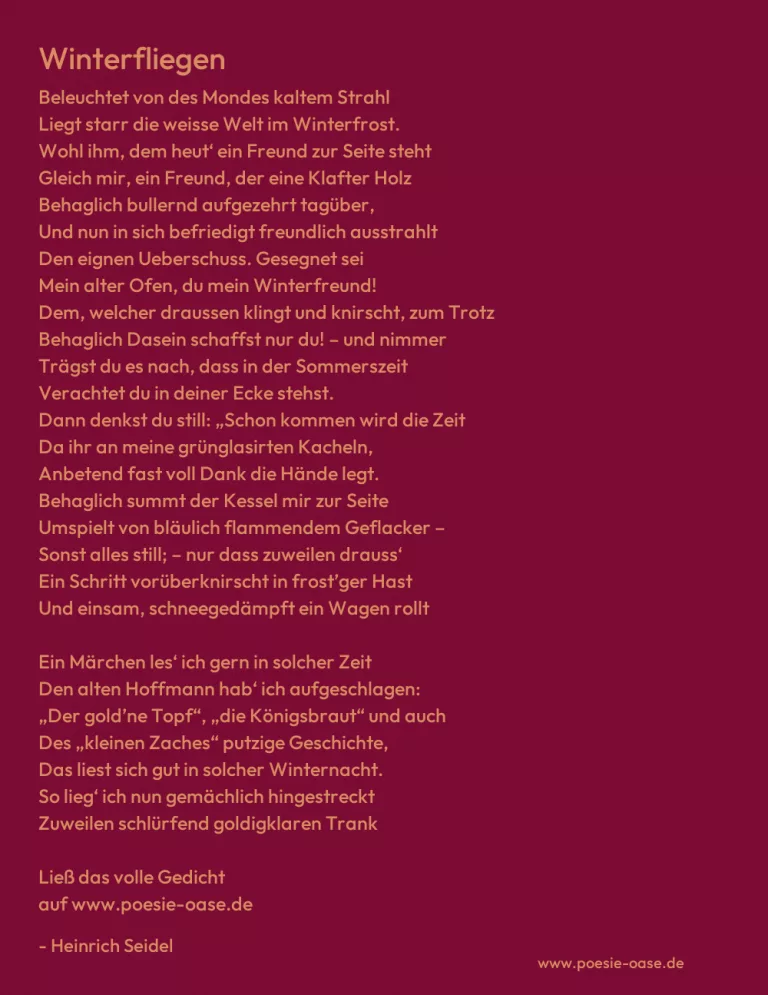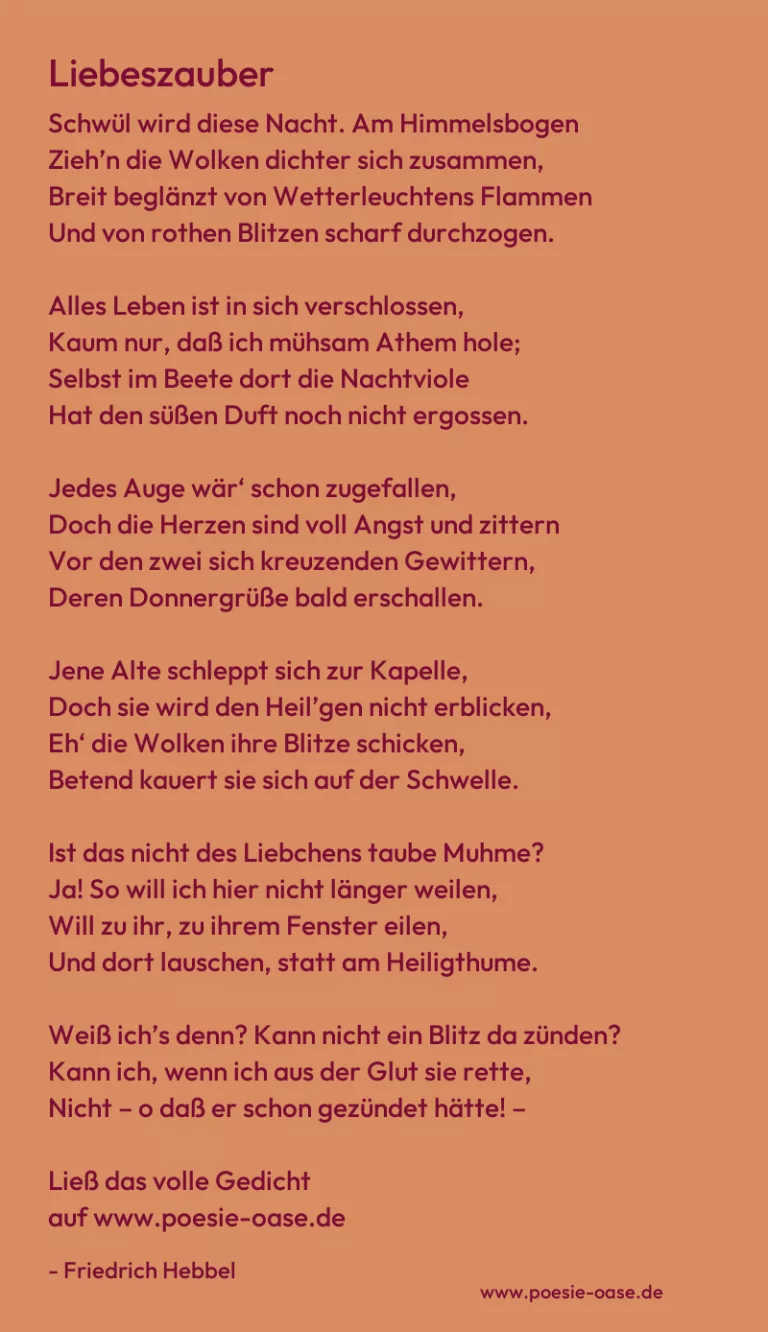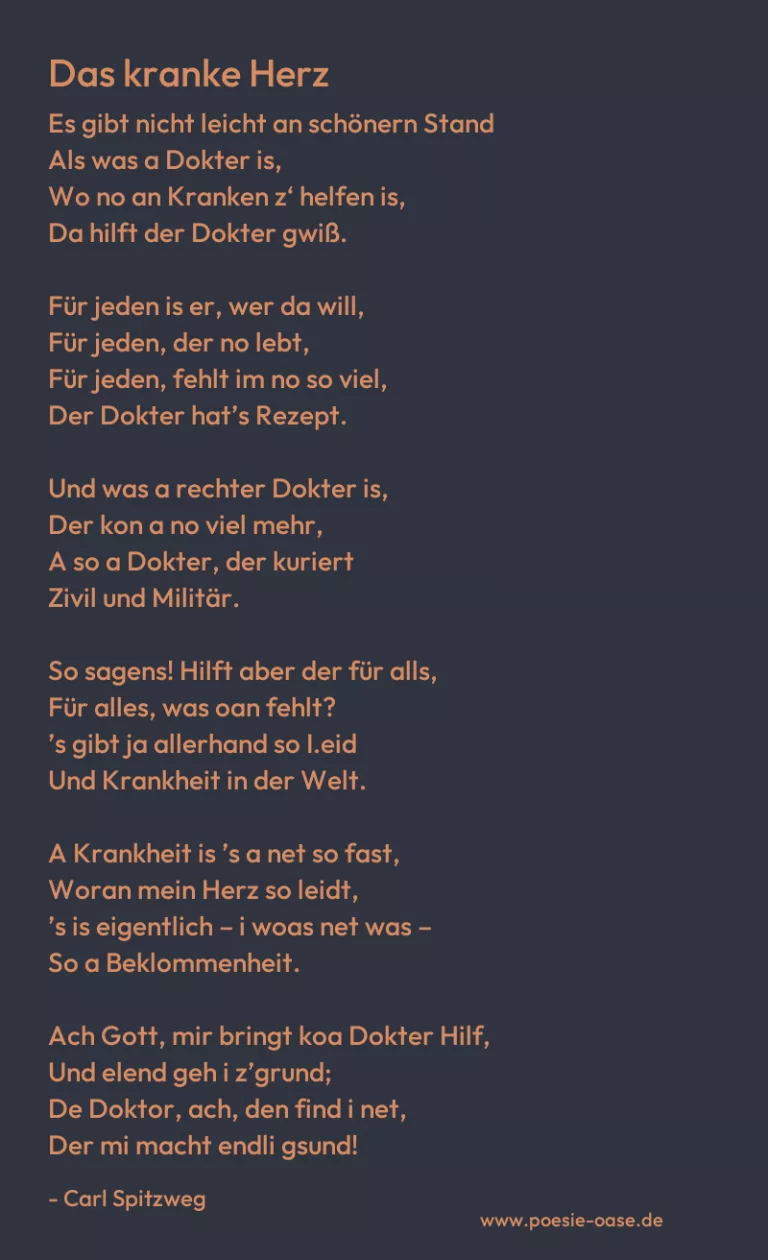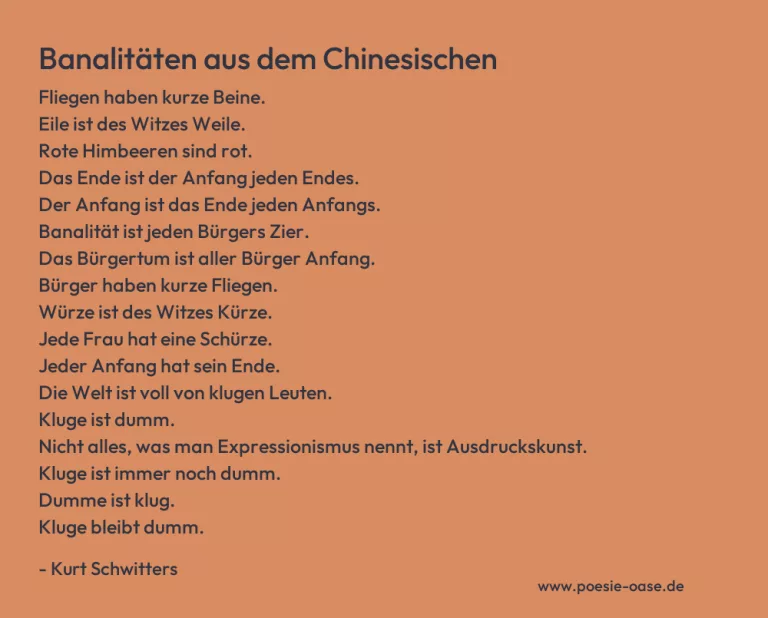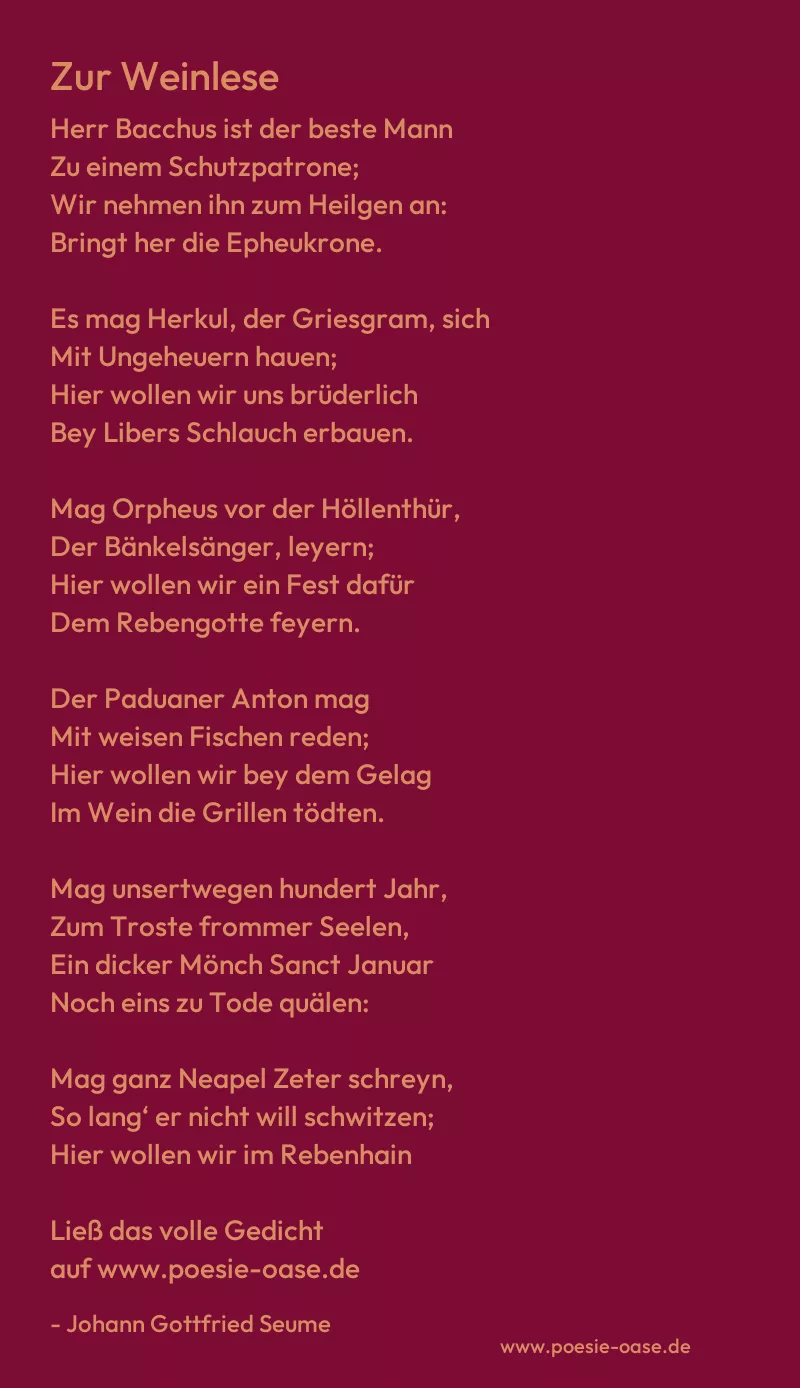Herr Bacchus ist der beste Mann
Zu einem Schutzpatrone;
Wir nehmen ihn zum Heilgen an:
Bringt her die Epheukrone.
Es mag Herkul, der Griesgram, sich
Mit Ungeheuern hauen;
Hier wollen wir uns brüderlich
Bey Libers Schlauch erbauen.
Mag Orpheus vor der Höllenthür,
Der Bänkelsänger, leyern;
Hier wollen wir ein Fest dafür
Dem Rebengotte feyern.
Der Paduaner Anton mag
Mit weisen Fischen reden;
Hier wollen wir bey dem Gelag
Im Wein die Grillen tödten.
Mag unsertwegen hundert Jahr,
Zum Troste frommer Seelen,
Ein dicker Mönch Sanct Januar
Noch eins zu Tode quälen:
Mag ganz Neapel Zeter schreyn,
So lang‘ er nicht will schwitzen;
Hier wollen wir im Rebenhain
Bey großen Trauben sitzen:
Mit Weinlaub unser Haupt bekrönt,
Und Thyrsen unsre Lanzen,
Wenn hoch der Chor Evoeh tönt,
Um Vater Bacchus tanzen:
Rund um den großen Wundermann
Und seine Tieger springen;
Und wer den Chor nicht halten kann,
Doch mit Evoeh singen.
Er schuf der Kelter Zaubersaft,
Und gab in Purpurreben
Den Erdensöhnen Götterkraft
Zu einem neuen Leben.
Er wandelt durch das Erdenrund
Wohlthätig mit Geschenken,
Vom Indusstrande nach Burgund,
Die Sterblichen zu tränken.
Von Cypern bis zum Hoffnungskap,
Von Tokay bis zum Rheine
Deckt, wo er geht, sein Götterstab
Die Hügel stracks mit Weine.
Er schickt sein gramverscheuchend Gut
Entfernten Nationen,
Die nah am Pol mit kaltem Blut
Im Schoos des Winters wohnen.
Trinkt, Brüder, laßt uns Sterblichkeit
Und Gruft und Tod vergessen,
Und uns schon jetzt mit Ewigkeit
Und mit den Göttern messen.
Trinkt, Winzer, eure Humpen leer,
Und füllet Korb und Ständer,
Und lehnt, wird euch das Haupt zu schwer,
Euch fest an das Geländer.
Evoeh, Bacche, Jacche!
Lyäens Nektar winket;
Hebt volle Tummler in die Höh,
Jauchzt Libern Dank, und trinket.