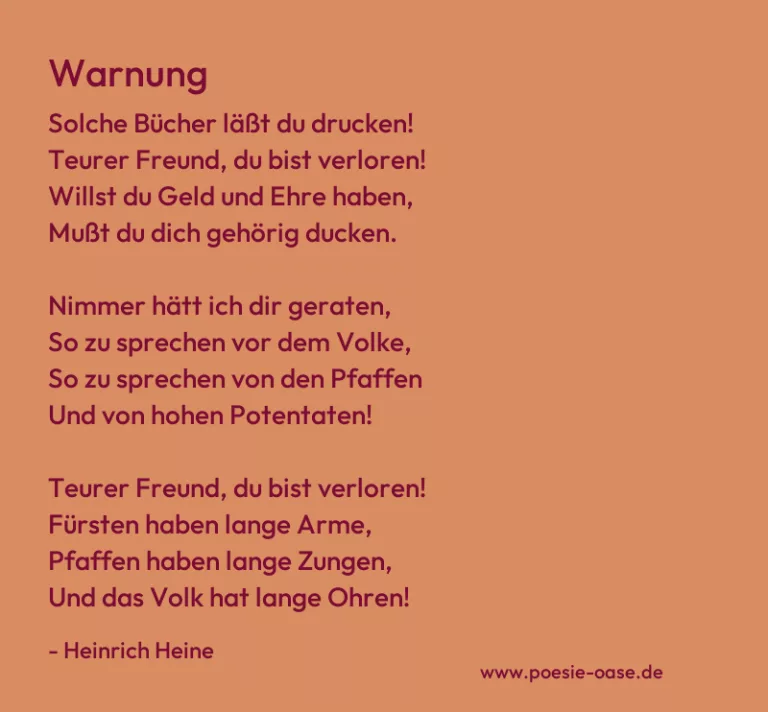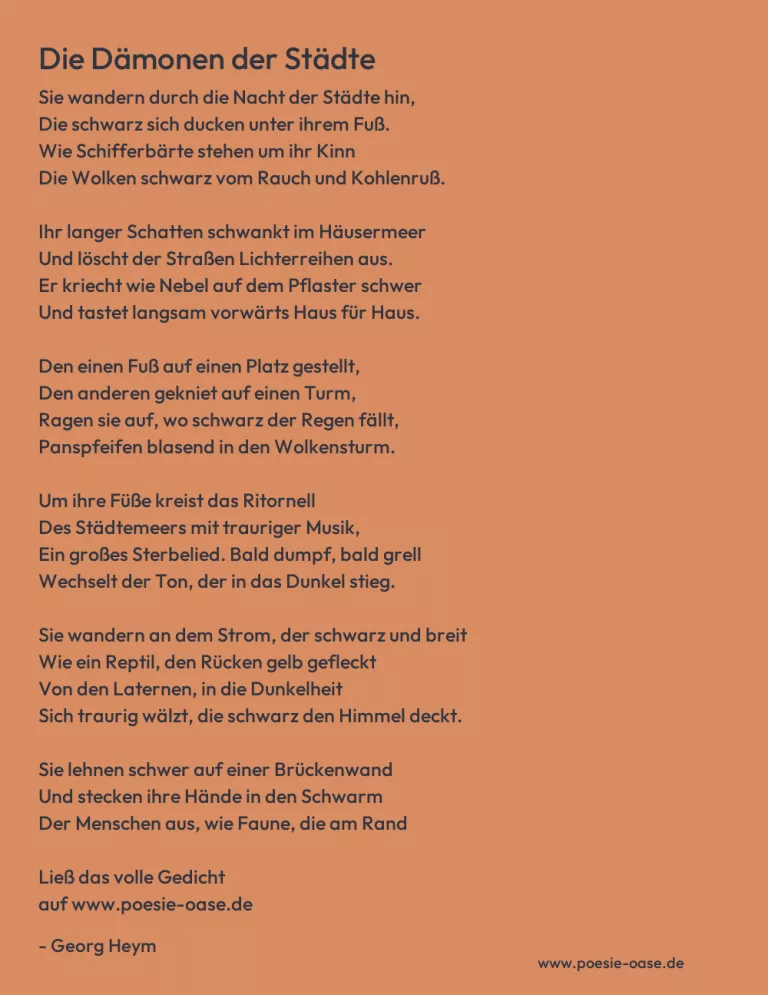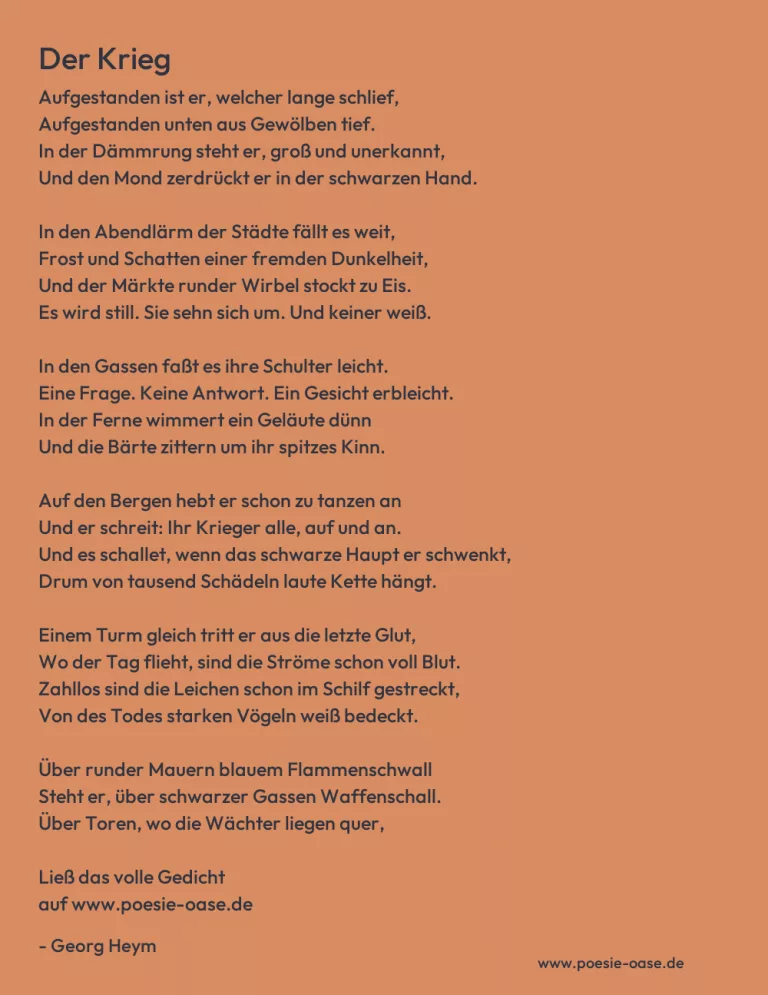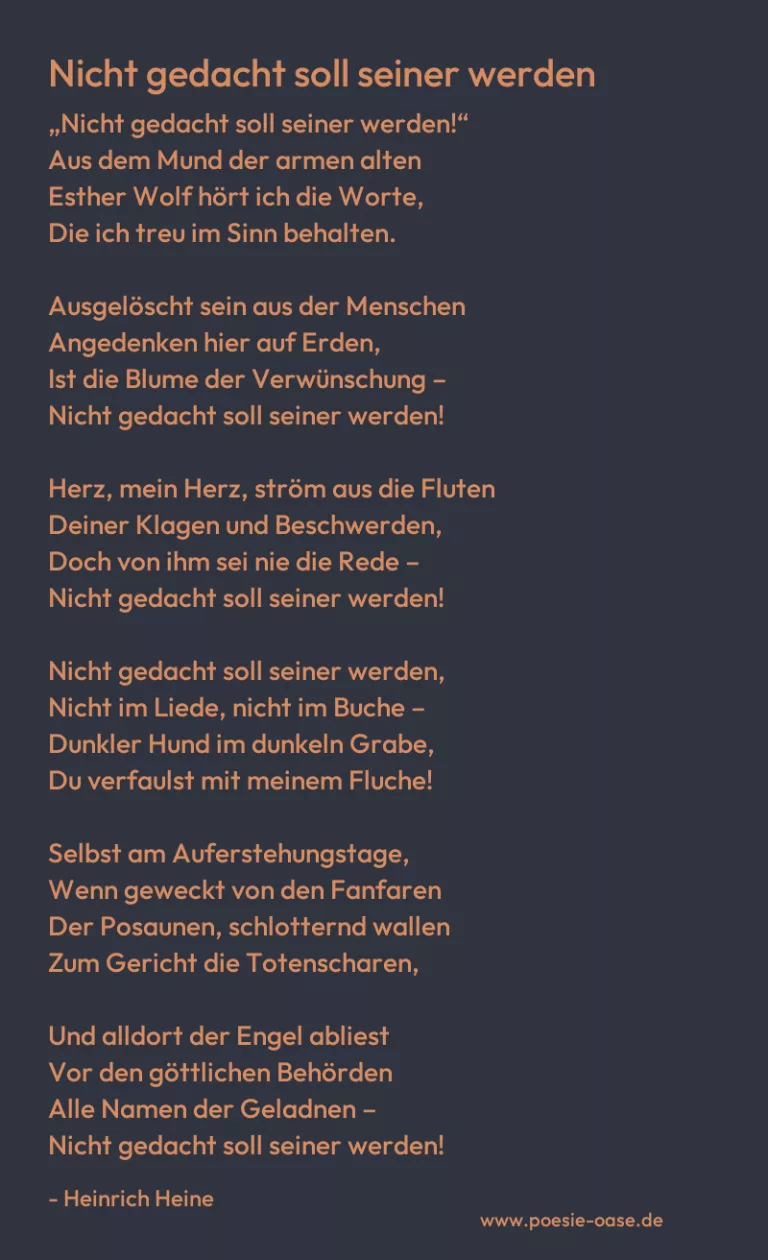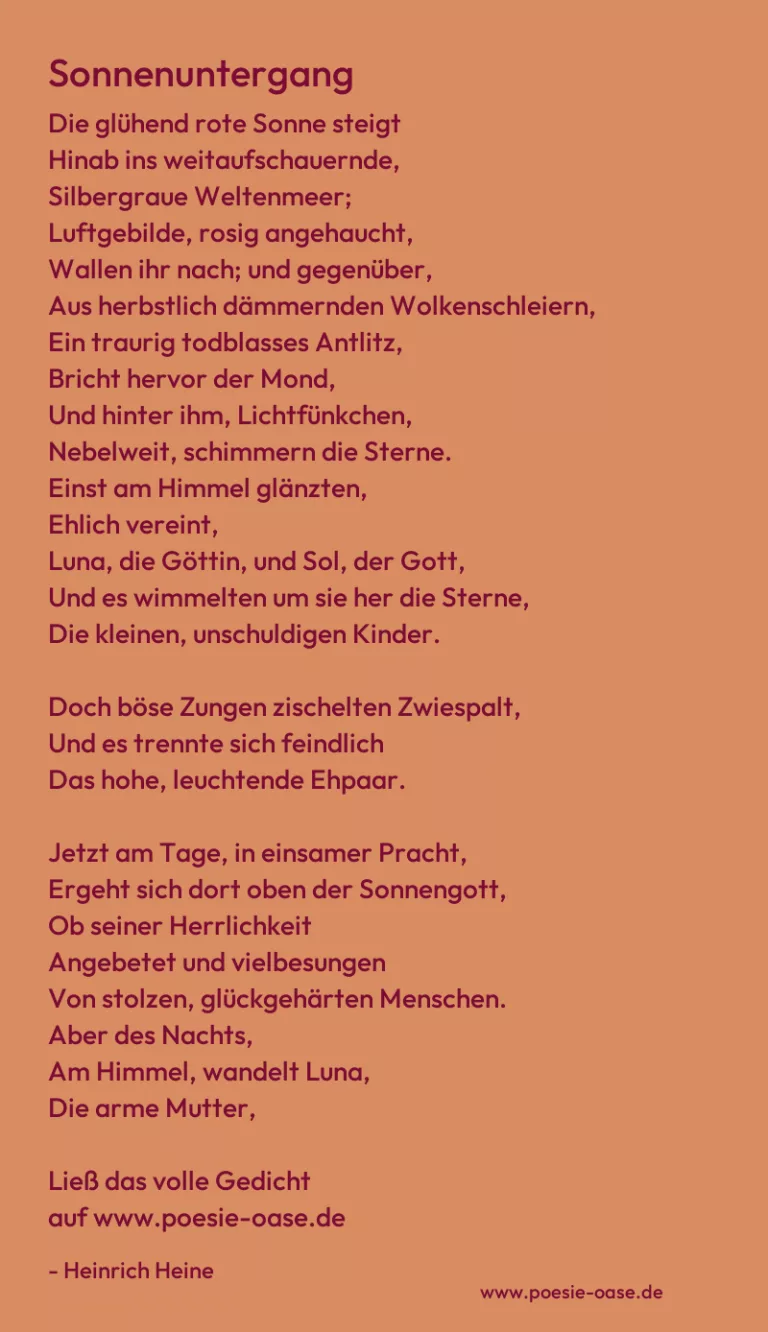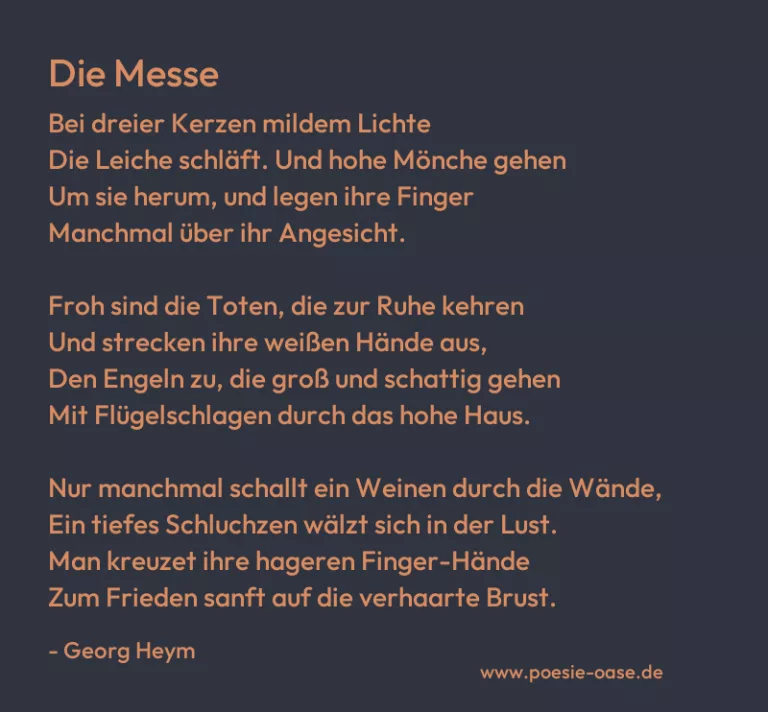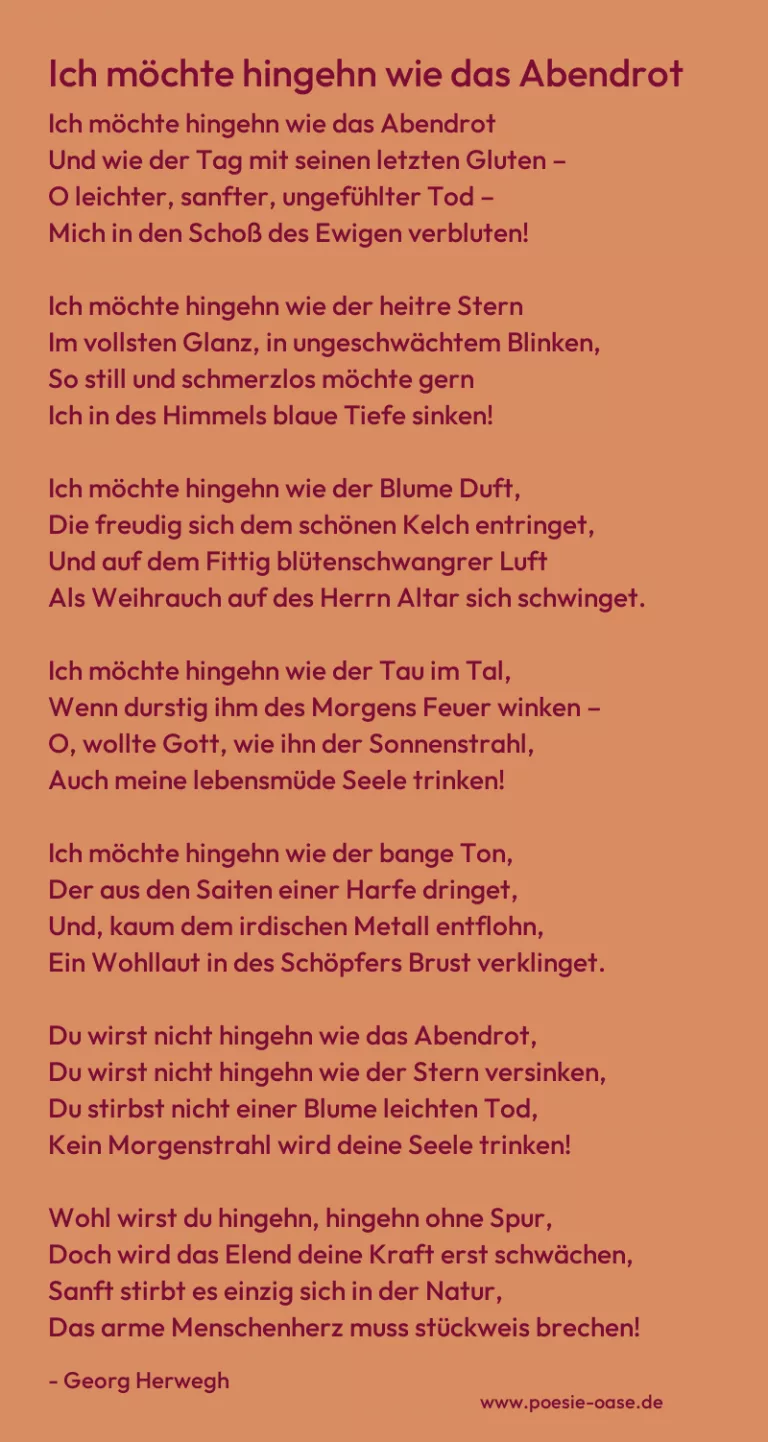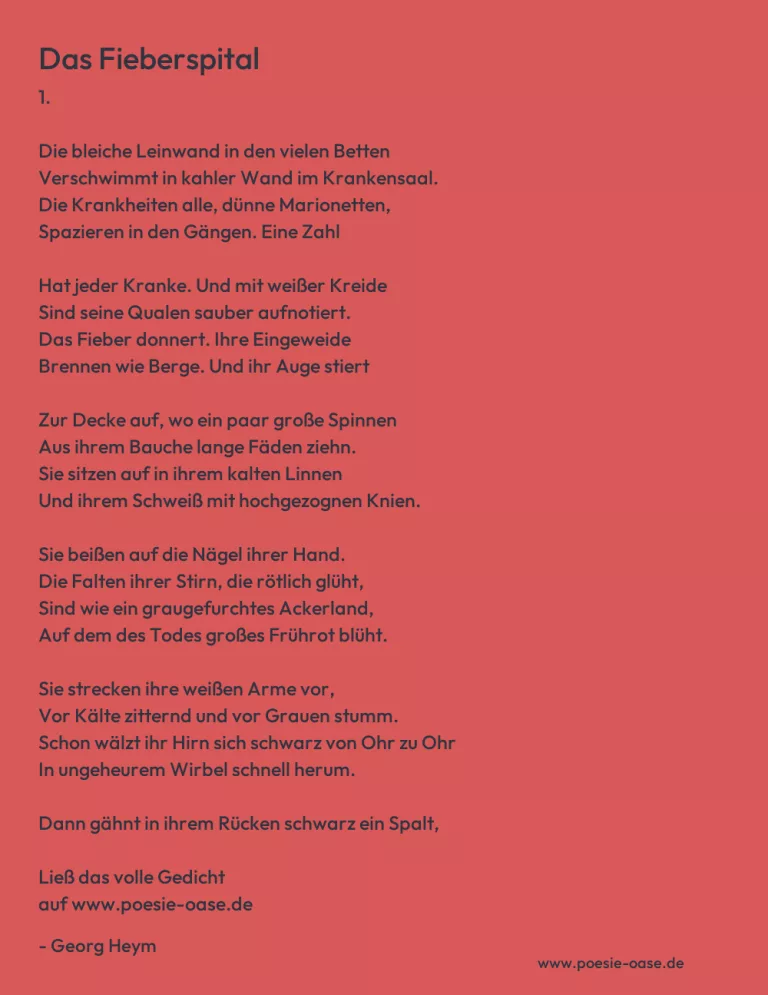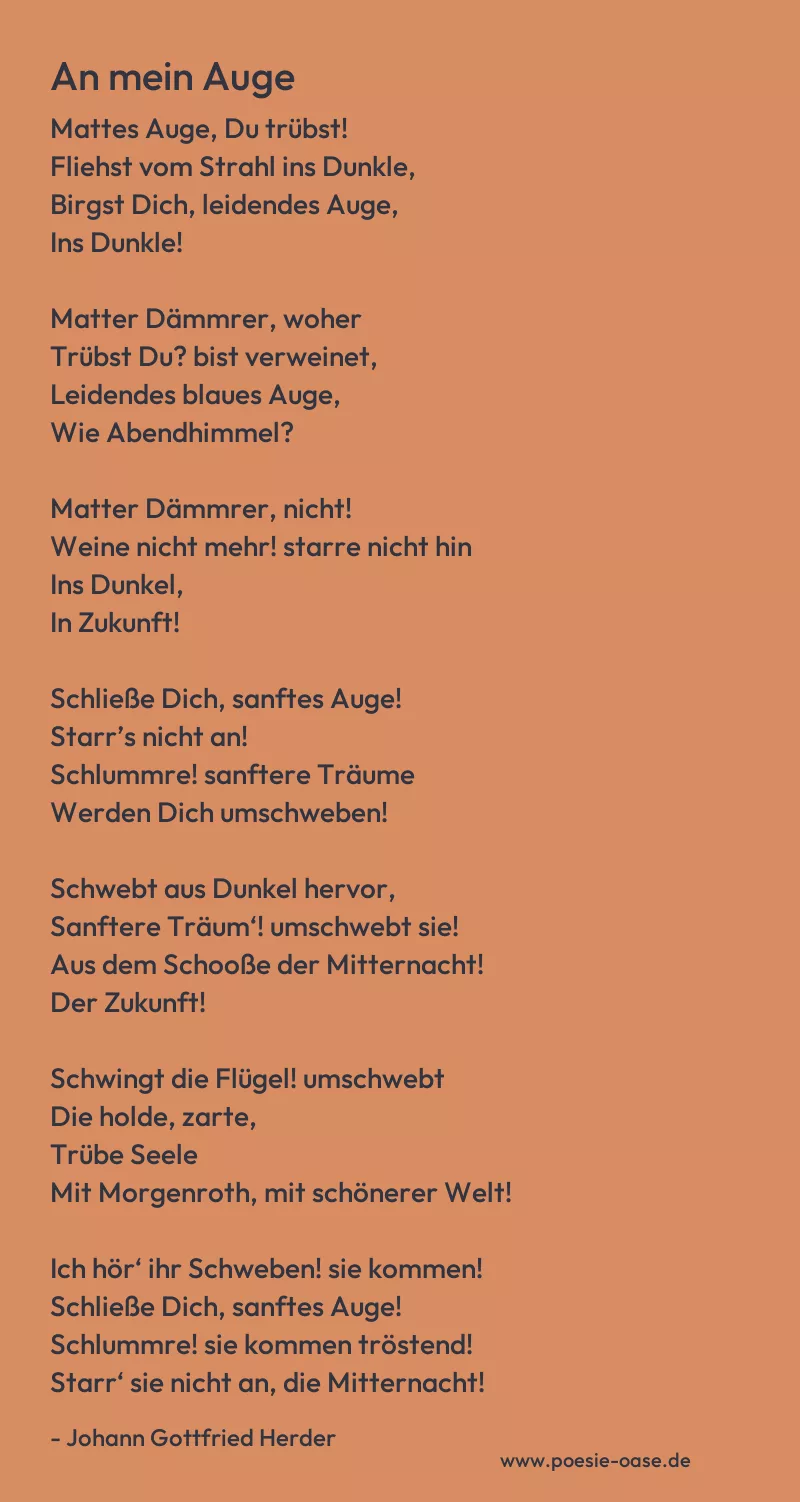An mein Auge
Mattes Auge, Du trübst!
Fliehst vom Strahl ins Dunkle,
Birgst Dich, leidendes Auge,
Ins Dunkle!
Matter Dämmrer, woher
Trübst Du? bist verweinet,
Leidendes blaues Auge,
Wie Abendhimmel?
Matter Dämmrer, nicht!
Weine nicht mehr! starre nicht hin
Ins Dunkel,
In Zukunft!
Schließe Dich, sanftes Auge!
Starr’s nicht an!
Schlummre! sanftere Träume
Werden Dich umschweben!
Schwebt aus Dunkel hervor,
Sanftere Träum‘! umschwebt sie!
Aus dem Schooße der Mitternacht!
Der Zukunft!
Schwingt die Flügel! umschwebt
Die holde, zarte,
Trübe Seele
Mit Morgenroth, mit schönerer Welt!
Ich hör‘ ihr Schweben! sie kommen!
Schließe Dich, sanftes Auge!
Schlummre! sie kommen tröstend!
Starr‘ sie nicht an, die Mitternacht!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
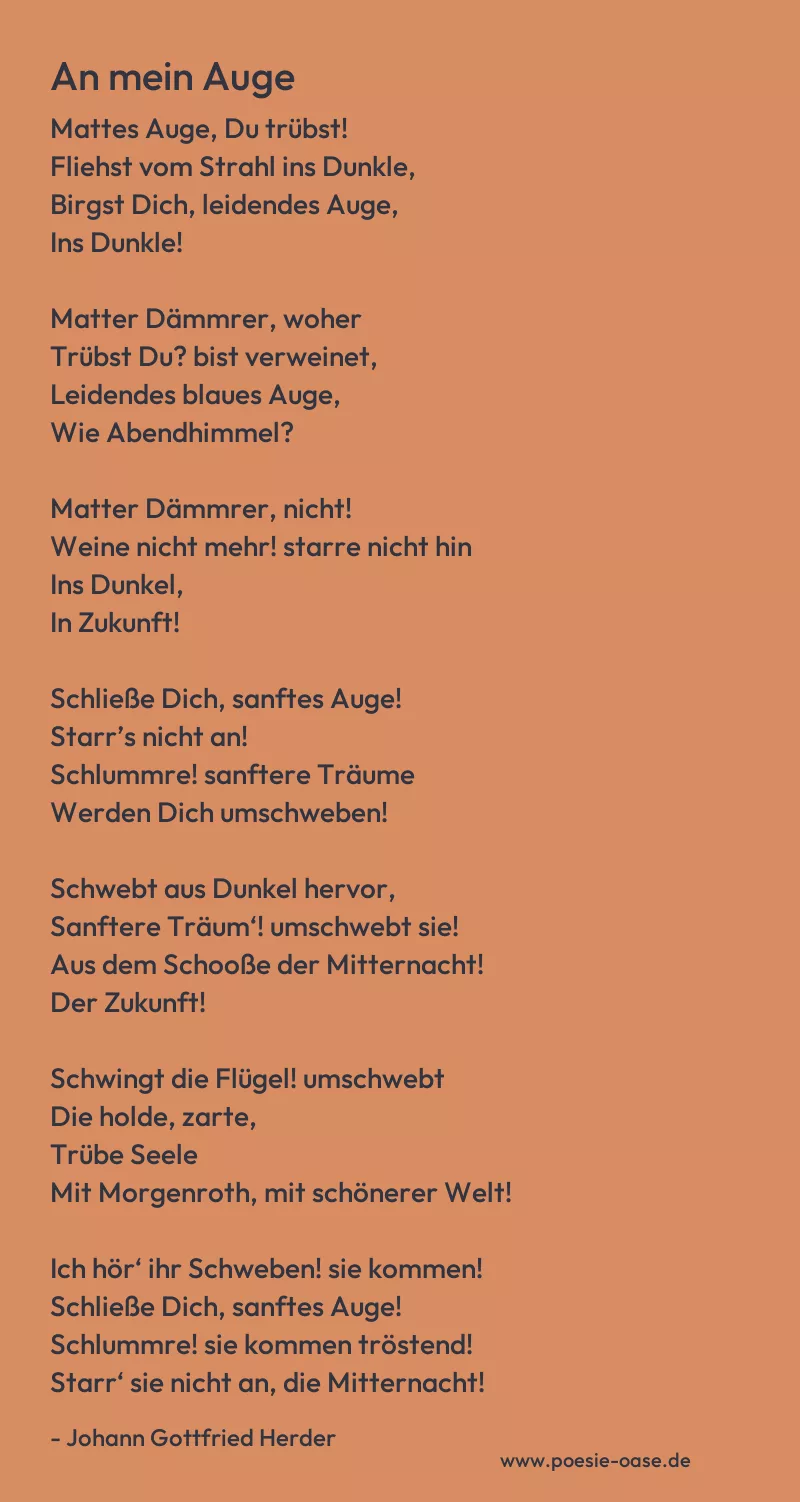
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An mein Auge“ von Johann Gottfried Herder ist eine poetische Auseinandersetzung mit dem Thema der inneren Erschöpfung, des Schmerzes und der Sehnsucht nach Heilung. Zu Beginn wird das „matte Auge“ direkt angesprochen, was als Symbol für eine erschöpfte oder leidende Seele interpretiert werden kann. Das Auge flieht vom „Strahl ins Dunkle“ und „birgt sich ins Dunkle“, was eine Rückzugsbewegung in den Schmerz und die Dunkelheit der Seele widerspiegelt. Diese Zeilen zeigen eine Ablehnung des Lichts und des Lebens, die durch die Trübung des Blickes und das Vermeiden des Hellen verstärkt wird.
In der zweiten Strophe wird das Auge erneut als „leidendes blaues Auge“ beschrieben, das in einem Zustand der Trübung und Wehmut verweilt, vergleichbar mit einem „Abendhimmel“, der symbolisch für den Übergang von Licht zu Dunkelheit steht. Das „Weinen“ des Auges verweist auf eine emotionale Erschöpfung und eine tiefe innere Trauer, die das Ich in die Dunkelheit der Ungewissheit zieht. Das Bild des „Abendhimmels“ kann hier als Metapher für einen Zustand des Abschieds und der letzten Tage eines Zyklus verstanden werden.
Die dritte Strophe fordert das „leidenvolle Auge“ auf, nicht mehr zu weinen oder in die Dunkelheit der Zukunft zu starren. Die „Zukunft“ wird hier als ungewiss und beängstigend dargestellt, und das Gedicht spricht von der Notwendigkeit, den Blick nicht mehr in diese Unsicherheit zu richten. Stattdessen wird das Auge aufgefordert, sich zu schließen, um „sanftere Träume“ zu empfangen und die Härte der gegenwärtigen Dunkelheit hinter sich zu lassen. Der sanfte Schlaf wird hier als eine Form der Erlösung und des Trostes vorgestellt.
In den letzten beiden Strophen verschiebt sich der Fokus zu einer hoffnungsvolleren Vision. Das „Dunkel“ weicht einer sanften „Mitternacht“, aus der eine neue, tröstliche Welt hervorgeht. Die „sanften Träume“ aus dem „Schooße der Mitternacht“ bringen eine Art von Heilung und eine neue Perspektive, die die Seele umhüllen. Das „Morgenroth“ und die „schönere Welt“ symbolisieren einen Neuanfang und eine Erneuerung, die durch den Übergang von der Dunkelheit ins Licht, vom Schmerz zur Erlösung, gebracht werden. Diese Strophe hebt den Moment des Übergangs hervor, der für den Erzähler eine Hoffnung auf eine heilsame Zukunft darstellt.
Insgesamt ist das Gedicht eine Meditation über die dunklen und schmerzhaften Phasen des Lebens, die letztlich von einer sanften Hoffnung auf Trost und Heilung durchbrochen werden. Die Bewegung von der Dunkelheit zur erlösenden „schöneren Welt“ zeigt einen Prozess der inneren Reinigung und des Übergangs zu einer friedlicheren Existenz, die durch den Schlaf und die Träume symbolisiert wird. Herder vermittelt hier eine tiefgründige Vision von der Transformation des Schmerzes und der Sehnsucht nach einer besseren, lichtvollen Zukunft.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.