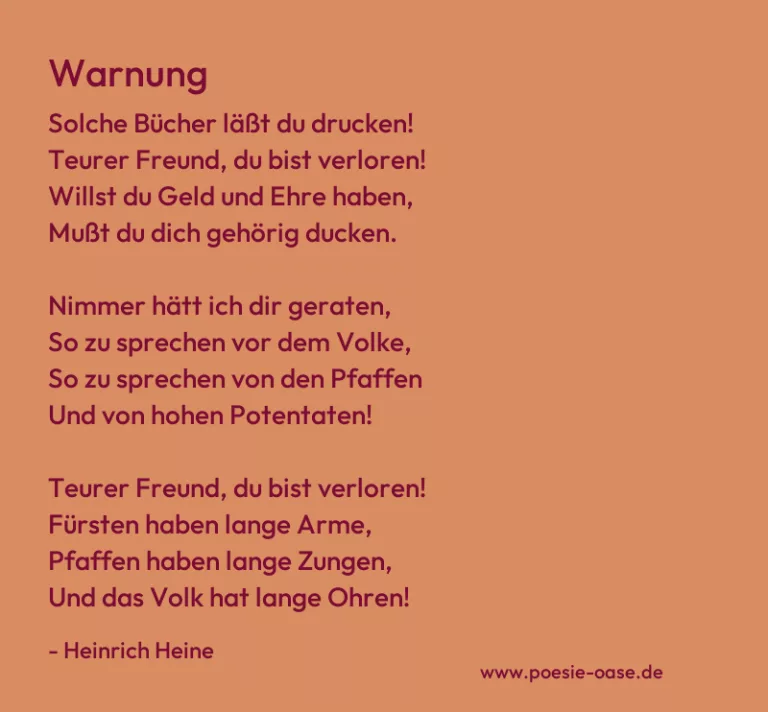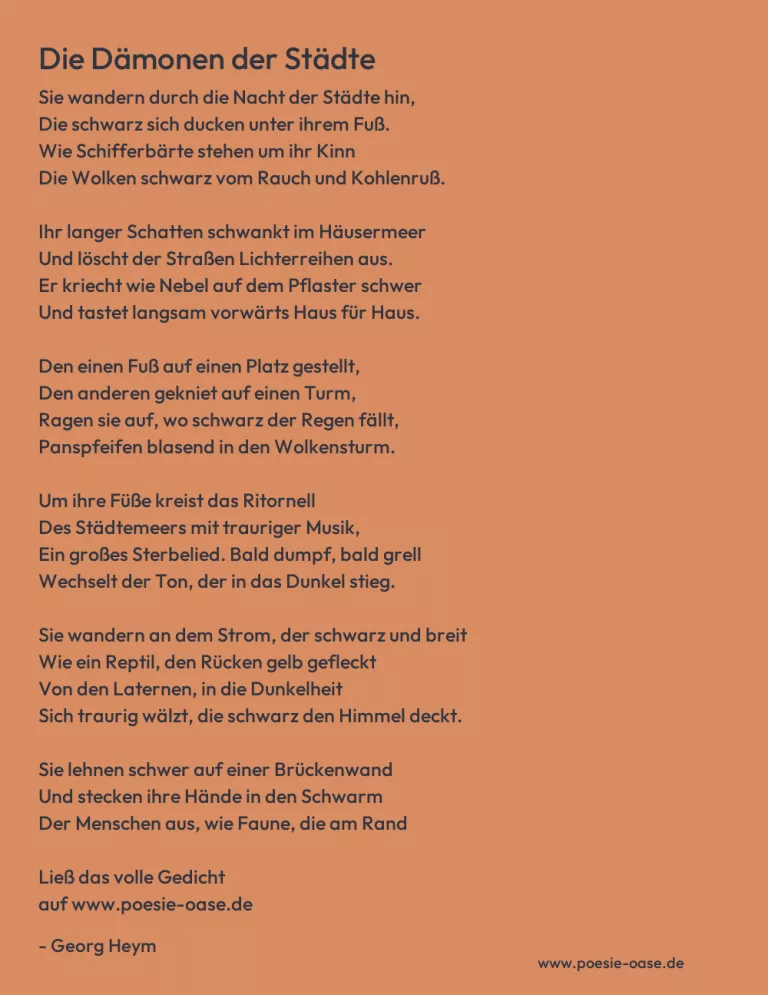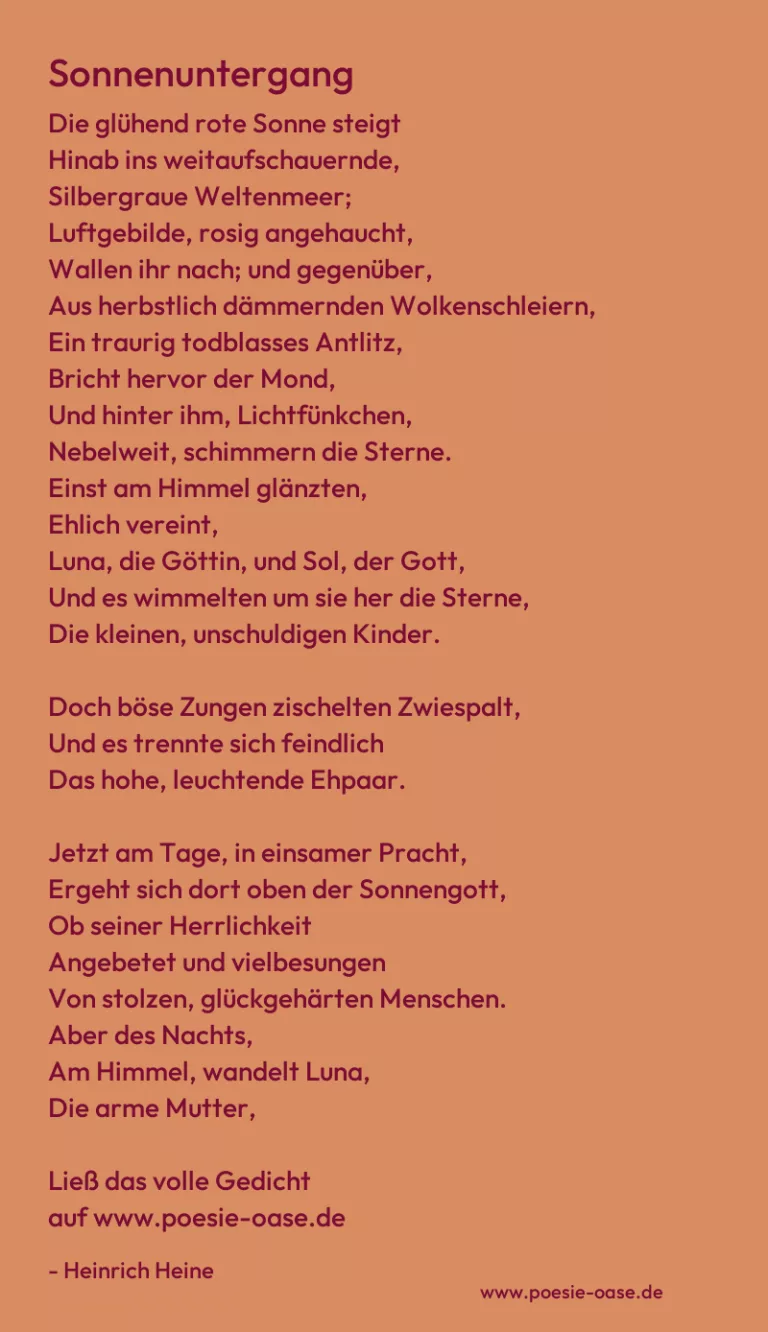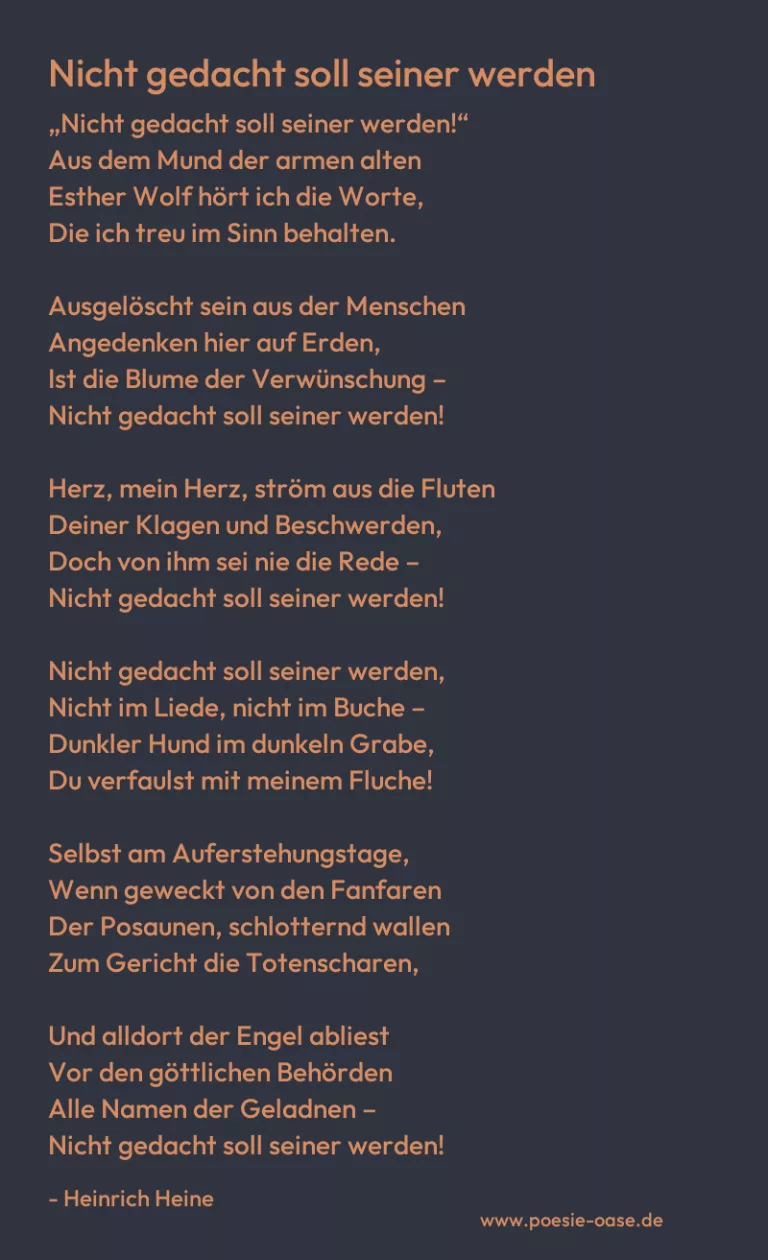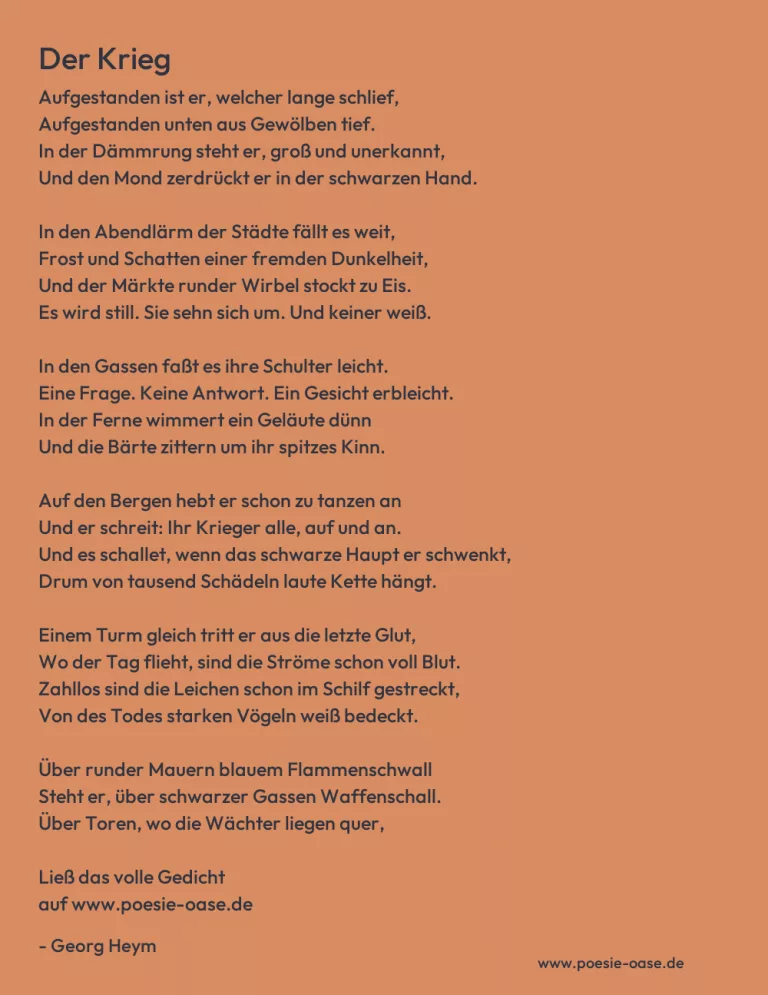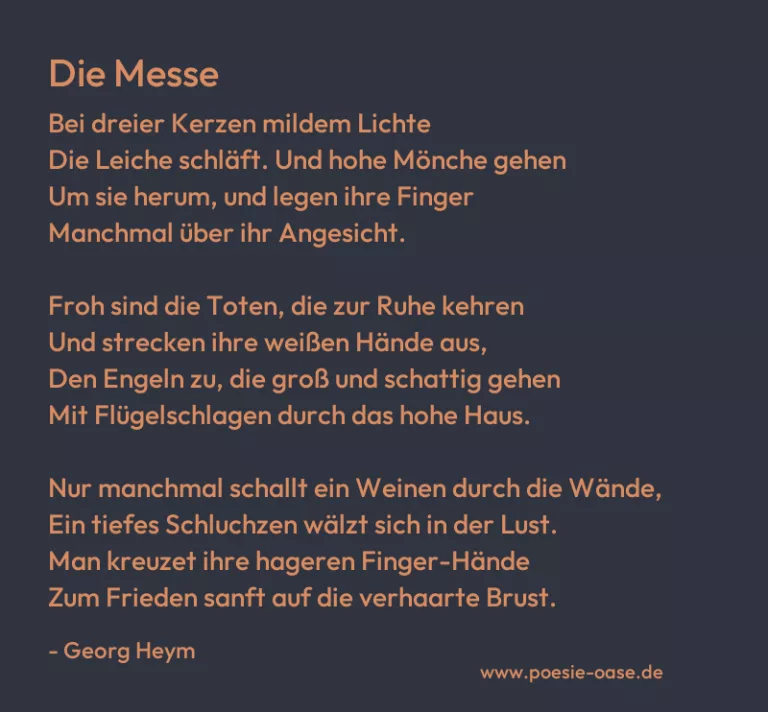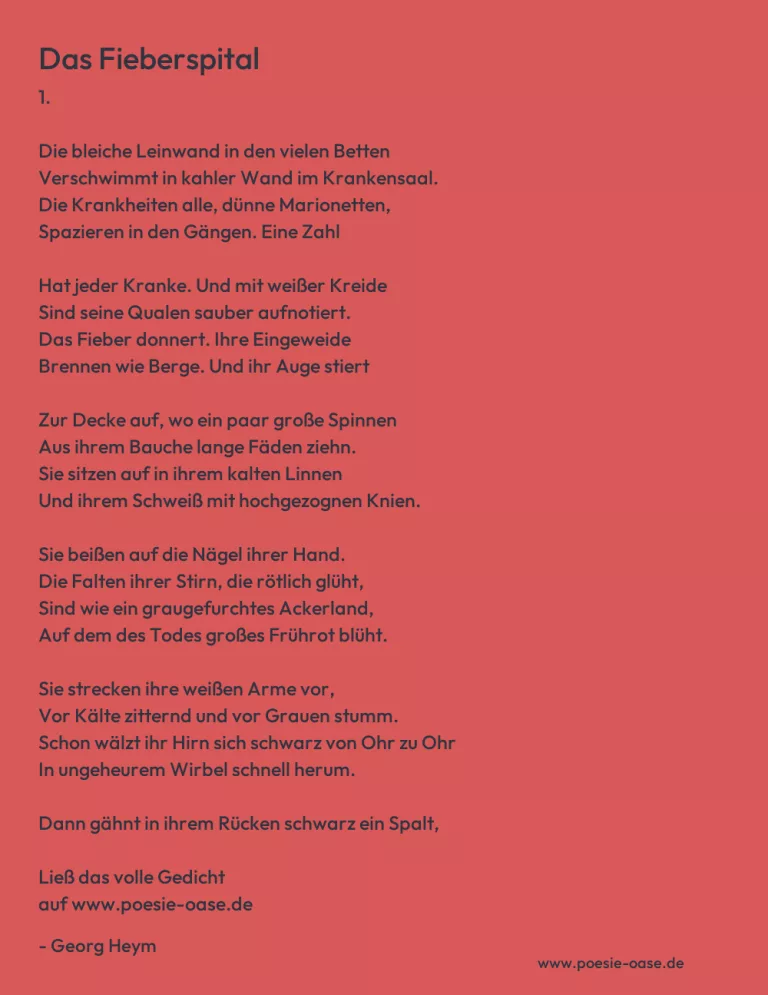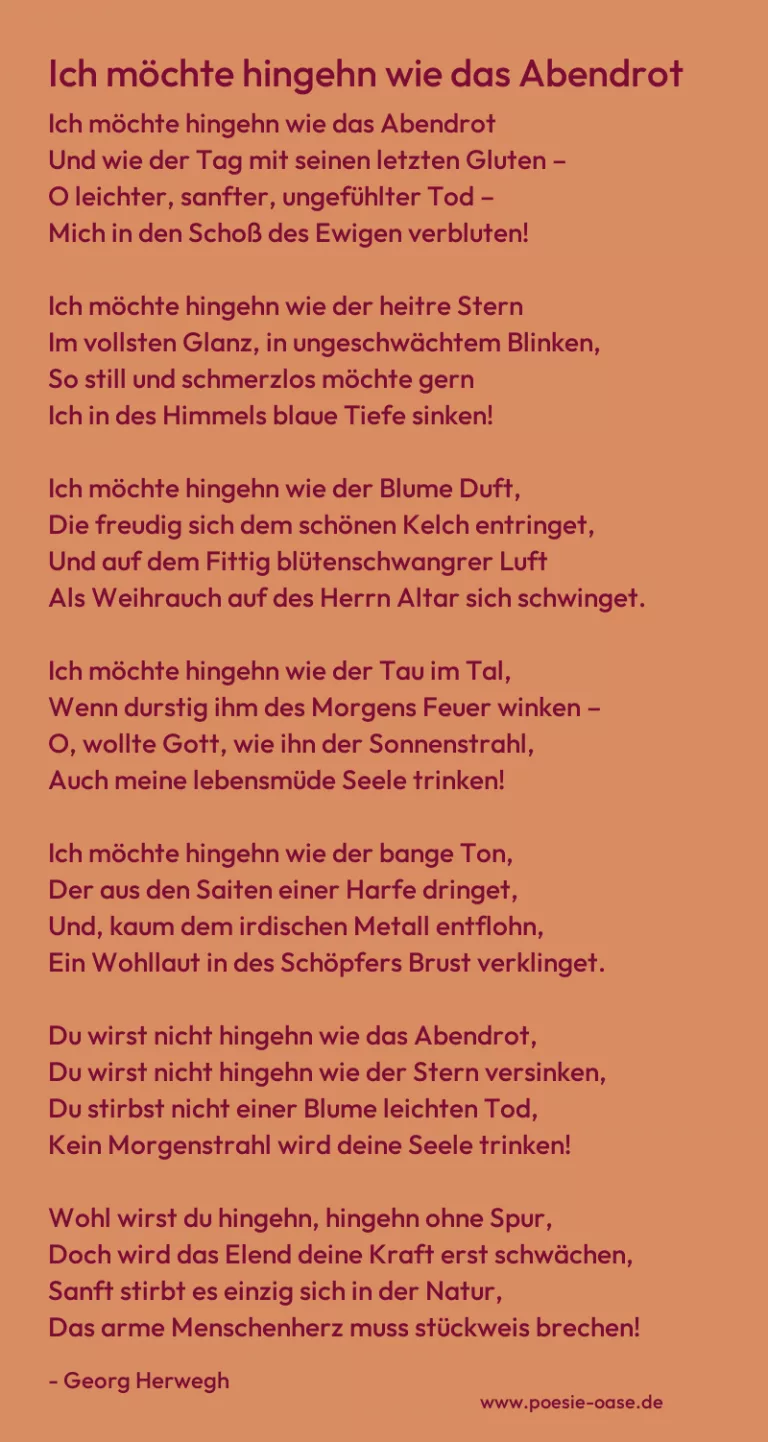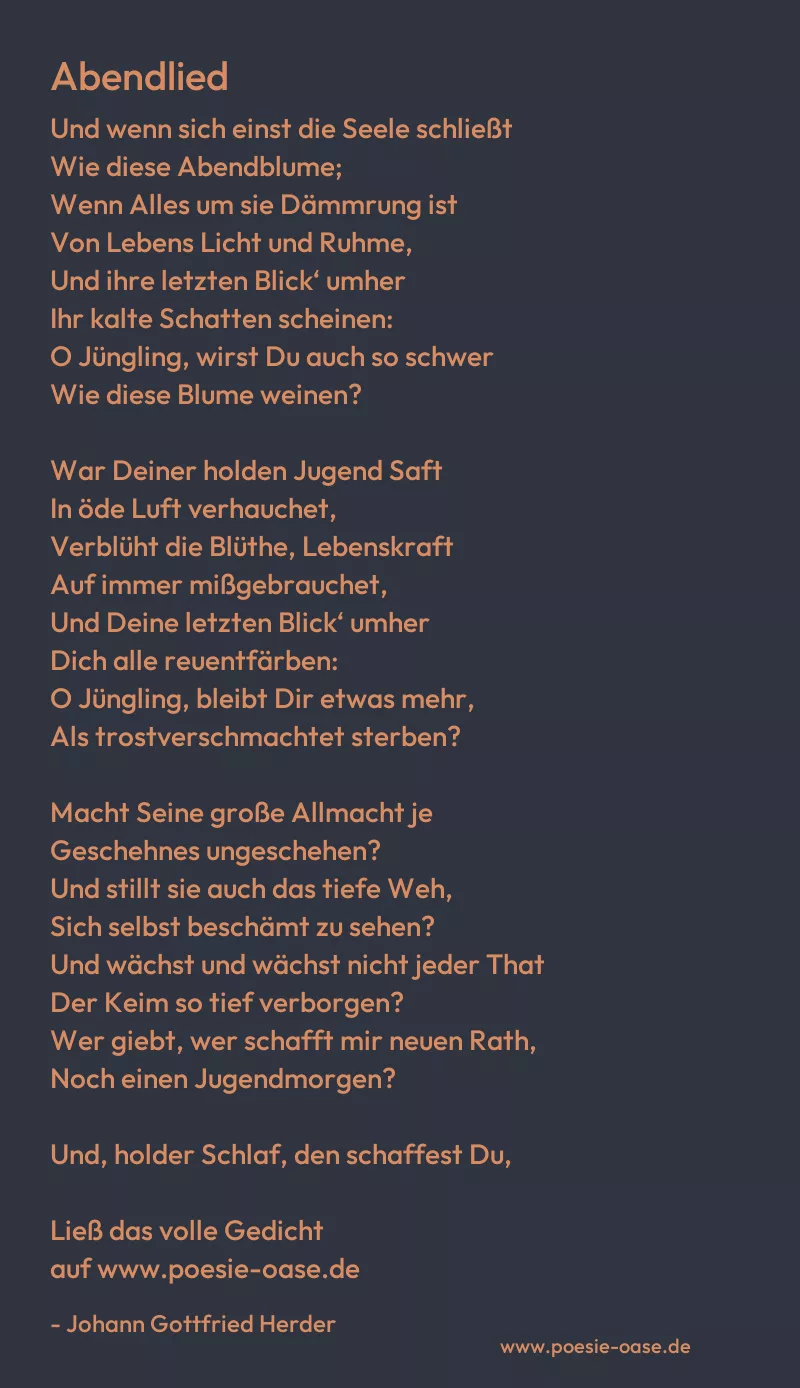Und wenn sich einst die Seele schließt
Wie diese Abendblume;
Wenn Alles um sie Dämmrung ist
Von Lebens Licht und Ruhme,
Und ihre letzten Blick‘ umher
Ihr kalte Schatten scheinen:
O Jüngling, wirst Du auch so schwer
Wie diese Blume weinen?
War Deiner holden Jugend Saft
In öde Luft verhauchet,
Verblüht die Blüthe, Lebenskraft
Auf immer mißgebrauchet,
Und Deine letzten Blick‘ umher
Dich alle reuentfärben:
O Jüngling, bleibt Dir etwas mehr,
Als trostverschmachtet sterben?
Macht Seine große Allmacht je
Geschehnes ungeschehen?
Und stillt sie auch das tiefe Weh,
Sich selbst beschämt zu sehen?
Und wächst und wächst nicht jeder That
Der Keim so tief verborgen?
Wer giebt, wer schafft mir neuen Rath,
Noch einen Jugendmorgen?
Und, holder Schlaf, den schaffest Du,
Giebst neuen Jugendmorgen,
Bist Labetrunk und Schattenruh,
Bist Labsal aller Sorgen,
Bist Todesbruder! O wie schön
Sich Sein und Nichtsein grenzen!
Wie frisch wird meine Abendthrän‘
Am frühen Morgen glänzen!
Und nach dem Tod – es wird uns sein
Als nach des Rausches Schlummer:
Verrauscht, verschlummert Lebenspein
Und Schmerz und Reu und Kummer.
O Tod, o Schlaf, der Dich erfand,
Erfand der Menschheit Segen;
Breit‘ aus auf mich Dein Schlafgewand,
Zur Ruhe mich zu legen!
Denn was wär‘ unsre Lebenszeit,
Auch unsre Zeit der Freuden?
Ein Strudel von Mühseligkeit,
Ein Wirbel süßer Leiden,
Ein ew’ger Taumel! Holder Schlaf,
Zu neuem Freudenmahle
Für Alles, was auch heut mich traf,
Gieb mir die Labeschale!